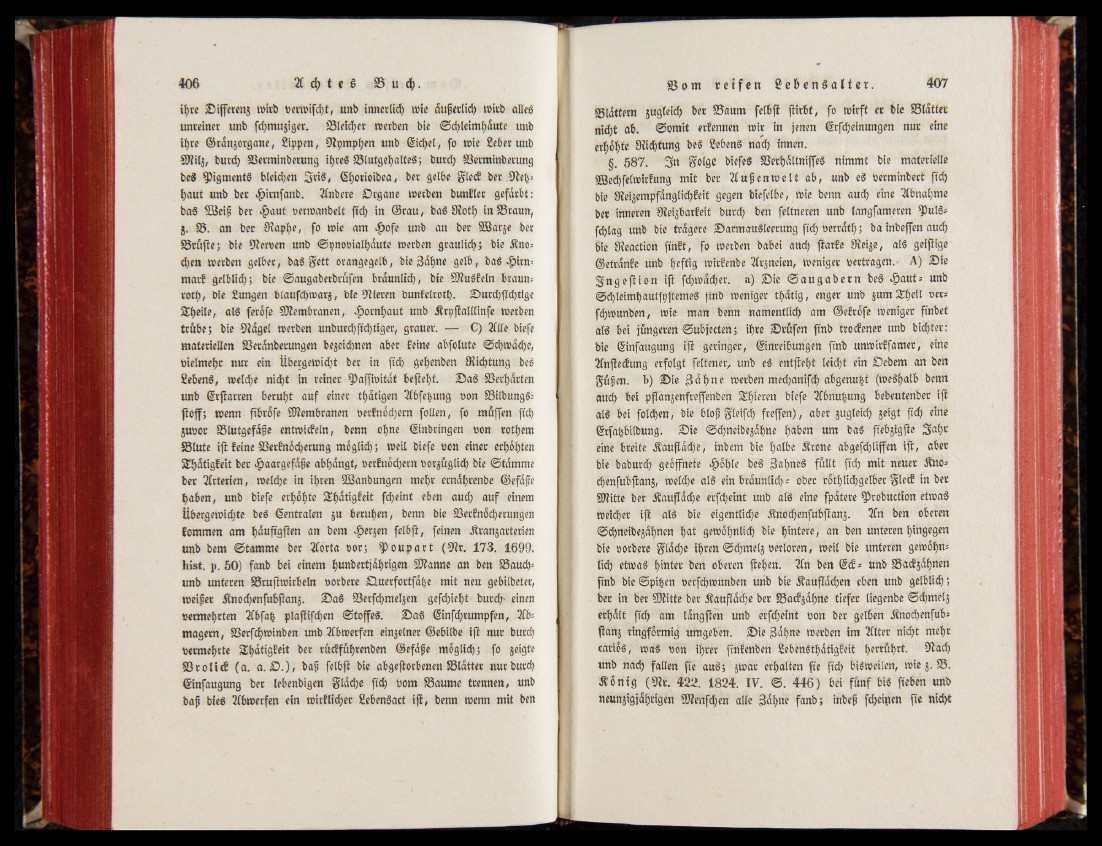
ihre Siffereng wirb vettvifcht, unb innerlich rote dujjetlich wirb alles
unreiner unb fdjmugiger. SSleichet roerben bie (Schleimhäute unb
ihre ©tdngorgane, Sippen, S^mpben unb ©idjjel, fo roie Seber unb
SÄilg, butch SSetminberung ihres SSlutgehalteS; burch SSetminberung
beS Pigments bleiben SriS/ ©hotioibea, ber gelbe $led ber 9leh*
haut unb bet $itnfanb. 2fnbece S rgane roerben bunflet gefärbt:
baS 2Seifj bet $ a u t verroanbelt ftd) in © rau , baS 9loth in SSraun,
g. 55. an ber 9iaphe, fo roie am $ofe unb an ber SBatge ber
SSrüjte; bie Heroen unb Spnovialhdute roerben graulich; bie Äno=
eben werben gelber, ba§ 5fctt orangegelb, bie Bahne gelb, baS $itn=
mark gelblich; bie Saugabetbrüfen bräunlich, bie SDfuSfeln braun*
roth/ bie Sungen blaufd)roarg, bie Vieren bunfelroth- Surd)ftd)tige
SEheile, als ferofe Membranen, Hornhaut unb Ärpjtalllinfe roerben
trübe; bie Sidgel roerben unbucd>ftd?ttger, grauer. — C) 2tlle biefe
materiellen SSerdnbetungen begeiebnen aber feine abfolute Schwache,
vielmehr nur ein Übergewicht ber in ftd) gehenben Ciicftung beS
SebenS, welche nicfjt in reiner ^Pafftoitat befiehl- S a S 8Serf)dttett
unb ©rjiarren beruht auf einer thdtigen 2tbfe|ung non SStlbmtgS*
fioff; wenn ftbtofe Membranen verknöchern follen, fo muffen ftch
guvot SSlutgefafe entwickeln, benn ohne ©inbttngen non rothem
S5lute ijl feine SSetknocfetung möglich; weil biefe von einer erhöhten
SEhatigteit ber .£>aatgefdjje abhdngt, verknöchern vorgüglid) bie Stamme
ber Arterien, roeldhe in ihren SBanbungen mehr erndhtenbe ©efafje
haben, unb biefe erhöhte SEhdtigkeit fcf>cint eben auch auf einem
Übergewichte beS (Zentralen gu beruhen, benn bie SSerfnocherungen
fommen am hduftgfien an bem bergen felbft, feinen Ärangarterien
unb bem S tam m e ber 2Cörta vor; ^ P o u p a r t (Sfr. 173. 1699.
hist. p. 50) fanb bei einem hunbertjdhtigen Spanne an ben 85auch=
unb unteren SSrujtroirbeln vorbete £luerfortfd|e mit neu gebilbeter,
weifet Änochenfubjiang. S a S SSetfcfmelgen gefchieht burd^ einen
vermehrten 2tbfafc plafiifcfen Stoffes. S a S ©infd)tumpfen, 2fb=
magern, SSetfchroinben unb 2fbroerfen einzelner ©ebilbe ifi nur burch
vermehrte SEhdtigkeit ber tüdfufrenben ©efafje möglich; fo geigte
83t olief (a. a. £ ).), baf felbft bie abgejiorbenen SSldtter nur burch
©infaugung ber lebenbigen §ldd)e ftch vom SSaume trennen, unb
baf bieS 2tbroerfen ein wirf liehet SebenSact ijt, benn wenn mit ben
©tattern gugleid) bet 33aum felbft jtirbt, fo wirft er bie 85ldtter
nitht ab. S om it erfennen wir in jenen ©rfcheinungen nur eine
erh§htc Achtung beS SebenS nach innen.
§. 587. S « Solge biefeS 83erhdltniffeS nimmt bie materielle
SOSechfelroirfung mit ber 2Cuj jenroelt ab, unb es verminbert ftch
bie «Keigempfdnglichfeit gegen biefelbe, wie benn auch eine Abnahme
ber inneren IReigbarfeit burch ben feltneren unb langfameren ^>ulS=
fdf)lag unb bie trdgere SarmauSleerung ftd) verrdth; ba inbeffen aud)
bie Sieaction ftnft, fo werben babei aud) ftarfe 9teige, als geijtige
©etrdnfe unb heftig roirfenbe 2ftgneien, weniger vertragen.. A) S ie
S n g e j t i o n ijt fchrodd)er. a) S ie S a u g a b e t n beê- >£>aut* unb
Sd)leimhautfpjtemeS ftnb weniger thdtig, enger unb gumSEheil vet*
fd)rounben, roie man benn namentlich am ©efrofe weniger ftnbet
als bei jüngeren Subjecten; ihre S rüfen ftnb trockener unb bichter:
bie ©infaugung ijt geringer, ©inreibungen ftnb unroirffamet, eine
2tnjiedung erfolgt feltener, unb es entfieht teidjt ein Sebent an ben
güfjen. b) S ie Ba h n e roerben mechanifch abgenu^t (weshalb benn
aud) bei pflangenfreffenben Afteren biefe 2Cbnu|ung bebeutenber ijt
als bei fotchen, bie blof gleifcf frefjen), aber gugleich geigt ftch eine
©rfahbilbung. S ie Schnetbegafne haben um baS ftebgigjte S ah t
eine breite Äaujtddje, inbem bie halbe Ärone abgefdjlijfen ijt, aber
bie babutd) geöffnete $ohle beS BahneS füllt ftch mit neuer üno*
djenfubjtang, roeldje als ein bräunliche ober rothlichgelber S ied in ber
Sftitte ber Äaujtdche erfcheint unb als eine fpdtere «Probuction etwas
weichet ijt als bie eigentliche Änod)enfubjiang. 2tn ben oberen
Sdjneibegdhnen hat gewöhnlich bie hintere, an ben unteren hingegen
bie vorbere flache ihren Sdfmelg verloren, weil bie unteren gewöhn*
lid) etwas hinter ben oberen jteheri. 2tn ben ©d * unb SSacfgähnen
ftnb bie S pieen verfdjrounben unb bie Äaufldcfen eben unb gelblidh;
ber in ber SDtitte bet Äauflacfe ber SSadgafne tiefer liegenbe Schmelg
erhalt ftch am Idngflen unb erfcheint von bet gelben Stnocfenfub*
jtang ringförmig umgeben. S ie Bahne roerben im 2Clter nidht mehr
carioS, was von ihrer ftnkenben SebenSthdtigfeit herrührt. Stad)
unb nach fallen fte aus; groar erhalten fte ftd) bisweilen, roie g. 85.
Äo n i g (S tr. 422. 1824. IV. S . 4 4 6 ) bei fünf bis fieben unb
neungigjahrtgen SÄenfchen alle Bdhne fanb; inbef fdheinen fte nid)t