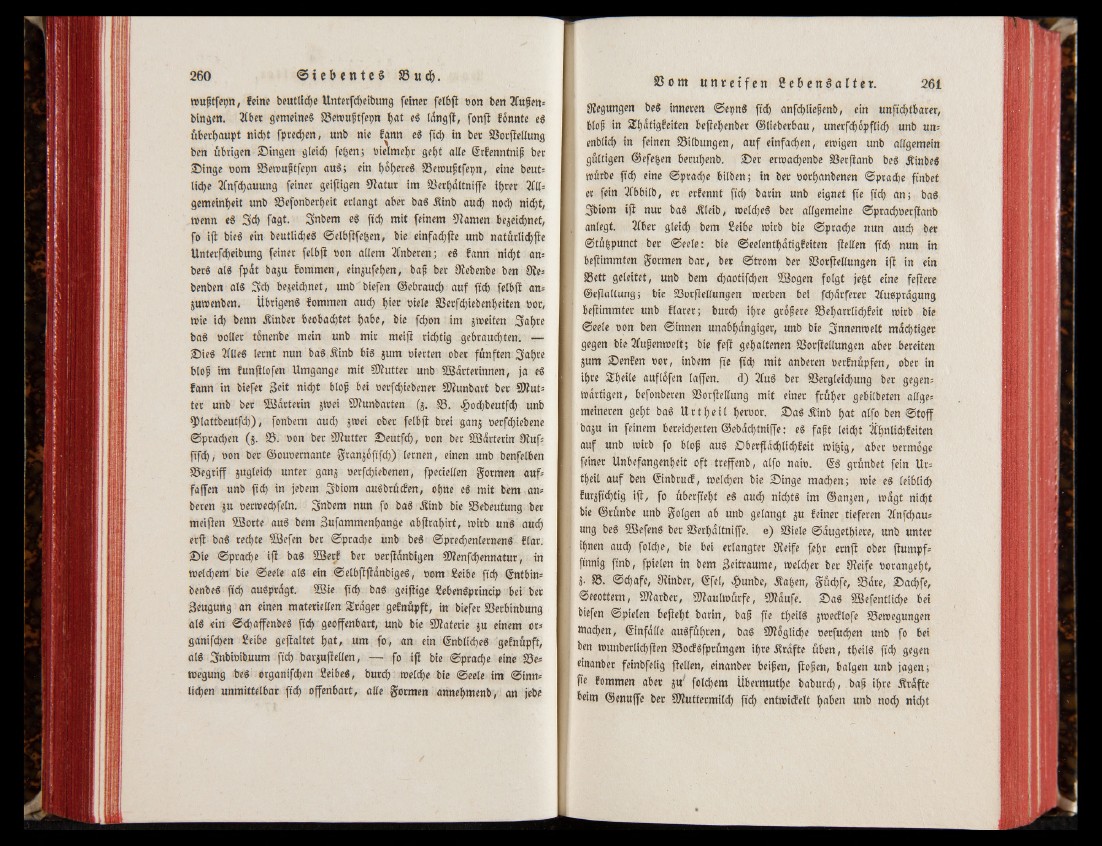
wußtfepn, feine beutlidbe Unterfdbeibung feinet felbfi non ben Stufen»
hingen. 2fbet gemeines SSewußtfepn bat eS Idngft, fonfi fonnte es
überhaupt nicht fptedjen, unb nie fann eS ftch in bet fBotfiellung
ben übrigen Singen gleich fefcen; oielmebr gebt alle (Srfenntniß bet
S inge nom SSewußtfepn auS; ein f>of)eceS SSewußtfepn, eine beut»
liebe Slnfcbauung feinet getjligen S tatut im SSerbdltniffe if>cet Sill»
gemeinbeit unb S3cfonbert>eit erlangt aber baS Jiinb auch nod) nicht,
wenn eS S^b f^Qt. Snbern eS ftd? mit feinem Flamen bezeichnet,
fo ift bieS ein beutlidbeS Selbfifehen, bie einfaebfie unb natütlicbfie
Untetfcbeibung feiner felbfi non allem Slnbeten; eS fann nicht an»
betS als fpdt baju fommen, einjufeben, baß bet Stebenbe ben Sie»
benben als Sch bezeichnet, unb biefen ©ebtauch auf ftef? felbfi an»
Zuwenben. Übrigens fommen auch b 'er t>icle 23erfd>iebenf)eiten oor,
wie idb benn Äinbet beobachtet habe, bie fdbon int zweiten Sabte
baS »oller tonenbe mein unb m it meifi richtig gebrauchten. —
SieS SlUeS lernt nun baS üinb bis zum inerten ober fünften Sahte
bloß im funfilofen Umgänge mit SJiuttec unb SBartetinnen, ja eS
fann in tiefer 3eit nidt>t bloß bei oetfebiebenet SDiunbart bet SÜJiut»
tet unb bet Sßdrterin zwei SOiunbarten (z. 33. .fjoebbeutfeb unb
$Plattbeutfcb) i fonbem auch zwei ober felbfi brei ganz wtfehiebene
Sprachen (z. SS. oon bet SDZuttet Seutfcf), »on bet Södrterin 9luf»
ftfd>, oon bet ©ouoernante gtanzoftfeh) lernen, einen unb benfelben
SSegriff zugleich unter ganz oetfd)iebenen, fpeciellen gornten auf»
faffen unb ftd) in jebem Sbiom auSbtücfen, ohne eS mit bem an»
beten zu oerwedbfeln. Snbem nun fo baS itinb bie SSebeutung bet
meifien SBorte aus bem Sufammenbange abfirabirt, toitb uns auch
etfi baS rechte 2Befen bet Sprache unb beS SprecbenlernenS fldt.
S ie Sprache ifi baS SBerf bet oerfidnbigen SDienfchennatur, in
weldjem bie Seele als ein SelbfifidnbigeS, oom Seite ftd) ßfntbin»
benbeS ftd) auSprdgt. SBie ftd) baS geifiige SebenSprincip bei bet
Beugung an einen materiellen fra g e t gefnupft, in biefer SSecbinbung
als ein SchaffenbeS ftch geoffenbart, unb bie SDiaterie zu einem ot*
ganifchen Selbe gefialtet b a t, um fo, an ein ©nblicbeS gefnüpft,
als 3nbioibuum ftd) barzufieüen, — fo ifi bie Sprache eine 33e»
Wegung beS otgantfd)en SeibeS, butch welche bie Seele im Sinn»
lieben unmittelbar ftch offenbart, alle gotrnen annebmenb, an jebe
Regungen beS inneren SepnS ftd) anfchließenb, ein unftd)tbarer,
bloß in SEbdtigfeiten befiebenbet ©liebetbau, unerfdbopflid) unb un»
enblicb in feinen SSilbungen, auf einfachen, ewigen unb allgemein
gültigen ©efeijen berubenb. S e t erwadjenbe SSerfianb beS ÄinbeS
würbe ftd) eine Sprache bilben; in bet ootbanbenen Sprache ftnbet
ec fein 2fbbilb, et erfennt ftd) barin unb eignet fte ftch an; baS
3 biom ifi nut baS üleib, welches bet allgemeine Spracboetfianb
anlegt. 2fber gleich bem Selbe wirb bie Sprache nun aud) bet
Stüfcpunct bet Seele: bie Seelentbdtigfeiten fiellen ftd) nun in
befiimmten formen b at, bet S trom bet SSotfiellungen ifi in ein
S5ett geleitet, unb bem d)aotifd)en 2Sogen folgt je |t eine fefiere
©efialtung; bie SSotfiellungen werben bei fchdrferet 2fuSprdgung
befiimmtet unb flarer; burd) ihre größere SSebarrlichfeit wirb bie
Seele oon ben Sinnen unabhängiger, unb bie Innenwelt mächtiger
gegen bie Außenwelt; bie fefi gehaltenen SSorfiellungen aber bereiten
Zum Senfen not, inbern fte ftd) mit anberen »erfnüpfen, obet in
ihre Steile attflofen laffen. d) 2luS bet SSergleichung bet gegen»
wattigen, befonberen SBorfiellung mit einet früher gebilbeten allge»
meineren gebt baS U r t b e i l beroor. S a S Äinb bat alfo ben S to ff
bazu in feinem bereicherten ©ebddbtniffe: eS faßt leicht 2lbnlid)feiten
auf unb wirb fo bloß aus SberjTddblicbfeit wt&ig, aber oermoge
feiner Unbefangenheit oft treffenb, alfo naio. ßg grünbet fein Ur»
tt)eil auf ben Güinbrucf, welchen bie Singe machen; wie eS leiblich
furzftd)tig ifi, fo überftebf eS auch nichts im ©anzen, wagt nidbt
bie ©rünbe unb folgen ab unb gelangt zu feiner tieferen 2Cnfd)au»
ung beS SBefenS bet SSerbdltniffe. e) 33iele Sdugetbiete, unb unter
ihnen auch folche, bie bei erlangtet 0?eife febt etnfi obet fiumpf»
finnig ftnb, fpielen in bem geitraume, welcher bet Steife ootangebt,
Z- SS. Schafe, JKinber, @fel, $unbe, Äa&en, gücbfe, SSdre, Sachfe,
Seeottern, d a r b e t, Maulwürfe, SJlaufe. S a S 2ßefentlid)e bei
biefen Spielen befiebt barin, baß fte tbeilS zwecflofe SSewegungen
wachen, (Sinfdlle auSfübten, baS SJZdgliche oetfueben unb fo bei
ben wunberlichfien SSoifSfptüngen ihre Grafte üben, tbeilS ftch gegen
einanbet feinbfelig fiellen, einanbet beißen, fioßen, balgen unb jagen;
fte fommen abet zu' foldjem Übermutbe baburdb, baß ihre Ätdfte
beim ©enuffe bet SD?uttermilcb ftch entwickelt haben unb nod) nidbt