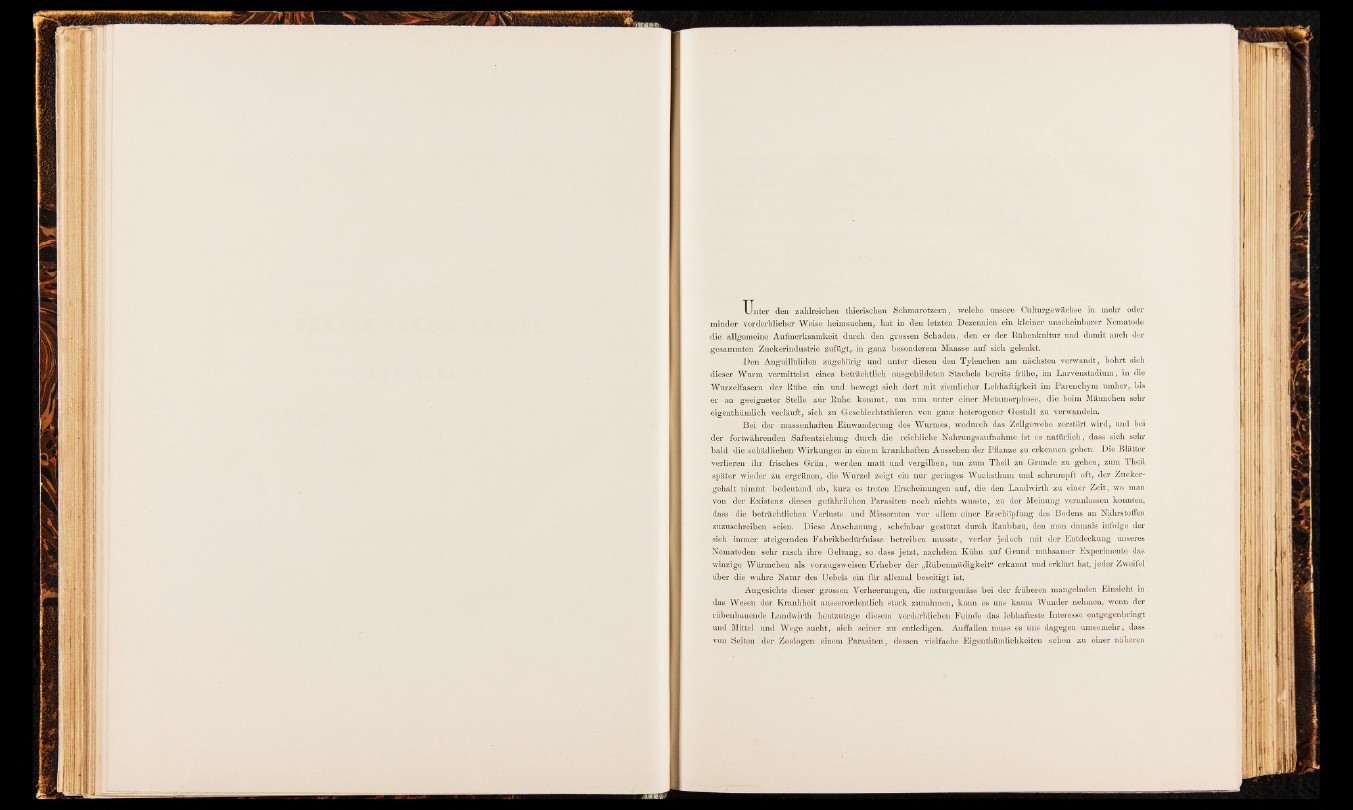
Unter den zahlreichen thierischen Schmarotzern, welche unsere Culturgewächse in mehr oder,
minder verderblicher Weise heimsuchen, hat in den letzten Dezennien ein kleiner unscheinbarer Nematode
die allgemeine Aufinerksamkeit durch den grossen Schaden, den er der Rübenkultur und damit auch der
gesammten Zuckerindustrie zufügt, in ganz besonderem Maasse auf sich gelenkt.
Den Anguilluliden zugehörig und unter diesen den Tylenchen am nächsten verwandt, bohrt sich
dieser Wurm vermittelst eines beträchtlich ausgebildeten Stachels bereits frühe, im Larvenstadium, in die
Wurzelfasem der Rübe ein und bewegt sich dort mit ziemlicher Lebhaftigkeit im Parenchym umher, bis
er an geeigneter Stelle zur Ruhe kommt, um nun unter einer Metamorphose, die beim Männchen sehr
eigenthtimlich verläuft, sieh zu Geschlechtsthieren von ganz heterogener Gestalt zu verwandeln.
Bei der massenhaften Einwanderung des Wurmes, wodurch das Zellgewebe zerstört wird, und bei
der fortwährenden Saftentziehung durch die reichliche Nahrungsaufnahme ist es natürlich, dass sich sehr
bald die schädlichen Wirkungen in einem krankhaften Aussehen der Pflanze zu erkennen geben. Die Blätter
verlieren ihr frisches Grün,, werden matt und vergilben, um zum Theil zu Grunde zu gehen, zum Theil
später wieder zu ergrünen, die Wurzel zeigt ein nur geringes Wachsthum und schrumpft oft, der Zuckergehalt
nimmt bedeutend- ab, kurz es treten Erscheinungen auf, die den Landwirth zu einer Zeit, wo man
von der Existenz diesés gefährlichen Parasiten noch nichts wusste, zu der Meinung veranlassen konnten,
dass die beträchtlichen Yei'luste und Missernten vor allem einer Erschöpfung des Bodens an Nährstoffen
zuzuschreiben seien. Diese Anschauung, scheinbar gestützt durch Raubbau, den man damals infolge der
sich immer steigernden Fabrikbedürfnisse betreiben musste, verlor jedoch mit der Entdeckung unseres
Nematoden sehr rasch ihre Geltung, so dass jetzt, nachdem Kühn auf Grund mühsamer Experimente das
winzige Würmchen als vorzugsweisen Urheber der „Rübenmüdigkeit“ erkannt und erklärt hat, jeder Zweifel
über die wahre Natur des Uebels ein für allemal beseitigt ist.
Angesichts dieser grossen Verheerungen, die naturgemäss bei der früheren mangelnden Einsicht in
das Wesen der Krankheit ausserordentlich stark Zunahmen, kann es uns kaum Wunder nehmen, wenn der
rübenbauende Landwirth heutzutage diesem verderblichen Feinde das lebhafteste Interesse entgegenbringt
und Mittel und Wege sucht, sich seiner zu entledigen. Auffallen muss es uns dagegen umsomehr, dass
von Seiten der Zoologen einem Parasiten, dessen vielfache Eigenthümliehkeiten schon zu einer näheren