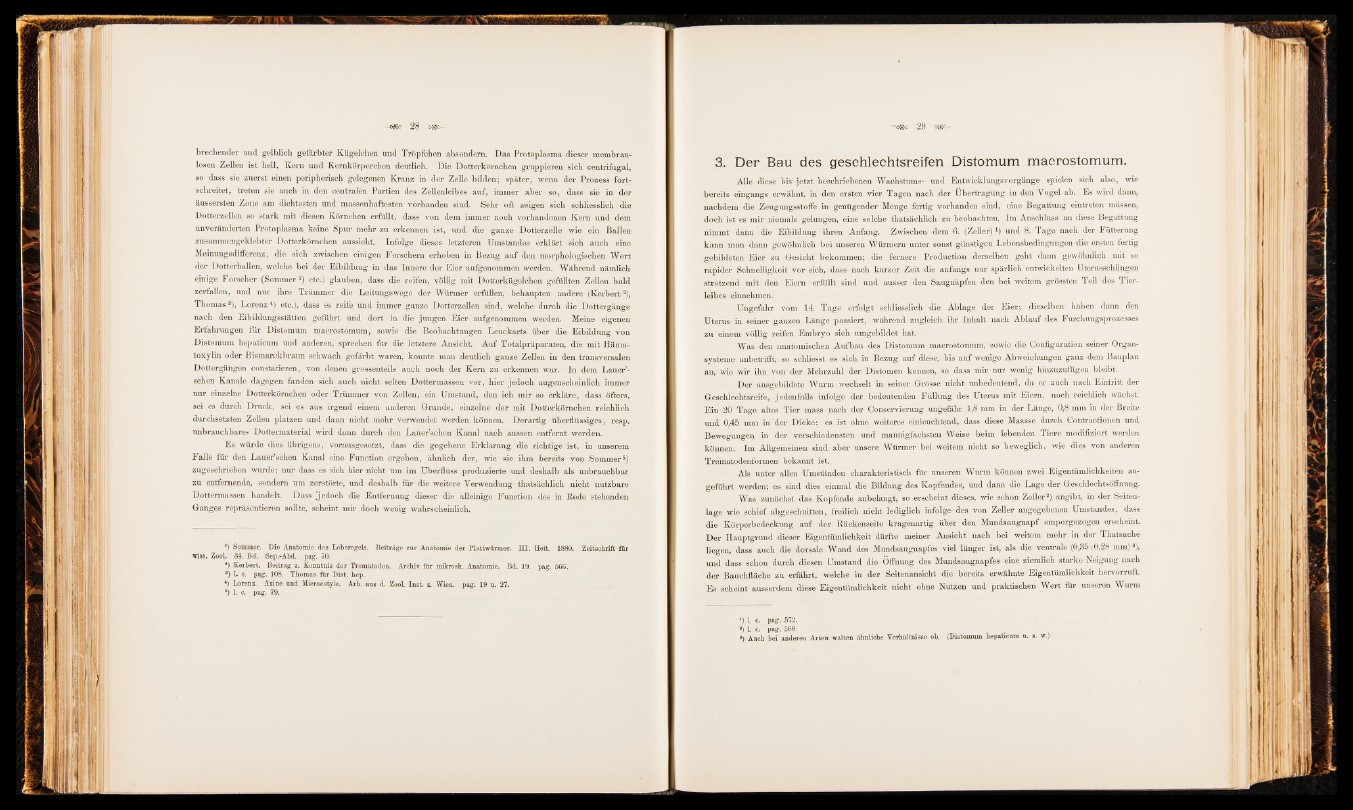
brechender und gelblich gefärbter Kügelchen und Tröpfchen absondern. Das Protoplasma dieser membranlosen
Zellen ist hell, Kern und Kemkörperchen deutlich. Die Dotterkörnchen gruppieren sich centrifugal,
so dass sie zuerst einen peripherisch gelegenen Kranz in der Zelle bilden; später, wenn der Prozess fortschreitet,
treten sie auch in den centralen Partien des Zellenleibes auf, immer aber so, dass sie in der
äussersten Zone am dichtesten und massenhaftesten vorhanden sind. Sehr oft zeigen sich schliesslich die
Dotterzellen so stark mit diesen Körnchen erfüllt, dass von dem immer noch vorhandenen Kern und dem
unveränderten Protoplasma keine Spur mehr zu erkennen ist, und die ganze Dötterzelle wie ein Ballen
zusammengeklebter Dotterkörnchen aussieht. Infolge dieses letzteren Umstandes erklärt sich auch eine
Meinungsdifferenz, die sich zwischen einigen Forschern erhoben in Bezug auf den morphologischen Wert
der Dotterballen, welche bei der Eibildung in das Innere der Eier aufgenommen werden. Während nämlich
einige Forscher (Sommer1) etc.) glauben, dass die reifen, völlig mit Dotterkügelchen gefüllten Zellen bald
zerfallen, und nur ihre Trümmer die Leitungswege der Würmer erfüllen, behaupten andere (Kerbert2),
Thomas 8), Lorenz 4) etc.), dass es reife und immer ganze Dotterzellen sind, welche durch die Dottergänge
nach den Eibildungsstätten geführt und dort in die jungen Eier aufgenommen werden. Meine eigenen
Erfahrungen für Distomum macrostomum, sowie die Beobachtungen Leuckarts über die Eibildung von
Distomum hepaticum und anderen, sprechen für die letztere Ansicht. Auf Totalpräparaten, die mit Häma-
toxylin oder Bismarckbraun schwach gefärbt waren, konnte man deutlich ganze Zellen in den transversalen
Dottergängen constatieren, von denen grossenteils auch noch der Kern zu erkennen war. In dem Lauer’-
schen Kanäle dagegen fanden sich auch nicht selten Dottermassen vor, hier jedoch augenscheinlich immer
nur einzelne Dotterkörnchen oder Trümmer von Zellen, ein Umstand, den ich mir so erkläre, dass öfters,
sei es durch Druck, sei es aus irgend einem anderen Grunde, einzelne der mit Dotterkörnchen reichlich
durchsetzten Zellen platzen und dann nicht mehr verwendet werden können. Derartig überflüssiges, resp.
unbrauchbares Dottermaterial wird dann durch den Lauer’schen Kanal nach aussen entfernt werden.
Es würde dies übrigens, vorausgesetzt, dass die gegebene Erklärung die richtige ist, in unserem
Falle für den Lauer’schen Kanal eine Function ergeben, ähnlich der, wie sie ihm bereits von Sommer6)
zugeschrieben wurde; nur dass es sich hier nicht um im Überfluss produzierte und deshalb als unbrauchbar
zu entfernende, sondern um zerstörte, und deshalb für die weitere Verwendung thatsächlich nicht nutzbare
Dottermassen handelt. Dass jedoch die Entfernung dieser die alleinige Function des in Bede stehenden
Ganges repräsentieren sollte, scheint mir doch wenig wahrscheinlich.
*) Sommer. Die Anatomie des Leberegels. Beiträge zur Anatomie der Plattwärmer. III. Heft. 1880. Zeitschrift für
wiss. ZooL 34. Bd. Sep.-Abd. pag. 70.
*) Kerbert. Beitrag z. Kenntnis der Trematoden. Archiv für mikrosk. Anatomie. Bd. 19. pag. 566.
s) 1. c. pag. 108. Thomas für Dist. hep.
*) Lorenz. Axine und Microcotyle. Arb. aus d. Zool. Inst. z. Wien. pag. 19 u. 27.
®) L c. pag. 79.
3. Der Bau des gesehleehtsreifen Distomum macrostomum.
Alle diese bis jetzt beschriebenen Wachstums- und EntwicklungsVorgänge spielen sich also, wie
bereits eingangs erwähnt, in den ersten vier Tagen nach der Übertragung in den Vogel ab. Es wird dann,
nachdem die Zeugungsstoffe in genügender Menge fertig vorhanden sind, eine Begattung eintreten müssen,
doch ist es mir niemals gelungen, eine solche thatsächlich zu beobachten. Im Anschluss an diese Begattung
niiümt dann die Eibildung ihren Anfang. Zwischen dem 6. (Zeller)1) und 8. Tage nach der Fütterung
k ann man dann gewöhnlich bei unseren Würmern unter sonst günstigen Lebensbedingungen die ersten fertig
gebildeten Eier zu Gesicht bekommen; die fernere Production derselben geht dann gewöhnlich mit so
rapider Schnelligkeit vor sich, dass nach kurzer Zeit die anfangs nur spärlich entwickelten Uterusschlingen
strotzend mit den Eiern erfüllt sind und ausser den Saugnäpfen den bei weitem grössten Teil des Tierleibes
einnehmen.
Ungefähr vom 14. Tage erfolgt schliesslich die Ablage der Eier; dieselben haben dann den
Uterus in seiner ganzen Länge passiert, während zugleich ihr Inhalt nach Ablauf des Furchungsprozesses
zu einem völlig reifen Embryo sich umgebildet hat.
Was den anatomischen Aufbau des Distomum macrostomum, sowie die Configuration seiner Organsysteme
anbetrifft, • so schliesst es sich in Bezug auf diese, bis auf wenige Abweichungen ganz dem Bauplan
an, wie wir ihn von der Mehrzahl der Distomen kennen, so dass mir nur wenig hinzuzufügen bleibt.
Der ausgebildete Wurm wechselt in seiner Grösse nicht unbedeutend, da er auch nach Eintritt der
Geschlechtsreife, jedenfalls infolge der bedeutenden Füllung des Uterus mit Eiern, noch reichlich wächst.
Ein 20 Tage altes Tier mass nach der Conservierung ungefähr 1,8 mm in der Länge, 0,8 mm in der Breite
und 0,45 mm in der Dicke; es ist ohne weiteres einleuchtend, dass diese Maasse durch Contractionen und
Bewegungen in der verschiedensten und mannigfachsten Weise beim lebenden Tiere modifiziert werden
können. Im Allgemeinen sind aber unsere Würmer bei weitem nicht so beweglich, wie dies von anderen
Trematodenformen bekannt ist.
Als unter allen Umständen charakteristisch für unseren Wurm können zwei Eigentümlichkeiten angeführt
werden; es sind dies einmal die Bildung des Kopfendes, und dann die Lage der Geschlechtsöffnung.
Was zunächst das Kopfende anbelangt, so erscheint dieses, wie schon Zeller2) angibt, in der Seitenlage
wie schief ab geschnitten, freilich nicht lediglich infolge des von Zeller angegebenen Umstandes, dass
die Körperbedeckung auf der Rückenseite kragenartig über den Mundsaugnapf emporgezogen erscheint
Der Hauptgrund dieser Eigentümlichkeit dürfte meiner Ansicht nach bei weitem mehr in der Thatsache
liegen, dass auch die dorsale Wand des Mundsaugnapfes viel länger ist, als die ventrale (0,35:0,28 mm)3),
und dass schon durch diesen Umstand die Öffnung des Mundsaugnapfes eine ziemlich starke Neigung nach
der Bauchfläche zu erfährt, welche in der Seitenansicht die bereits erwähnte Eigentümlichkeit hervorruft.
Es scheint ausserdem diese Eigentümlichkeit nicht ohne Nutzen und praktischen Wert für unseren Wurm
1- c. pag. 572.
*) 1. c. pag. 568.
8) Auch bei anderen Allen walten ähnliche Verhältnisse ob. (Distomum hepaticum u. s. w.)