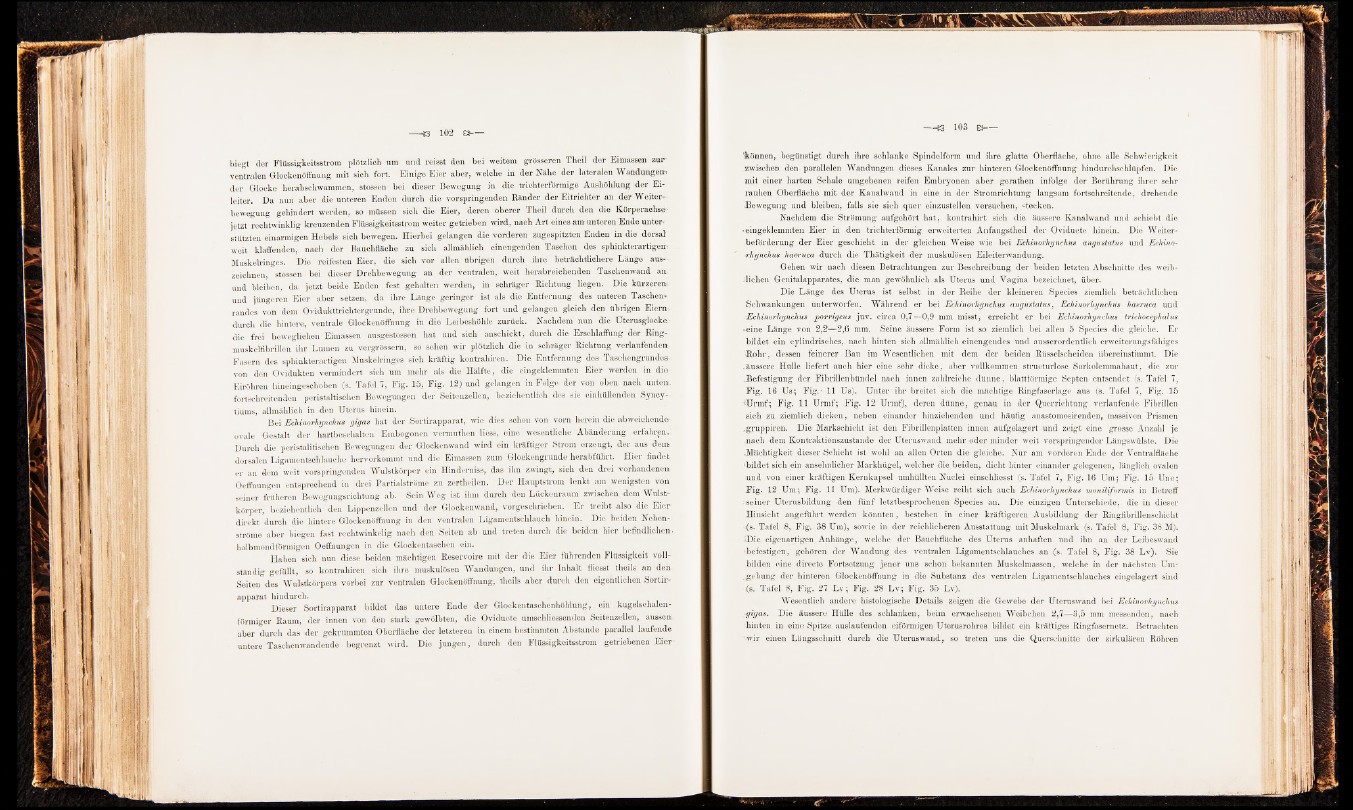
biegt der Flttssigkeitsstrom plötzlich um und reisst den bei weitem grösseren Theil der Eimassen -zar-
ventralen Glockenöffiiung mit sieh fort. Einige Eier aber, welche in der Nähe der lateralen Wandnngem
der Glocke herabschwammen, stossen bei dieser Bewegung in die trichterförmige Aushöhlung der Eileiter.
Da nun aber die unteren Enden durch die vorspringenden Bänder der Eitriehter an der Weiterbewegung
gehindert werden, so müssen sieh die Eier, deren oberer Theil durch den die Körperachse-
jetzt rechtwinklig kreuzenden Flüssigkeitsstrom weiter getrieben wird, nach Art eines am unteren Ende unterstützten
einarmigen Hebels sich bewegen. Hierbei gelangen die vorderen zugespitzten Enden in die dorsal
weit klaffenden, nach der Bauchfläche zu sich allmählich einengendeSJ Taschen des sphinkterartigem
Muskelringes. Die reifesten Eier, die sich vor allen übrigen durch ihre beträchtlichere Länge auszeichnen,
stossen bei dieser Drehbewegung an der ventralen, weit herabreichenden Taschenwand an,
und bleiben, da jetzt beide Enden fest gehalten werden, in schräger Richtung liegen. Die kürzerem
und jüngeren Eier aber setzen, da ihre Länge geringer ist als die Entflijimng des unteren Tasehenr
randes von dem Ovidukttrichtergrunde, ihre Drehbewegung fort und gelangen gleich den übrigen Eiern«
durch die hintere, ventrale Glodkenöffnung in die Leibeshöhle zurück. Nachdem nun dii'SJterusglocke-
die frei beweglichen Eimassen ausgestossen hat und sich ansShSckt, durch die Erschlaffung der Ringmuskelfibrillen
ihr. Lumen zu vergrössem, so sehen wir plötzlich die in schräger Richtung verlaufenden.
Fasern des sphinkterartigen Muskelringes sich kräftig kontrahiren. Die Entfernung des Taschengrnndes
von den Ovidukten vermindert sieh um mehr als die Hälfte, diiSungeklemmten Eier werden in die
Eiröhren hineingesehöben (s. Tafel 7, Fig. 15, Fig. 12) und gelangen in Folge der von oben nach unten,
fortschreitenden peristaltischen Bewegungen der Seitenzellen, beziehentlich des sie einhüllenden Syncy-
tiums, allmählich in den Uterus hinein.
Bei Edtinorhynckus gigas hat der Sortirapparat, wie dies schön von vorn herein die abweichende,
ovale Gestalt der hartbeschalten Embogonen vermuthen liess, eine wesentliche- Abänderung erfahren...
Durch die peristalitischen Bewegungen der Glocken wand wird ein kräftiger Strom erzeüft; der atffl dem
dorsalen Ligamentschlauche hervorkommt und die Eimassen zum Glockengrunde herabführt. Hier findet
er an dem weit vorspringenden Wulstkörper ein Hinderniss, das ihn zwingt, sich den drei vorhandenen,
Oeflhungen entsprechend in drei Partialströme zu zertheilen. Der Hauptstrom lenkt am wenigsten von
seiner früheren Bewegungsriehtung ab. Sein Weg ist ihnt durch den Lückenraum zwischen dem Wulstkörper)
beziehentlich den Lippenzellen und der Glockenwand, vorgeschrieben. Er treibt also die Eier
direkt durch die hintere Glockenöffnung in den ventralen Ligamentschlauch hinein. Die beiden Neben--
ströme aber biegen fast rechtwinkelig nach den Seiten ab und treten durch die beiden hier befindlichen,
halbmondförmigen Oeffnungen in die Gloekentaschen ein.
Haben sich nun diese beiden mächtigen Reservoire mit der die Eier führenden Flüssigkeit vollständig
gefüllt, so kontrahiren sich ihre muskulösen Wandungen, und ihr Inhalt fliesst theils an den,
Seiten des Wulstkörpers vorbei zur ventralen Glockenöffnung, theils aber durch den eigentlichen Sortirapparat
hindurch.
Dieser Sortirapparat bildet das untere Ende der Gloekentasehenhöblungy^ ein kugelschalenförmiger
Raum, der innen von den stark gewölbten, die Oviducte umschliessenden Seitfazellen, aussen
aber durch das der gekrümmten Oberfläche der letzteren in einem bestimmten Abstande parallel' laufende
untere Taschenwandende begrenzt wird. Die jungen, durch den Flussigkeitsstrom getriebenen Eier
Ikönnen, begünstigt durch ihre schlanke Spindelform und ihre glatte Oberfläche, ohne alle Schwierigkeit
.zwischen den parallelen Wandungen dieses Kanales zur hinteren Glockenöffnung hindurchschlüpfen. Die
mit einer harten Schale umgebenen reifen Embryonen aber gerathen infolge der Berührung ihrer sehr
rauhen Oberfläche mit der Kanalwand in eine in der Stromrichtung langsam fortschreitende, drehende
Bewegung und bleiben, falls sie sich quer einzustellen versuchen, *tecken.
Nachdem die Strömung aufgehört hat, kontrahirt sich die äussere Kanalwand und schiebt die
■eingeklemmten Eier in den trichterförmig erweiterten Anfangstheil der Oviducte hinein. Die Weiterbeförderung
der Eier geschieht in der gleichen Weise wie bei Eckinorhynchus angustatus und Echino-
■rhynchus haeruca durch die Thätigkeit der muskulösen Eileiterwandung.
Gehen wir nach diesen Betrachtungen zur Beschreibung der beiden letzten Abschnitte des weiblichen
Genitalapparates, die man gewöhnlich als Uterus und Vagina bezeichnet, über.
Die Länge des Uterus ist selbst in der Reihe der kleineren Species ziemlich beträchtlichen
Schwankungen unterworfen. Während er bei Eckinorhynchus angustatus, Echinorhynclius haeruca und
cEchinorhynchus porrigeus juv. circa 0,7 —0,9 mm misst, erreicht er bei Eckinorhynchus trichocephalus
•eine Länge von 2,2—2,6 mm. Seine äussere Form ist so ziemlich bei allen 5 Species die gleiche. Er
bildet ein cylindrisches, nach hinten sich allmählich einengendes und ausserordentlich erweiterungsfähiges
'Rohr, dessen feinerer Bau im Wesentlichen mit dem der beiden Rüsselscheiden übereinstimmt. Die
-äussere Hülle liefert auch hier eine sehr dicke, aber vollkommen structurlose Sarkolemmahaut, die zur
Befestigung der Fibrillenbündel nach innen zahlreiche dünne, blattförmige Septen entsendet (s. Tafel 7,
Fig. 16 Us; Fig." 11 Us). Unter ihr breitet sich die mächtige Ringfaserlage aus (s. Tafel 7, Fig. 15
i.Urmf; Fig. 11 Urmf; Fig. 12 Urmf), deren dünne, genau in der Querrichtung verlaufende Fibrillen
sich zu ziemlich dicken, neben einander hinziehenden und häufig anastomosirenden, massiven Prismen
.gruppiren. Die Markschicht ist den Fibrillenplatten innen aufgelagert und zeigt eine grosse Anzahl je
.nach dem Kontraktionszustande der Uteruswand mehr oder minder weit vorspringender Längswülste. Die
-Mächtigkeit dieser Schicht ist wohl an allen Orten die gleiche. Nur am vorderen Ende der Ventralfläche
'bildet sich ein ansehnlicher Markhügel, welcher die beiden, dicht hinter einander gelegenen, länglich ovalen
und von einer kräftigen Kernkapsel umhüllten Nuclei einschliesst (s. Tafel 7, Fig. 16 Um; Fig. 15 Unc;
Fig. 12 Um; Fig. 11 Um). Merkwürdiger Weise reiht sich auch Eckinorhynchus moniliformis in Betreff
¡seiner Uterusbildung den fünf letztbesprochenen Species an. Die einzigen Unterschiede, die in dieser
Hinsicht angeführt werden könnten, bestehen in einer kräftigeren Ausbildung der Ringfibrillenschicht
■•(s. Tafel 8, Fig. 38 Um), sowie in der reichlicheren Ausstattung mit Muskelmark (s. Tafel 8, Fig. 38 M).
.¡Die eigenartigen Anhänge, welche der Bauchfläche des Uterus anhaften und ihn an der Leibeswand
befestigen, gehören der Wandung des ventralen Ligamentschlauches an (s. Tafel 8, Fig. 38 Lv). Sie
bilden eine directe Fortsetzung jener uns schon bekannten Muskelmassen, welche in der nächsten Umgebung
der hinteren Glockenöffnung in die Substanz des ventralen Ligamentschlauches eingelagert sind
<s. Tafel 8, Fig. 27 L v ; Fig. 28 Lv; Fig. 35 Lv).
Wesentlich andere histologische Details zeigen die Gewebe der Uteruswand bei Echinorhynclius
■gigas. Die äussere Hülle des schlanken, beim erwachsenen Weibchen 2,7—3,5 mm messenden, nach
¡•hinten in eine Spitze auslaufenden eiförmigen Uterusrohres bildet ein kräftiges Ringfasernetz. Betrachten
’•wir einen Längsschnitt durch die Uteruswand, so treten uns die Querschnitte der zirkulären Röhren