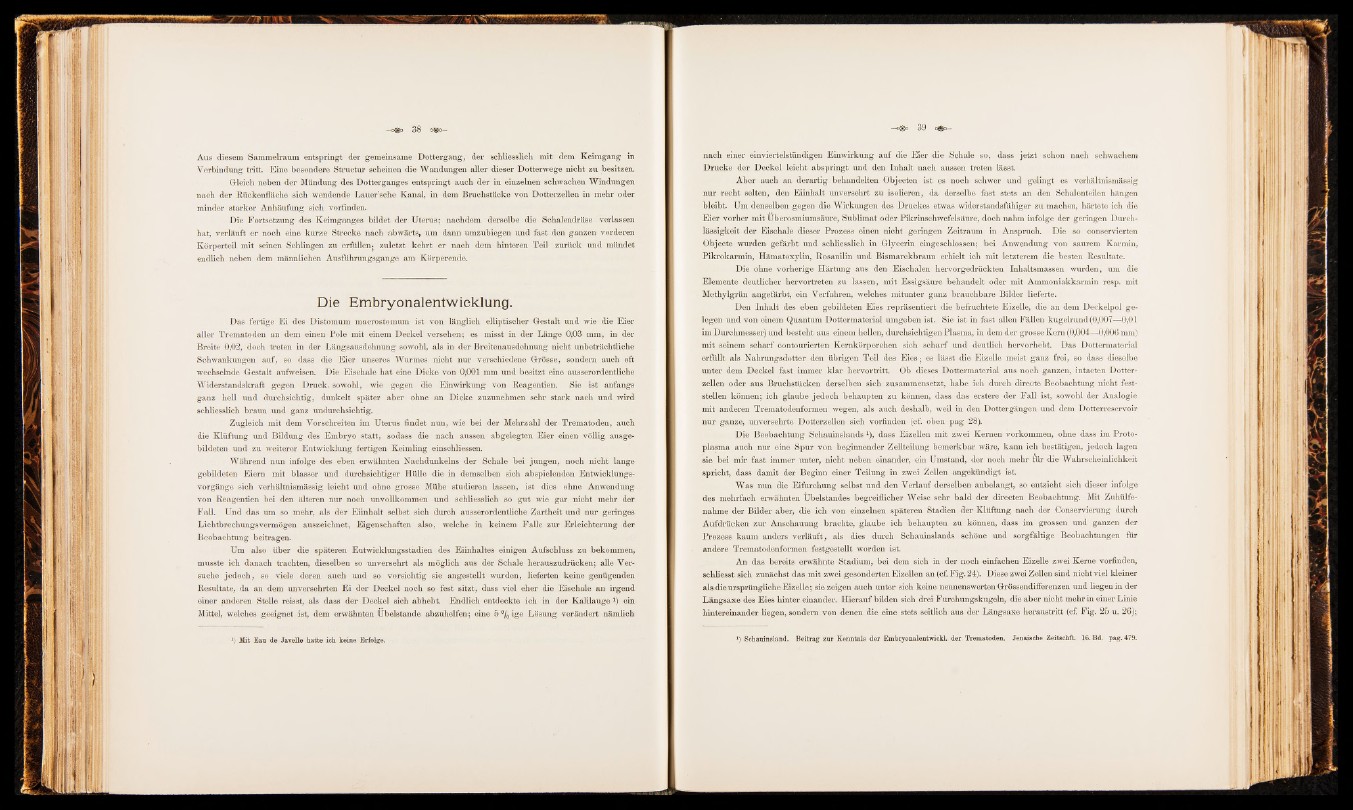
Aus diesem Sammelraum entspringt der gemeinsame Dottergang, der schliesslich mit dem Keimgang in
Verbindung tritt. Eine besondere Structur scheinen die Wandungen aller dieser Dotterwege nicht zu besitzen.
Gleich neben der Mündung des Dotterganges entspringt auch der in einzelnen schwachen Windungen
nach der Rückenfläche sich wendende Lauer’sche Kanal, in dem Bruchstücke von Dotterzellen in mehr oder
minder starker Anhäufung sich vorfinden.
Die Fortsetzung des Keimganges bildet der Uterus; nachdem derselbe die Schalendrüse verlassen
hat, verläuft er noch eine kurze Strecke nach abwärts, um dann umzubiegen und fast den ganzen vorderen
Körperteil mit seinen Schlingen zu erfüllen, zuletzt kehrt er nach dem hinteren Teil zurück und mündet
endlich neben dem männlichen Ausführungsgange am Körperende.
Die Embryonalentwieklung.
Das fertige Ei des Distomum macrostomum ist von länglich elliptischer Gestalt und wie die Eier
aller Trematoden an dem einen Pole mit einem Deckel versehen; es misst in der Länge 0,03 mm, in der
Breite 0,02, doch treten in der Längsausdehnung sowohl, als in der Breitenausdehnung nicht unbeträchtliche
Schwankungen auf, so dass die Eier unseres Wurmes nicht nur verschiedene Grösse, sondern auch oft
wechselnde Gestalt aufweisen. Die Eischale hat eine Dicke von 0,001 mm und besitzt eine ausserordentliche
Widerstandskraft gegen Druck, sowohl, wie gegen die Einwirkung von Reagentien. Sie ist anfangs
ganz hell und durchsichtig, dunkelt später aber ohne an Dicke zuzunehmen sehr stark nach und wird
schliesslich braun und ganz undurchsichtig.
Zugleich mit dem Vorschreiten im Uterus findet nun, wie bei der Mehrzahl der Trematoden, auch
die Klüftung und Bildung des Embryo statt, sodass die nach aussen abgelegten Eier einen völlig ausgebildeten
und zu weiterer Entwicklung fertigen Keimling einschliessen.
Während nun infolge des eben erwähnten Nachdunkeins der Schale bei jungen, noch nicht lange
gebildeten Eiern mit blasser und durchsichtiger Hülle die in demselben sich abspielenden Entwicklungsvorgänge
sich verhältnismässig leicht und ohne grosse Mühe studieren lassen, ist dies ohne Anwendung
von Reagentien bei den älteren nur noch unvollkommen und schliesslich so gut wie gar nicht mehr der
Fall. Und das um so mehr, als der Eiinhalt selbst sich durch ausserordentliche Zartheit und nur geringes
Lichtbrechungsvermögen auszeichnet, Eigenschaften also, welche in keinem Falle zur Erleichterung der
Beobachtung beitragen.
Um also über die späteren Entwicklungsstadien des Eiinhaltes einigen Aufschluss zu bekommen,
musste ich danach trachten, dieselben so unversehrt als möglich aus der Schale herauszudrücken; alle Versuche
jedoch, so viele deren auch und so vorsichtig sie angestellt wurden, lieferten keine genügenden
Resultate, da an dem unversehrten Ei der Deckel noch so fest sitzt, dass viel eher die Eischale an irgend
einer anderen Stelle reisst, als dass der Deckel sich abhebt. Endlich entdeckte ich in der Kalilauge *) ein
Mittel, welches geeignet ist, dem erwähnten Übelstande abzuhelfen; eine 5 e/0 ige Lösung verändert nämlich
>) Mit Eau de Javelle hatte ich keine Erfolge.
nach einer ein viertelstündigen Einwirkung auf die Eier die Schale so, dass jetzt schon nach schwachem
Drucke der Deckel leicht abspringt und den Inhalt nach aussen treten lässt.
Aber auch an derartig behandelten Objecten ist es noch schwer und gelingt es verhältnismässig
nur recht selten, den Eiinhalt unversehrt zu isolieren, da derselbe fast stets an den Schalenteilen hängen
bleibt. Um denselben gegen die Wirkungen des Druckes etwas widerstandsfähiger zu machen, härtete ich die
Eier vorher mit Überosmiumsäure, Sublimat oder Pikrinschwefelsäure, doch nahm infolge der geringen Durchlässigkeit
der Eischale dieser Prozess einen nicht geringen Zeitraum in Anspruch. Die so conservierten
Objecte wurden gefärbt und schliesslich in Glycerin eingeschlossen; bei Anwendung von saurem Karmin,
Pikrokarmin, Hämatoxylin, Rosanilin und Bismarckbraun erhielt ich mit letzterem die besten Resultate.
Die. ohne vorherige Härtung aus den Eischalen hervorgedrückten Inhaltsmassen wurden, um die
Elemente deutlicher hervortreten zu lassen, mit Essigsäure behandelt oder mit Ammoniakkarmin resp. mit
Methylgrün angefärbt, ein Verfahren, welches mitunter ganz brauchbare Bilder lieferte.
Den Inhalt des eben gebildeten Eies repräsentiert die befruchtete Eizelle, die an dem Deckelpol gelegen
und von einem Quantum Dottermaterial umgeben ist. Sie ist in fast allen Fällen kugelrund (0,007—0,01
im Durchmesser) und besteht aus einem hellen, durchsichtigen Plasma, in dem der grosse Kern (0,004—0,006 mm)
mit seinem scharf contourierten Kemkörperchen sich scharf und deutlich hervorhebt. Das Dottermaterial
erfüllt als Nahrungsdotter den übrigen Teil des Eies • es lässt die Eizelle meist ganz frei, so dass dieselbe
unter dem Deckel fast immer klar hervortritt. Ob dieses Dottermaterial aus noch ganzen, intacten Dotterzellen
oder aus Bruchstücken derselben sich zusammensetzt, habe ich durch directe Beobachtung nicht feststellen
können; ich glaube jedoch behaupten zu können, dass das erstere der Fall ist, sowohl der Analogie
mit anderen Trematodenformen wegen, als auch deshalb, weil in den Dottergängen und dem Dotterreservoir
nur ganze, unversehrte Dötterzellen sich vorfinden (cf. oben pag 28).
Die Beobachtung Schauinslands x), dass Eizellen mit zwei Kernen Vorkommen, ohne dass im Protoplasma
auch nur eine Spur von beginnender Zellteilung bemerkbar wäre, kann ich bestätigen, jedoch lagen
sie bei mir fast immer unter, nicht neben einander, ein Umstand, der noch mehr für die Wahrscheinlichkeit
spricht, dass damit der Beginn einer Teilung in zwei Zellen angekündigt ist.
Was nun die Eifurchung selbst und den Verlauf derselben anbelangt, so entzieht sich dieser infolge
des mehrfach erwähnten Übelstandes begreiflicher Weise sehr bald der directen Beobachtung. Mit Zuhülfe-
nahme der Bilder aber, die ich von einzelnen späteren Stadien der Klüftung nach der Conservierung durch
Aufdrücken zur Anschauung brachte, glaube ich behaupten zu können, dass im grossen und ganzen der
Prozess kaum anders verläuft, als dies durch Schauinslands schöne und sorgfältige Beobachtungen für
andere Trematodenformen festgestellt worden ist.
An das bereits erwähnte Stadium, bei dem sich in der noch einfachen Eizelle zwei Kerne vorfinden,
schliesst sich zunächst das mit zwei gesonderten Eizellen an (cf. Fig. 24). Diese zwei Zellen sind nicht viel kleiner
als die ursprüngliche Eizelle; siezeigen auch unter sich keine nennenswerten Grössendifferenzen und liegen in der
Längsaxe des Eies hinter einander. Hierauf bilden sich drei Furchungskugeln, die aber nicht mehr in einer Linie
hintereinander liegen, sondern von denen die eine stets seitlich aus der Längsaxe heraustritt (cf. Fig. 25 u. 26);
i) Schauinsland. Beitrag zur Kenntnis der Embryonalentwickl. der Trematoden. Jenaische Zeitschft. 16. Bd. pag. 479.