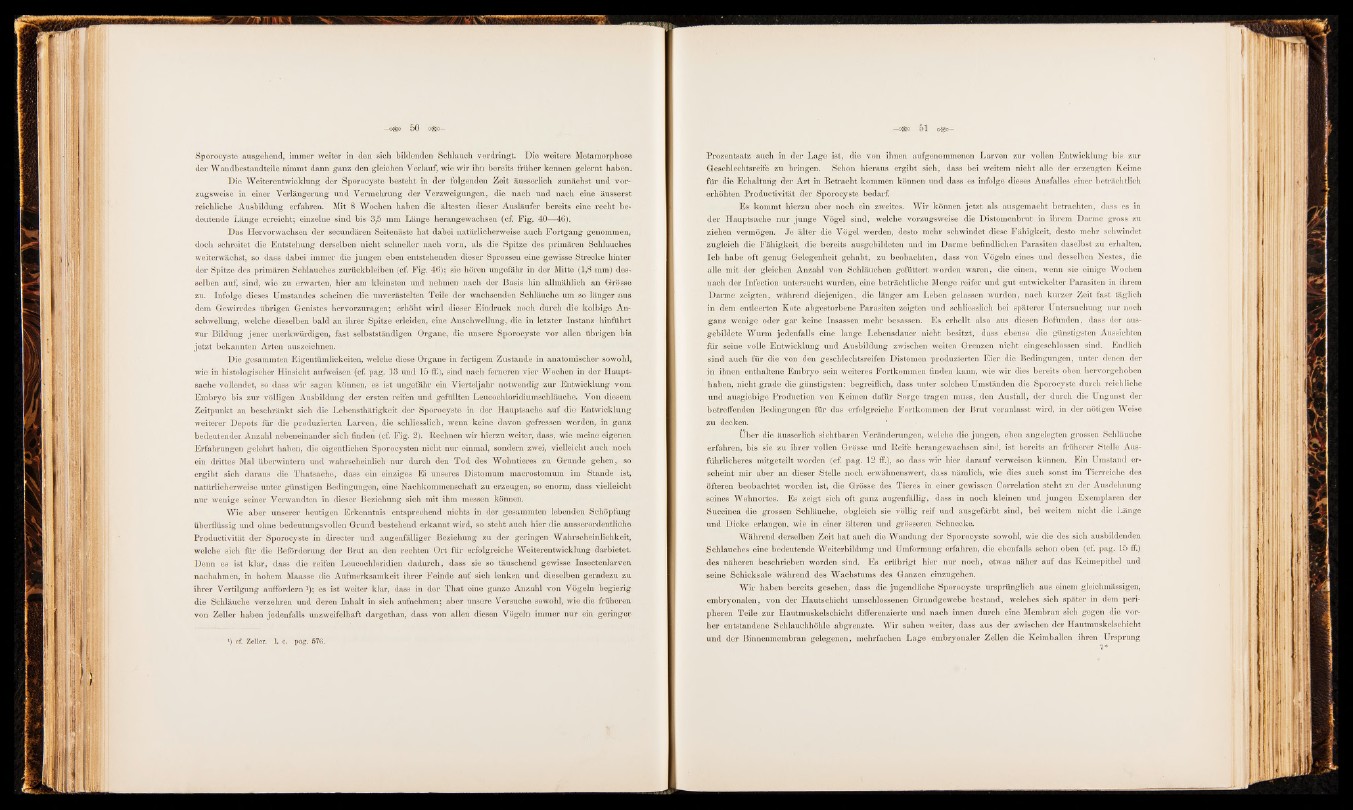
Sporocyste ausgehend, immer weiter in den sich bildenden Schlauch vordringt. Die weitere Metamorphose
der Wandbestandteile nimmt dann ganz den gleichen Verlauf, wie wir ihn bereits früher kennen gelernt haben.
Die Weiterentwicklung der Sporocyste besteht in der folgenden Zeit äusserlich zunächst und vorzugsweise
in einer Verlängerung und Vermehrung der Verzweigungen, die nach und nach eine äusserst
reichliche Ausbildung erfahren. Mit 8 Wochen haben die ältesten dieser Ausläufer bereits eine recht bedeutende
Länge erreicht; einzelne sind bis 8,5 mm Länge herangewachsen (cf. Fig. 40—46).
Das Hervorwachsen der secundären Seitenäste hat dabei natürlicherweise auch Fortgang genommen,
doch schreitet die Entstehung derselben nicht schneller nach vorn, als die Spitze des primären Schlauches
weiterwächst, so dass dabei immer die jungen eben entstehenden dieser Sprossen eine gewisse Strecke hinter
der Spitze des primären Schlauches Zurückbleiben (cf. Fig. 46); sie hören ungefähr in der Mitte (1,8 mm) desselben
auf, sind, wie zu erwarten, hier am kleinsten und nehmen nach der Basis hin allmählich an Grösse
zu. Infolge dieses Umstandes scheinen die unverästelten Teile der wachsenden Schläuche um so länger aus
dem Gewirrdes übrigen Genistes hervorzuragen; erhöht wird dieser Eindruck noch durch die kolbige Anschwellung,
welche dieselben bald an ihrer Spitze erleiden, eine Anschwellung, die in letzter Instanz hinführt
zur Bildung jener merkwürdigen, fast selbstständigen Organe, die unsere Sporocyste vor allen übrigen bis
jetzt bekannten Arten auszeichnen.
Die gesammten Eigentümlickeiten, welche diese Organe in fertigem Zustande in anatomischer sowohl,,
wie in histologischer Hinsicht aufweisen (cf. pag. 13 und 15 ff.), sind nach ferneren vier Wochen in der Hauptsache
vollendet, so dass wir sagen können, es ist ungefähr ein Vierteljahr notwendig zur Entwicklung vom
Embryo bis zur völligen Ausbildung der ersten reifen und gefüllten Leucochloridiumschläuche. Von diesem
Zeitpunkt an beschränkt sich die Lebensthätigkeit der Sporocyste in der Hauptsache auf die Entwicklung
weiterer Depots für die produzierten Larven, die schliesslich, wenn keine davon gefressen werden, in ganz,
bedeutender. Anzahl nebeneinander sich finden (cf. Fig. 2). Rechnen wir hierzu weiter, dass, wie meine eigenen
Erfahrungen gelehrt haben, die eigentlichen Sporocysten nicht nur einmal, sondern zwei, vielleicht auch noch
ein drittes Mal überwintern und wahrscheinlich nur durch den Tod des Wohntieres zu Grunde gehen, so
ergibt sich daraus die Thatsache, dass ein einziges Ei unseres Distomum macrostomum im Stande ist,
natürlicherweise unter günstigen Bedingungen, eine Nachkommenschaft zu erzeugen, so enorm, dass vielleicht
nur wenige seiner Verwandten in dieser Beziehung sich mit ihm messen können.
Wie aber unserer heutigen Erkenntnis entsprechend nichts in der gesammten lebenden Schöpfung
überflüssig und ohne bedeutungsvollen Grund bestehend erkannt wird, so steht auch hier die ausserordentliche
Productivität der Sporocyste in directer und augenfälliger Beziehung zu der geringen Wahrscheinlichkeit,
welche sich für die Beförderung der Brut an den rechten Ort für erfolgreiche Weiterentwicklung darbietet.
Denn es ist klar, dass die reifen Leucochloridien dadurch, dass sie so täuschend gewisse Insectenlarven-
nachahmen, in hohem Maasse die Aufmerksamkeit ihrer Feinde auf sich lenken und dieselben geradezu zu
ihrer Vertilgung auffordern1); es ist weiter klar, dass in der That eine ganze Anzahl von Vögeln begierig
die Schläuche verzehren und deren Inhalt in sich aufnehmen; aber unsere Versuche sowohl, wie die früheren
von Zeller haben jedenfalls unzweifelhaft dargethan, dass von allen diesen Vögeln immer nur ein geringe^
Prozentsatz auch in der Lage ist, die von ihnen aufgenommenen Larven zur vollen Entwicklung bis zur
Geschlechtsreife zu bringen. Schon hieraus ergibt sich, dass bei weitem nicht alle der erzeugten Keime
für die Erhaltung der Art in Betracht kommen können und dass es infolge dieses Ausfalles einer beträchtlich
erhöhten Productivität der Sporocyste bedarf.
Es kommt hierzu aber noch ein zweites. Wir können jetzt als ausgemacht betrachten, dass es in
der Hauptsache nur junge Vögel sind, welche vorzugsweise die Distomenbrut in ihrem Darme gross zu
ziehen vermögen. Je älter die Vögel werden, desto mehr schwindet diese Fähigkeit, desto mehr schwindet
zugleich die Fähigkeit, die bereits ausgebildeten und im Darme befindlichen Parasiten daselbst zu erhalten.
Ich habe oft genug Gelegenheit gehabt, zu beobachten, dass von Vögeln eines und desselben Nestes, die
alle mit der gleichen Anzahl von Schläuchen gefüttert worden waren, die einen, wenn sie einige Wochen
nach der Infection untersucht wurden, eine beträchtliche Menge reifer und gut entwickelter Parasiten in ihrem
Darme zeigten, während diejenigen, die länger am Leben gelassen wurden, nach kurzer Zeit fast täglich
in dem entleerten Kote abgestorbene Parasiten zeigten und schliesslich bei späterer Untersuchung nur noch
ganz wenige oder gar keine Insassen mehr besassen. Es erhellt also aus diesen Befunden, dass der ausgebildete
Wurm jedenfalls eine lange Lebensdauer nicht besitzt, dass ebenso die günstigsten Aussichten
für seine volle Entwicklung und Ausbildung zwischen weiten Grenzen nicht eingeschlossen sind. Endlich
sind auch für die von den geschlechtsreifen Distomen produzierten Eier die Bedingungen, unter denen der
in ihnen enthaltene Embryo sein weiteres Fortkommen finden kann, wie wir dies bereits oben hervorgehoben
haben, nicht grade die günstigsten: begreiflich, dass unter solchen Umständen die Sporocyste durch reichliche
und ausgiebige Production von Keimen dafür Sorge tragen muss, den Ausfall, der durch die Ungunst der
betreffenden Bedingungen für das erfolgreiche Fortkommen der Brut veranlasst wird, in der nötigen Weise
zu decken.
Über die äusserlich sichtbaren Veränderungen, welche die jungen, eben angelegten grossen Schläuche
erfahren, bis sie zu ihrer vollen Grösse und Reife herangewachsen sind, ist bereits an früherer Stelle Ausführlicheres
mitgeteilt worden (cf. pag. 12 ff.), so dass wir hier darauf verweisen können. Ein Umstand er»
scheint mir aber an dieser Stelle noch erwähnenswert, dass nämlich, wie dies auch sonst im Tierreiche des
öfteren beobachtet worden ist, die Grösse des Tieres in einer gewissen Correlation steht zu der Ausdehnung
seines Wohnortes. Es zeigt sich oft ganz augenfällig, dass in noch kleinen und jungen Exemplaren der
Succinea die grossen Schläuche, obgleich sie völlig reif und ausgefärbt sind, bei weitem nicht die Länge
und Dicke erlangen, wie in einer älteren und grösseren Schnecke.
Während derselben Zeit hat auch die Wandung der Sporocyste sowohl, wie die des sich ausbildenden
Schlauches eine bedeutende Weiterbildung und Umformung erfahren, die ebenfalls schon oben (cf. pag. 15 ff.)
des näheren beschrieben worden sind. Es erübrigt hier nur noch, etwas näher auf das Keimepithel und
seine Schicksale während des Wachstums des Ganzen einzugehen.
Wir haben bereits gesehen, dass die jugendliche Sporocyste ursprünglich aus einem gleichmässigen,
embryonalen, von der Hautschicht umschlossenen Grundgewebe bestand, welches sich später in dem peripheren
Teile zur Hautmuskelschicht differenzierte und nach innen durch eine Membran sich gegen die vorher
entstandene Schlauchhöhle abgrenzte. Wir sahen weiter, dass aus der zwischen der Hautmuskelschicht
und der Binnenmembran gelegenen, mehrfachen Lage embryonaler Zellen die Keimballen ihren Ursprung