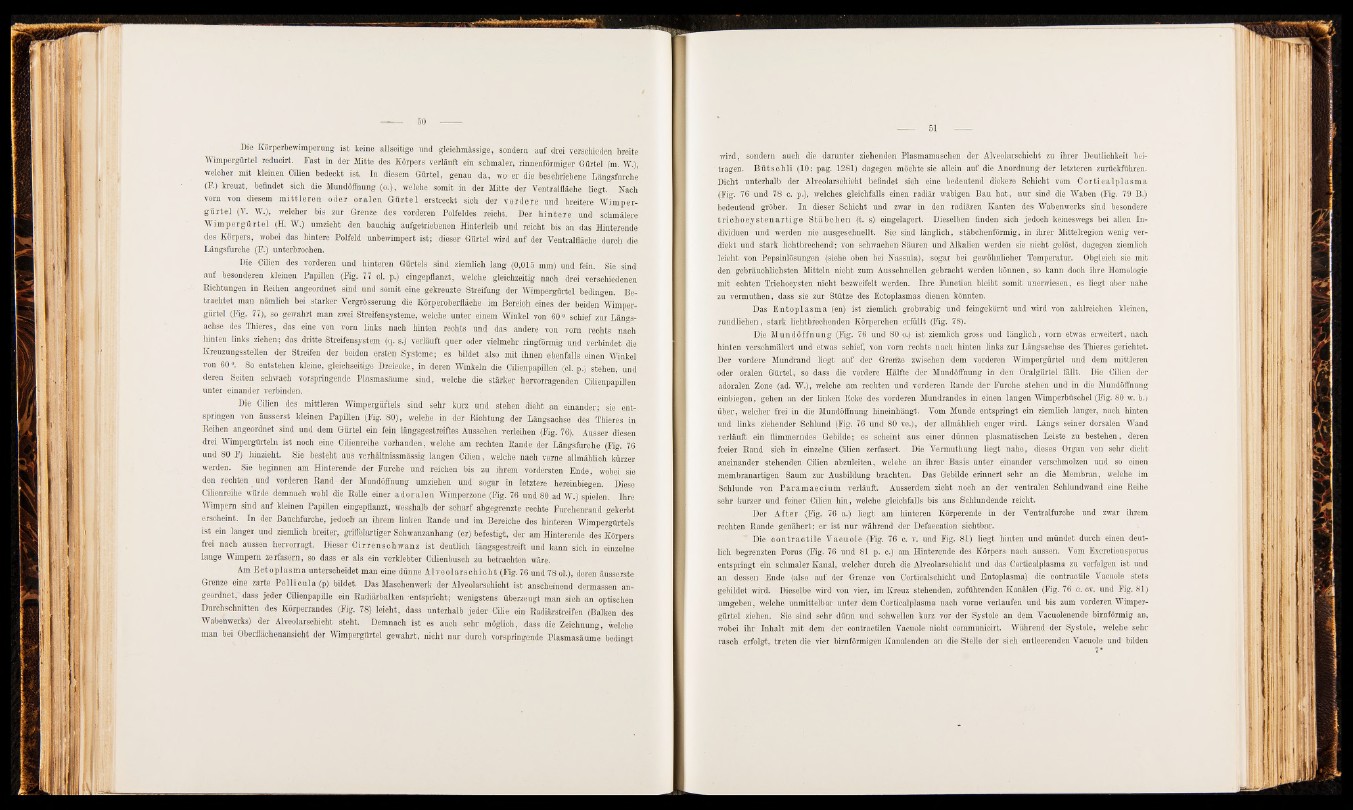
Die Körperbewimperung ist keine allseitige und gleichmässige, sondern auf drei verschieden breite
Wimpergürtel rednoirt. Fast in der Mitte des Körpers verläuft ein sehmaler, rinnenförmiger Gürtel (m. W.),
welcher mit kleinen Cilien bedeckt ist.: In diesem Gürtel, genau da, wo> er die beschrieben®. Längsfurche
(F.) kreuzt, befindet sich die Mundöffnung (C.), welche somit in der Mitte der Ventralfläche liegt. Nach
vorn von diesem mittleren ,/o d e r oralen G ü rte l erstreckt sich der vordere und breitere 'Wimperg
ü rte l (V. W B welcher bis zur Grenze des vorderen Pölfeldes reicht. Der h in te re und sphfn.älere
W im p e rg ü rte l (H. W.) umzieht den bauchig aufgetriebenen Hinterleib und reicht bis an das Hinterenda
des Körpers, wobei das hintere Polfeld unbewimpert' ist? .dieser Gürtel wird auf der Ventralfläche darob .die
Längsfurche (F.) unterbrochen.
Die Cilien des vorderen und hinteren Gürtels sind ziemlich lang (0,015 mm) und fein. Sie sind
auf besonderen kleinen Papillen (Fig. 77 cl, p.) eingepflanzt, welche gleichzeitig nach drei verschiedenen
Richtungen in Reihen angeordnet sind und somit eine gekreuzte Streifung der Wimpergürtel bedingen. Betrachtet
man nämlich bei starker Vergrösserung die Körperoberfläche im Bereich eines der beiden Wimpergürtel
(Fig. 77), so gewahrt man zwei Streifensysteme, welche unter einem Winkel von 600 schief zur Längsachse
des Thieres, das eine von vorn links nach hinten rechts und das andere von vorn rechts nach
hinten links ziehen; das dritte Streifensystem (cp s.) verläuft quer oder vielmehr ringförmig und verbindet die
Kreuzungsstellen der Streifen der beiden ersten Systeme; es bildet also mit ihnen ebenfalls einen Winkel
von 60°. So entstehen kleine, gleichseitige Dreiecke, in deren Winkeln die Cilienpapillen (cl. p.) stehen, und
deren Seiten schwach vorspringende Plasmasäume sind, welche die stärker hervorragenden Cilienpapillen ■
unter einander verbinden.
Die Cilien des mittleren WimpergürBels sind sehr kurz und stehen dicht an einander,; sie entspringen
von äusserst kleinen Papillen (Fig. 80), welche in der Richtung der Längsachse des Thieres in
Reihen angeordnet sind und dem Gürtel ein fein längsgestreiftes Aussehen verleihen (Fig. 76). Ausser diesen
drei Wimpergürteln ist noch eine Cilienreihe vorhanden, welche am rechten Rande der Längsfurche (Fig. 76
und 80 F) hinzieht. Sie besteht aus verhältnissmässig langen Cilien, welche nach vorne allmählich kürzer
werden. Sie beginnen am Hinterende der Furche und reichen bis zu ihrem vordersten Ende, wobei sie
den rechten und vorderen Rand der Mundöffnung umziehen und sogar in letztere hereinbiegen. Diese
Cilienreihe würde demnach wohl die Rolle einer ado ra len Wimperzone (Fig. 76 und 80 ad W.) spielen. Ihre
Wimpern sind auf kleinen Papillen eingepflanzt, wesshalb der scharf abgegrenzte rechte Furchenrand gekerbt
erscheint. In der Bauchfurche, jedoch an ihrem linken Rande und im Bereiche des hinteren Wimpergürtels
ist ein langer und ziemlich breiter, griffelartiger Schwanzanhang (er) befestigt, der am Hinterende des Körpers
frei nach aussen hervorragt. Dieser Cirrenschwanz ist deutlich längsgestreift und kann sich in einzelne
lange Wimpern zerfasern, so dass er als ein verklebter Cilienbusch zu betrachten wäre.
Am Ectoplasma unterscheidet man eine dünne Alveo la rsch ich t (Fig. 76 und 78 oL), deren äusserste
Grenze eine zarte P e llic u la (p) bildet. Das Maschenwerk der-Alveolarschicht ist anscheinend dermassen angeordnet,
dass jeder Cilienpapille ein Radiärbalken entspricht; wenigstens überzeugt man sich an optischen
Durchschnitten des Körperrandes (Fig. 78) leicht, dass unterhalb jeder Cilie ein Radiärstreifen (Balken des
Wabehwerks) der Alveolarschicht steht. Demnach ist es auch sehr möglich, dass die Zeichnung, welche
man bei Oberflächenansicht der Wimpergürtel gewahrt, nicht nur durch vorspringende Plasmasäume bedingt
wird, sondern auch die darunter ziehenden Plasmamaschen der Alveolarschicht zu ihrer Deutlichkeit beitragen.
B ü tsch li (10; pag. 1281) dagegen möchte sie allein auf die Anordnung der letzteren zurückführen.
Dicht unterhalb der Alveolarschicht befindet sich eine bedeutend dickere Schicht vom C o rtic a lp la sm a
(Fig. 76 und 78 c. p.), welches gleichfalls einen radiär wabigen Bau hat, nur sind die Waben (Fig. 79 B.)
bedeutend gröber. In dieser Schicht und zwar in den radiären Kanten des Wabenwerks sind besondere
trich o c y s te n a rtig e S täbchen (t. s) eingelagert. Dieselben finden sich jedoch keineswegs bei allen Individuen
und werden nie ausgeschnellt. Sie sind länglich, stäbchenförmig, in ihrer Mittelregion wenig verdickt
und stark lichtbrechend; von schwachen Säuren und Alkalien werden sie nicht gelöst, dagegen ziemlich
leicht von Pepsinlösungen (siehe oben hei Nassula), sogar bei gewöhnlicher Temperatur. Obgleich sie mit
den gebräuchlichsten Mitteln nicht zum Ausschnellen gebracht werden können, so kann doch ihre Homologie
mit echten Trichocysten nicht bezweifelt werden. Ihre. Function bleibt somit unerwiesen, es liegt aber nahe
zu vermuthen, dass sie zur Stütze des Ectoplasmas dienen könnten.
Das Entoplasma (en) ist ziemlich grobwabig und feingekörnt und wird von zahlreichen kleinen,
rundlichen, stark lichtbrechenden Körperchen erfüllt (Fig. 78)/
Die Mundöffnung (Fig. 76 und 80 o.) ist ziemlich gross und länglich, vorn etwas erweitert, nach
hinten verschmälert und etwas schief, von vorn rechts nach hinten links zur Längsachse des Thieres gerichtet.
Der vordere Mundrand liegt auf der Grerfze zwischen dem vorderen Wimpergürtel und dem mittleren
oder oralen Gürtel, so dass die vordere Hälfte der Mundöffnung in den Oralgürtel fällt. Die Cilien der
adoralen Zone (ad. W.), welche am rechten und vorderen Rande der Furche stehen und in die Mundöffnung
einbiegen, gehen an der linken Ecke des vorderen Mundrandes in einen langen Wimperbüschel (Fig. 80 w. b.)
über, welcher frei in die Mundöffnung hineinhängt. Vom Munde entspringt ein ziemlich langer, nach hinten
und links ziehender Schlund (Fig. 76 und 80 ve.), der allmählich enger wird. Längs seiner dorsalen Wand
verläuft ein flimmerndes Gebilde; es scheint aus einer dünnen plasmatischen Leiste zu bestehen, deren
freier Rand sich in einzelne Cilien zerfasert. Die Vermuthung liegt nahe, dieses Organ von sehr dicht
aneinander stehenden Cilien abzuleiten, welche an ihrer Basis unter einander verschmolzen und so einen
membranartigen Saum zur Ausbildung brachten. Das Gebilde erinnert sehr an die Membran, welche im
Schlunde von Paramaecium verläuft. Ausserdem' zieht noch an der ventralen Schlundwand eine Reihe
sehr kurzer und feiner Cilien hin, welche gleichfalls bis ans Schlundende reicht.
Der After (Fig. 76 a.) liegt am hinteren Körperende in der Ventralfurche und zwar ihrem
rechten Rande genähert; er ist nur während der Defaecation sichtbar.
Die c o n tra c tile Vacuole (Fig. 76 c. v. und Fig. 81) liegt hinten und mündet durch einen deutlich
begrenzten Poms (Fig. 76 unjl 81 p. c.) am Hinterende des Körpers nach aussen. Vom Exeretiousporus
entspringt ein schmaler Kanal, welcher durch die Alveolarschicht und das Corticalplasma zu verfolgen ist und
an dessen Ende (also auf der Grenze von Corticalschicht und Entoplasma) die contractile Vacuole stets
gebildet wird. Dieselbe wird von vier, im Kreuz stehenden, zuführenden Kanälen (Fig. 76 c. cv. und Fig. 81)
umgeben, welche unmittelbar unter dem Corticalplasma nach vorne verlaufen und bis zum vorderen Wimpergürtel
ziehen. Sie sind sehr dünn und schwellen kurz vor der Systole an dem Vacnolenende bimförmig an,
wobei ihr Inhalt mit dem der contractilen Vacuole nicht communicirt. Während der Systole, welche sehr
rasch erfolgt, treten die vier bimförmigen Kanalenden an die Stelle der sich entleerenden Vacuole und bilden