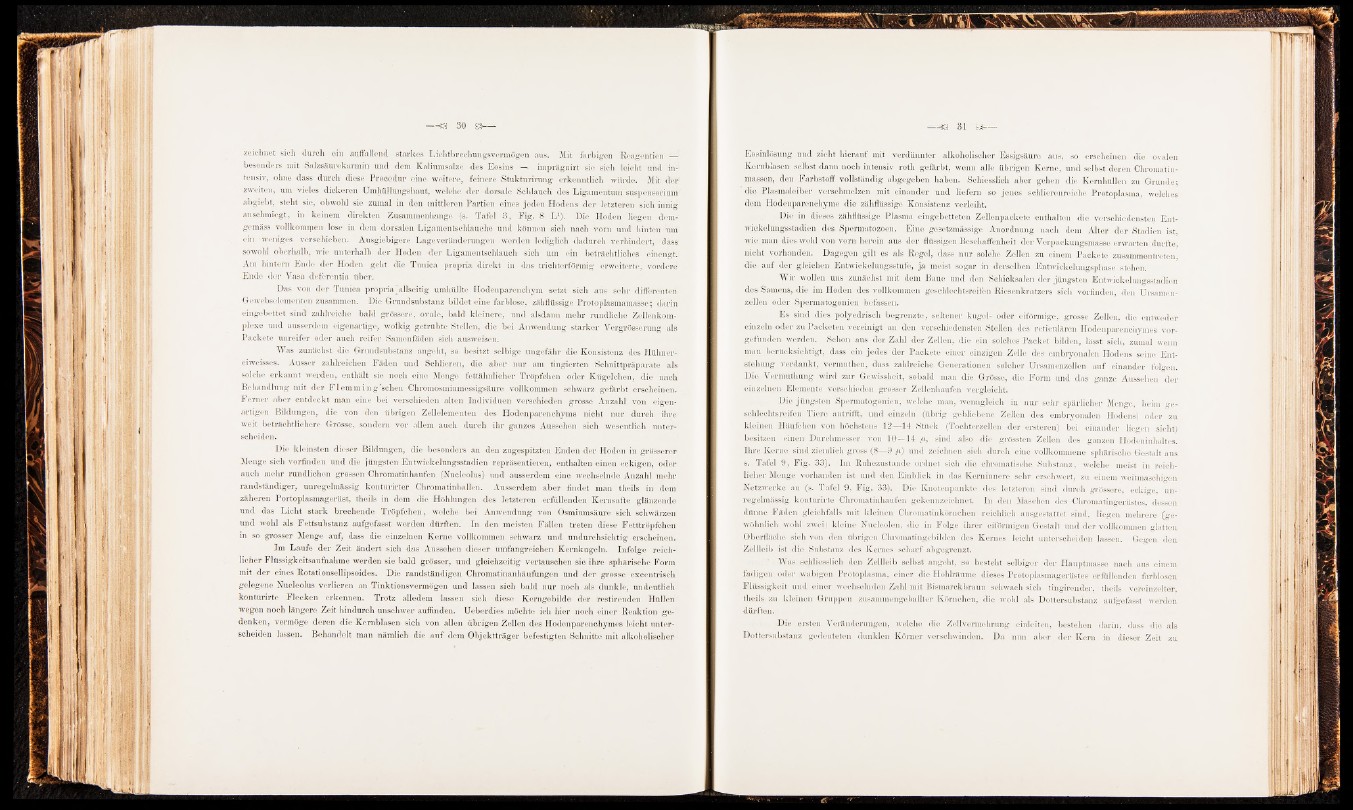
zeichnet sich durch ein auffallend starkes Lichtbrechungsvermögen aus. Mit farbigen Reagentien —
besonders mit Salzsäurekarmin und dem Kaliumsalze des Eosins — . imprägnirt sie sich leicht uhd intensiv,
ohne dass durch diese Procedur eine weitere, feinere Stukturirung erkenntlich würde. Mit der
zweiten, um vieles dickeren Umhüllungshaut, welche der dorsale Schlauch des Ligamentum Suspensorium
abgiebt, steht sie, obwohl sie zumal in den mittleren Partien eines jeden Hodens der letzteren sich innig
anschmiegt, in keinem direkten Zusammen hange (s. Tafel 3, Fig. 8 L1). Die Hoden ' liegen dem-
gemäss vollkommen lose in dem dorsalen Ligamentschlauche und können sich nach vorn und hinten Um
ein weniges verschieben. Ausgiebigere Lage Veränderungen- werden lediglich dadurch verhindert, dasä'_
sowohl oberhalb, wie unterhalb der’ Hoden der Ligamentschlauch sich um ein beträchtliches einengt.
Am hintern Ende der Hoden geht die Tunica propria direkt in das trichterförmig erweiterte, vordere
Ende der Vasa deferentia über.
Das von der Tunica propria ^allseitig umhüllte Hodenparench3’,m setzt sich aus sehr differenten
Gewebselementeil zusammen. Die Grundsubstanz bildet eine farblose, zähflüssige Protoplasmamasse; darin
eingebettet sind zahlreiche bald grössere, ovale, bald kleinere, und alsdann mehr rundliche Zellenkomplexe
und ausserdem eigenartige, wolkig getrübte Stellen, die bei Anwendung starker Vergrösserung als
Packete unreifer oder auch reifer Samenfäden sich ausweisen.
Was zunächst die Grundsubstanz angeht, so besitzt selbige ungefähr die Konsistenz des Hühnerei
weisses. Ausser zahlreichen Fäden und Schlieren, die aber nur am tingierten Schnittpräparate als
solche erkannt werden, enthält sie noch eine Menge fettähnlicher Tröpfchen oder Kügelchen, die nach
Behandlung mit der F lem m in g ’schen Chromosmiumessigsäure vollkommen schwarz gefärbt erscheinen.
Ferner aber entdeckt man eine bei verschieden alten Individuen verschieden grosse Anzahl von eigenartigen
Bildungen, die von den übrigen Zellelementen des Hodenparenchyms nicht nur durch ihre
weit beträchtlichere Grösse, sondern vor allem auch durch ihr ganzes Aussehen sich wesentlich unterscheiden.
Die kleinsten dieser Bildungen, die besonders an den zugespitzten Enden der Hoden in grösserer
Menge sich vorfinden und die jüngsten Entwickelungsstadien repräsentieren, enthalten einen eckigen, oder
auch mehr rundlichen grossen Chromatinhaufen (Nucleolus) und ausserdem eine wechselnde Anzahl mehr
randständiger, unregelmässig konturirter Chromatinballen. Ausserdem aber findet man tlieils in dem
zäheren Portoplasmagerüst, theils in dem die Höhlungen des letzteren erfüllenden Kernsafte glänzende
und das Licht stark brechende Tröpfchen, welche bei Anwendung von Osmiumsäure sich schwärzen
und wohl als Fettsubstanz aufgefasst werden dürften. In den meisten Fällen treten diese Fetttröpfchen
in so grösser Menge auf, dass die einzelnen Kerne vollkommen schwarz und undurchsichtig erscheinen.
Im Laufe der Zeit ändert sich das Aussehen dieser umfangreichen Kernkugeln. Infolge reichlicher
Flüssigkeitsaufnahme werden sie bald grösser, und gleichzeitig vertauschen sie ihre sphärische Form
mit der eines Rotationsellipsoides. Die randständigen Chromatinanhäufungen und der grosse excentrisch
gelegene Nucleolus verlieren an Tinktionsvermögen und lassen sich bald nur noch als dunkle, undeutlich
konturirte Flecken erkennen. Trotz alledem lassen sich diese Kerngebilde der restirenden Hüllen
wegen noch längere Zeit hindurch unschwer auffinden. Ueberdies möchte ich hier noch einer Reaktion gedenken,
vermöge deren die Kernblasen sich von allen übrigen Zellen des Hodenparenchymes leicht unterscheiden
lassen. Behandelt man nämlich die auf dem Objektträger befestigten Schnitte mit alkoholischer
Eosinlösung und zieht hierauf mit verdünnter alkoholischer Essigsäure aus, so erscheinen die ovalen
Kernblasen selbst dann noch intensiv roth gefärbt, wenn alle übrigen Kerne, und selbst deren Chromatin-
massen, den Farbstoff vollständig abgegeben haben. Schiesslich aber gehen die Kernhüllen zu Grunde;
die Plasniiileiber verschmelzen mit einander und liefern so jenes schlierenreiche Protoplasma, welches
dem Hodenparenchyme die zähflüssige Konsistenz verleiht.
Die in dieses zähflüssige Plasma eingebetteten Zellenpackete enthalten die verschiedensten Entwickelungsstadien
des Spermatozoen. Eine gesetzmässige Anordnung nach dem Alter der Stadien ist,
wie man dies wohl von vorn herein aus der flüssigen Beschaffenheit der Verpackungsmasse erwarten durfte
nicht vorhanden. Dagegen gilt es als Regel, dass nur solche Zellen zu einem Packete zusammen treten
die auf der gleichen Entwickelungsstufe, ja meist sogar in derselben Entwickelungsphase stehen.
Wir wollen uns zunächst mit dem Baue und den Schicksalen der jüngsten Entwickelungsstadien
des Samens, die im Hoden des vollkommen geschlechtsreifen Riesenkratzers sich vorfinden, den Ursamen-
zellen oder Spermatogonien befassen.
Es sind dies polyedrisch begrenzte, seltener kugel- öder eiförmige, grosse Zellen, die entweder
einzeln oder zu Paclceten vereinigt an den verschiedensten Stellen des reticulären Hodenparenchymes vorgefunden
werden. Schon aus der Zahl der Zellen, die ein solches Packet bilden, lässt sich, zumal wenn
man berücksichtigt, dass ein jedes der Packete einer einzigen Zelle des embryonalen Hodens seine Entstehung
verdankt, vermuthen, dass zahlreiche- Generationen solcher Ursamenzellen auf einander folgen.
Die Vermuthung wird zur Gewissheit, sobald man die Grösse, die Form und das ganze Aussehen der
einzelnen Elemente verschieden grösser Zellenhaufen vergleicht.
Die jüngsten Spermatogonien, welche man, wenngleich in nur sehr spärlicher Menge, beim geschlechtsreifen
Tiere antrifft, und einzeln (übrig gebliebene Zellen des embryonalen Hodens) oder zu
kleinen Häufchen von höchstens 12—14 Stück (Tochterzeih n der ersteren) bei einander liegen sieht)
besitzen einen Durchmesser von 10 — 14 /.i, sind also die grössten Zellen des ganzen Hodeninhaltes.
Ihre Kerne sind ziemlich gross (8—9 fi) und zeichnen sich durch eine vollkommene sphärische Gestalt aus
s. Tafel 9, Fig. 33). Im Ruhezustände ordnet sich die chromatische Substanz, welche meist in reichlicher
Menge vorhanden ist und den Einblick in das Kerninnere sehr erschwert, zu einem weitmaschigen
Netzwerke an (s. Tafel 9, Fig. 33), Die Knotenpunkte des letzteren sind durch grössere, eckige, unregelmässig
konturirte Chromatinhaufen gekennzeichnet. In den Maschen des Chromatingerüstes dessen
dünne Fäden gleichfalls mit kleinen Chromatinkörnchen reichlich ausgestattet sind, liegen, mehrere (gewöhnlich
wohl zwei) kleine Nucleolen, die in Folge ihrer eiförmigen Gestalt und der vollkommen glatten
Oberfläche sich von den übrigen Chromatingebilden des Kernes Jeicht unterscheiden lassen. Gegen den
Zellleib ist die Substanz des Kernes scharf abgegrenzt.
Was schliesslich den Zellleib selbst angeht, so besteht selbiger der Hauptmasse nach aus einem
fadigen oder wabigen Protoplasma, einer die Hohlräume dieses Protoplasmagerüstes erfüllenden farblosen
Flüssigkeit und einer wechselnden Zahl mit Bismarckbraun schwach sich tingirender, theils vereinzelter,
theils zu kleinen Gruppen zusammengeballter Körnchen,, die wohl als Dottersubstanz aufgefasst werden
dürften.
Die ersten Veränderungen, welche die Zellvermehrung E ilo iten , bestehen darin, dass die als
Dottersubstanz gedeuteten dunklen Körner verschwinden. Da nun aber der Kern in dieser Zeit zu