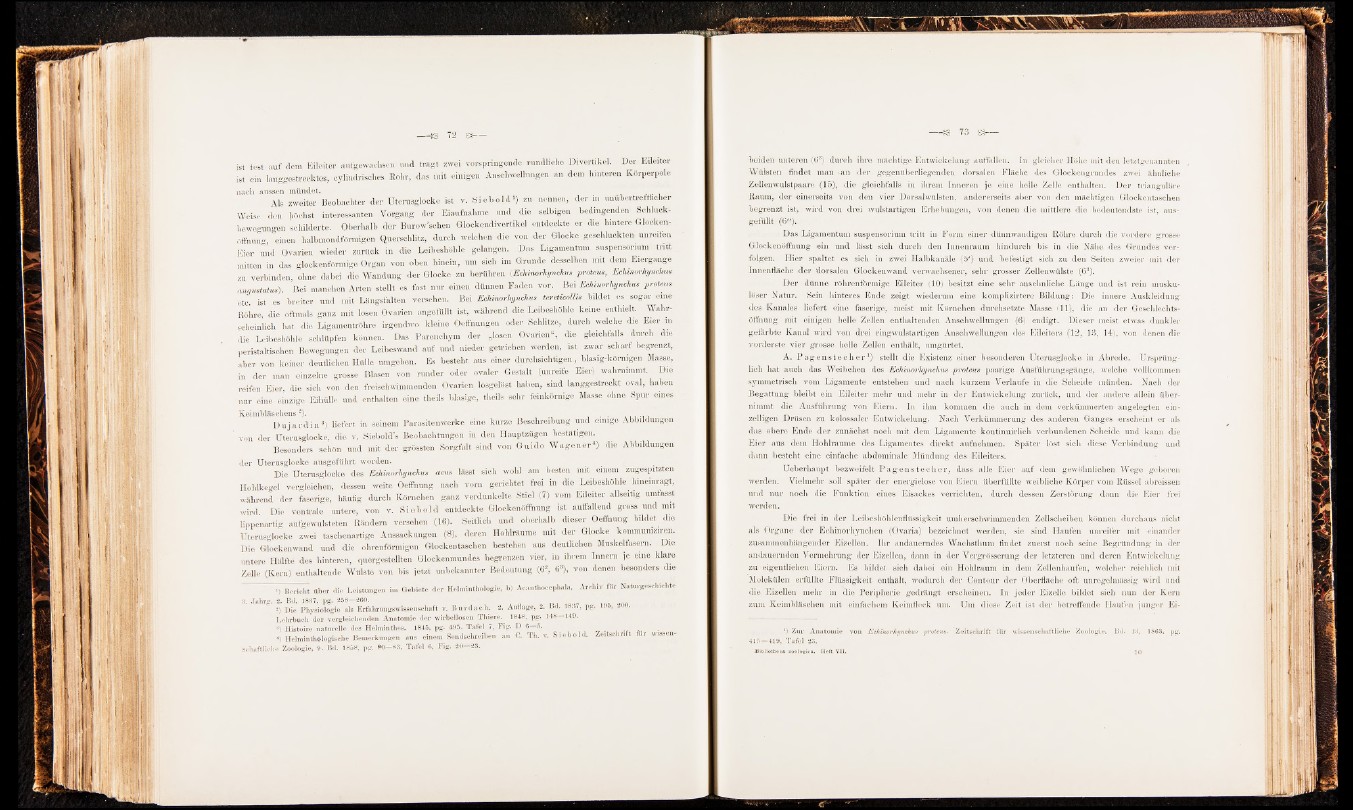
ist fest auf dem Eileiter aufgewaohseu und trägt zwei-vorspringende rundliehe Divertikel. Der. Eileiter
ist ein langgestrecktes, cylindrisehes Rohr, das - mit einigen Anschwellungen an dem hinteren Körperpole
nach aussen mündet. ,
Als zweiter Beobachter der Uterusglocke ist v. S ie b o ld 1) zu nennen, der in unübertrefflicher
Weise den höchst interessanten Vorgang der Eiaufnahme und die selbigen bedingenden Schluck-
bewegungen schilderte. Oberhalb der Bnrow’schen Glockendivertikel entdeokte er die hintere Glocken-
Öffnung, einen halbmondförmigen Querschlitz, durch welchen die von der Glocke geschluckten, unreifen
Eier und Ovarien wieder zurück in . die Leibeshöhle -gelangen. Das Ligamentum Suspensorium tritt
mitten in das glockenförmige Organ von oben hinein, um sieh im Grunde desselben mit dem Eiergange
zu verbinden, ohne dabei die Wandung der Glocke zu berühren {Echmorhyndm* proteus, Echinorhyndms
annustatm). Bei manchen Arten stellt :es fast nur einen dünnen Faden vor. Bei Echimrhyndtus proteus
etc. ist es breiter und mit Längsfalten versehen. Bei EMnorkynchus teretieolUs bildet |® ® S ar alIli
Bohre die oftmals ganz mit losen Ovarien angefüllt ist, während die Leibeshöhle keine enthielt. Wahrscheinlich
hat die Ligamentröhre irgendwo kleine Oeffnungen oder Schlitze, durch welche die Eier in
die Leibeshöhle schlüpfen können. Das Parenchym der „losen Ov aö ejlj die gleichfalls durch die
peristaltischen Bewegungen der Leibeswand auf und nieder getrieben w e r|e |, ist zwar scharf begrenzt,
aber von keiner deutlichen Hülle umgeben. Es besteht aus einer durchsichtigen, blasig-körnigen Masse,,
in der man einzelne grosse Blasen ^ n runder oder ovaler Gestalt (unreife Eier.) wahrnimmt. Die
reifen Eier, die sich von den freischwimmenden Ovarien losgelöst haben, sind langgestreckt oval, haben
nur eine einzige Eihüllo und enthalten eine theils blasige, theils sehr feinkörnige Masse ohne Spur emes.
Keimbläschens2). . . . , ,
D u j a r d i n 8) liefert in s e i n e m Parasitenwerke eine kurze Beschreibung und einige Abbildungen.
von der Uterusglocke, die v. Siebold’s Beobachtungen in den Hauptzügen bestätigen.
Besonders schön und mit der grössten Sorgfalt sind von Guido W a g e n e r4) die Abbildungen
der Uterusglocke ausgeführt worden.
Die Uterusglocke des Eehinorhyndius acus lässt sieh wohl am besten mit einem zugespitzten
Hohlkegel vergleichen, dessen weite Oeffnung nach vorn gerichtet frei in die Leibeshöhle hineinragt,
während der fäserige, häufig durch Körnchen ganz verdunkelte Stiel (7) vom Eileiter allseitig umfasst
wird Die ventrale untere, von v. S ie b o ld entdeokte Glockenöffnung ist auffallend gross und mit
lippenartig anfgöwnlsteten Rändern versehen (16). Seitlich und oberhalb -dieser Oeffnung bildet die
Uterusglocke zwei taschenartige Aussackungen (8), deren Hohlräume mit der Glocke kommumziren.
Die Glockenwand . und die ohrenförmigen Gloekentaschen bestehen aus deutlichen Muskelfasern. Die
untere Hälfte des hinteren, quergestellten Glockenmundes begrenzen vier, in ihrem Innern je eine klare
Zelle (Kern) enthaltende Wülste von bis jetzt unbekannter Bedeutung (62, 6S), von denen besonders die
•) Bericht Uber die Leistungen im Gebiete der HelminthologiST b) Acantbooepliala. Archiv Kür Naturgeschichie
! JahlK- Erfabrungswissenschaft v. B u rd a c h . 2. Auflage, 2. Bd. 1837, pg. 195, 200,. i
Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere. 1848, pg. 148-149.
I Histoire naturelle des HelÜnthes. 1845, pg. 495. Tafel 7, Big. D 6 - 5 .
-) Helminthologisehe Bemerkungen aus einem Sendschreiben an C. Th. v. S ie b old. Zeitschrift für wissen-
schaftliche Zoologie, 9. Bd. 1858, pg. 80-S3, Tafel 6, Fig. 20—23.
beiden unteren (68) durch ihre mächtige Entwickelung auflallen. In gleicher Höhe mit den letztgenannten
Wülsten findet man »an der gegenüberliegenden dorsalen Fläehe des Glockengrundes zwei ähnliche
Zellen wulstpaare (15), die gleichfalls in ihrem Inneren je eine helle Zelle enthalten. Der trianguläre
Raum, der einerseits von den vier Dorsalwülsten, andererseits aber von den mächtigen Glockentaschen
begrenzt ist, wird von drei wulstartigen Erhebungen, von denen die mittlere die bedeutendste ist, ausgefüllt
(6").
Das Ligamentum Suspensorium tritt in Form einer dünnwandigen Röhre durch die vordere grosse
Glockenöffnung ein und lässt sieh durch den Innenraum hindurch bis in die Nähe des Grundes verfolgen.
Hier spaltet es sich in zwei Halbkanäle (5y) und befestigt sich zu den Seiten zweier mit der
Innenfläche der dorsalen Glockenwand verwachsener, sehr grösser Zellenwülste (61).
Der dünne röhrenförmige Eileiter (10) besitzt eine sehr ansehnliche Länge und ist rein muskulöser
Natur. Sein hinteres Ende zeigt wiederum eine komplizirtere Bildung: Die innere Auskleidung
des Kanales liefert eine faserige, meist mit Körnchen durchsetzte Masse (11), die an der Geschlechts-
öffnung mit einigen helle Zellen enthaltenden Anschwellungen (6) endigt. Dieser meist etwas dunkler
gefärbte Kanal wird von drei ring wulstartigen Anschwellungen des Eileiters (12, 13, 14), von denen die
vorderste vier grosse helle Zellen enthält, umgürtet.
A. P a g e n s t e c h e r 1) stellt die Existenz einer besonderen Uterusglocke in Abrede. Ursprünglich
hat auch das Weibchen des Echinorhynchus proteus paarige Aüsführungsgänge, welche vollkommen
symmetrisch vom Ligamente entstehen und nach kurzem Verlaufe in die Scheide münden. Nach der
Begattung bleibt ein Eileiter mehr und mehr in der Entwickelung zurück, und der andere allein übernimmt
die Ausführung von Eiern. In ihm kommen die auch in dem verkümmerten angelegten einzelligen
Drüsen zu kolossaler Entwickelung. Nach Verkümmerung des anderen Ganges -erscheint er als
das obere Ende der zunächst noch mit dem Ligamente kontinuirlich verbundenen Scheide und kann die
Eier aus dem Hohlraume des Ligamentes direkt aufnehmen. Später löst sich diese Verbindung und
dann besteht eine einfache abdominale Mündung des Eileiters.
Ueberhaupt bezweifelt P a g e n s te c h e r , dass alle Eier auf dem gewöhnlichen Wege geboren
werden. Vielmehr soll später der energielose von Eiern überfüllte weibliche Körper vom Rüssel abreissen
und nur noch die Funktion eines Eisackes verrichten, durch dessen Zerstörung dann die Eier frei
werden.
Die frei in der Leibeshöhlenflüssigkeit umherschwimmenden Zellscheiben können durchaus nicht
als Organe der Echinorhynchen (Ovaria) bezeichnet werden, sie sind Haufen unreifer mit einander
zusammenhängender Eizellen. Ihr andauerndes Wachsthum findet zuerst noch seine Begründung in der
andauernden Vermehrung der Eizellen, dann in der Vergrösserung der letzteren und deren Entwickelung
zu eigentlichen Eiern. Es bildet sich dabei ein Hohlraum in dem Zellenhaufen, welcher reichlich mit
Molekülen erfüllte Flüssigkeit enthält, wodurch der Contour der Oberfläche oft unregelmässig wird und
die Eizellen mehr in die Peripherie gedrängt erscheinen. In jeder Eizelle bildet sieh nun der Kern
zum Keimbläschen mit einfachem Keimfleck um. Um diese Zeit ist der betreffende Haufen ‘junger Ei-
*) Zur Anatomie von Echinorhynchus proteus. Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Bd. 13, 1863. pg.