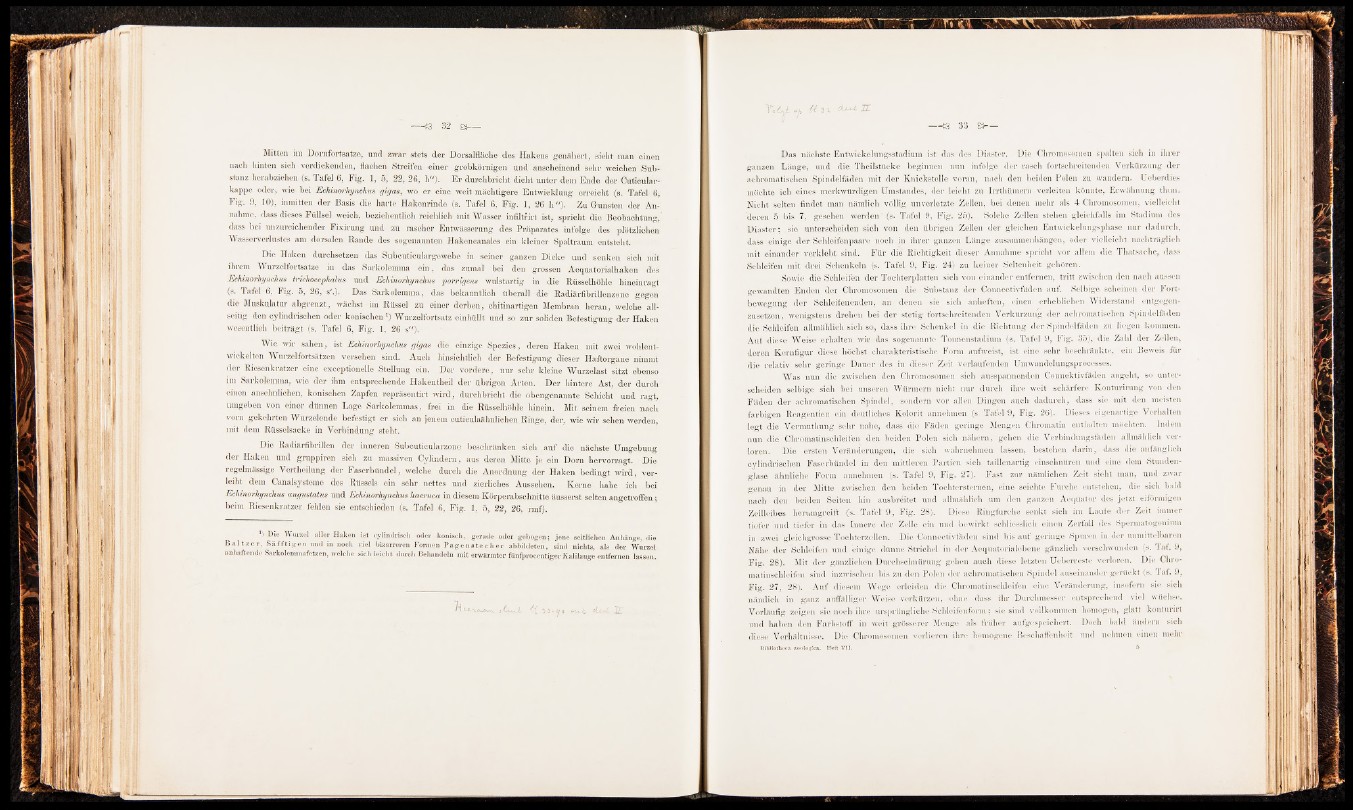
Mitten im Domfortsatze, und zwar stets der Dorsalfläclie des Hakens genähert, sieht man einen
nach hinten sich verdickenden, flachen Streifen einer grobkörnigen und anscheinend sehr weichen Substanz
herabziehen (s. Tafel 6, Fig. 1, 5, 22, 26, h"). Er durchbricht dicht unter dem Ende der Cuticular-
kappe oder, wie bei Echinorhynchus gigas, wo er eine weit mächtigere Entwicklung erreicht (s. Tafel 6>
Fig. 9, 10), inmitten der Basis die harte Hakenrinde (s. Tafel 6, Fig. 1, 26 h "). Zu Gunsten der Annahme,
dass dieses Füllsel weich, beziehentlich reichlich mit Wasser infiltrirt ist, spricht die Beobachtung,
dass bei unzureichender Fixirung und zu rascher Entwässerung des Präparates infolge des plötzlichen
Wasserverlustes am dorsalen Rande des sogenannten Hakencanales ein kleiner Spaltraum entsteht.
Die Haken durchsetzen das Subcuticulargewebe in seiner ganzen Dicke und senken sich mit
ihrem Wurzelfortsatze in das Sarkolemma ein, das zumal bei den grossen Aequatorialhaken des
Echinorhynclms trichocephalus und Echinorhynchus p o r r ig e n s wulstartig in die Rüsselhöhle hineinragt
(s. Tafel 6, Fig. 5, 26, s'.). Das Sarkolemma, das bekanntlich überall die Radiärfibrillenzone gegen
die Muskulatur abgrenzt, wächst im Rüssel zu einer derben, chitinartigen Membran heran, welche allseitig
den cylindrischen oder konischen:) Wurzelfortsatz einhüllt und so zur soliden Befestigung der Haken
wesentlich beiträgt (s. Tafel 6, Fig. 1, 26 s").
Wie wir sahen, ist Echinorhynchus gigas die einzige Spezies, deren Haken mit zwei wohlentwickelten
Wurzelfortsätzen versehen sind. Auch hinsichtlich der Befestigung dieser Haftorgane nimmt
der Riesenkratzer eine exceptionelle Stellung ein. Der vordere, nur sehr kleine Wurzelast sitzt ebenso
im Sarkolemma, wie der ihm entsprechende Hakentheil der übrigen Arten. Der hintere Ast, der durch
einen ansehnlichen, konischen Zapfen repräsentirt wird, durchbricht die obengenannte Schicht und ragt,
umgeben von einer dünnen Lage Sarkolemmas, frei in die Rüsselhöhle hinein. Mit seinem freien nach
vorn gekehrten Wurzelende befestigt er sich an jenem cuticulaähnlichen Ringe, der, wie wir sehen werden,
mit dem Rüsselsacke in Verbindung steht.
Die Radiärfibrillen der inneren Subcuticularzone beschränken sich auf die nächste Umgebung
der Haken und gruppiren sich zu massiven Cylindern, aus deren Mitte je ein Dorn hervorragt. Die
regelmässige Vertheilnng der Faserbündel, welche durch die Anordnung der Haken bedingt wird, verleiht
dem Canalsysteme des Rüssels ein sehr nettes und zierliches Aussehen. Kerne habe ich bei
Echinorhynchus angustatus und Echinorhynchus haeruca in diesem Körperabschnitte äusserst selten angetroffen ;
beim Riesenkratzer fehlen sie entschieden (s. Tafel 6, Fig. 1, 5, 22, 26 rmf).
*) Die Wurzel aller Haken ist cyündrisch ocler konisch, gerade oder gebogen; jene seitlichen Anhänge, die
B a l t z e r , S ä f f t ig e n und in noch viel bizarreren Formen P a g e n s t e c h e r abbildeten, sind nichts, als der Wurzel
anhaftende Sarkolemmafetzen, welche sich leicht durch Behandeln mit erwärmter fünfprocentiger Kalilauge entfernen lassen.
irrrwinni I inwnr
Ki 33 K—
Das nächste Entwickelungsstadium ist das des Diaster. Die Chromosomen spalten sich in ihrer
ganzen Länge, und die Theilstücke beginnen nun infolge der rasch fortschreitenden Verkürzung der
achromatischen Spindelfäden mit der Knickstelle voran, nach den beiden Polen zu wandern. Ueberdies
möchte ich eines merkwürdigen Umstandes, der leicht zu Irrthümern verleiten könnte, Erwähnung thun.
Nicht selten findet man nämlich völlig unverletzte Zellen, bei denen mehr als 4 Chromosomen, vielleicht
deren 5 bis 7, gesehen werden (s. Tafel 9, Fig. 25). Solche Zellen stehen gleichfalls im Stadium des
Diaster; sie unterscheiden sich von den übrigen Zellen der gleichen Entwickelungsphase nur dadurch,
dass einige der Schleifenpaare noch in ihrer ganzen Länge Zusammenhängen, oder vielleicht nachträglich
mit einander verklebt sind. Für die Richtigkeit dieser Annahme spricht vor allem die Thatsache, dass
Schleifen mit drei Schenkeln (s. Tafel 9, Fig. 24) zu keiner Seltenheit gehören.
Sowie die Schleifen der Tochterplatten sich von einander entfernen, tritt zwischen den nach aussen
gewandten Enden der Chromosomen die Substanz der Connectivfäden auf. Selbige scheinen der Fortbewegung
der Schleifen enden, an denen sie sich anheften, einen erheblichen Widerstand eutgegen-
zusetzen, wenigstens drehen bei der stetig fortschreitenden Verkürzung der achromatischen Spindelfäden
die Schleifen allmählich sich so, dass ihre Schenkel in die Richtung der Spindelfäden zu liegen kommen.
Auf diese Weise erhalten wir das sogenannte Tonnenstadium (s. Tafel 9, Fig. 35), die Zahl der Zellen,
deren Kernfigur diese höchst charakteristische Form aufweist, ist eine sehr beschränkte, ein Beweis für
die relativ sehr geringe Dauer des in dieser Zeit verlaufenden Umwandelungsprocesses.
Was nun die zwischen den Chromosomen sich ausspannenden Connektivfäden angeht, so unterscheiden
selbige sich bei unseren Würmern nicht nur durch ihre weit schärfere Konturirung von den
Fäden der achromatischen Spindel, sondern vor allen Dingen auch dadurch, dass sic mit den meisten
farbigen Reagentien ein deutliches Kolorit annehmen (s-Tafel 9, Fig. 26). Dieses eigenartige Verhalten
legt die Vermuthung sehr nahe, dass die Fäden geringe Mengen Chromatin enthalten möchten. Indem
nun die Chromatinschleifen den beiden Polen sich nähern, gehen die Verbinduugsfäden allmählich verloren.
Die ersten Veränderungen, die sich wahrnehmen lassen, bestehen darin, dass die anfänglich
cylindrischen Faserbündel in den mittleren Partien sich taillenartig cinschnüren und eine dem Stundenglase
ähnliche Form annehmen (s. Tafel 9, Fig. 27). Fast zur nämlichen Zeit sieht man, und zwar
genau in der Mitte zwischen den beiden Tochtersternen, eine seichte Furche entstehen, die sich bald
nach den beiden Seiten hin ausbreitet und allmählich um den ganzen Aequator des jetzt eiförmigen
Zellleibes herumgreift (s. Tafel 9, Fig. 28). Diese Ringfürche senkt sich im Laufe der Zeit immer
tiefer und tiefer in das Innere der Zelle ein und bewirkt schliesslich einen Zerfall des Spermatogonium
in zwei gleichgrosse Tochterzellen. Die Connectivfäden sind bis auf geringe Spuren in der unmittelbaren
Nähe der Schleifen und einige dünne Strichei in der Aequatorialebene gänzlich verschwunden (s. la t. 9,
Fig. 28). Mit der gänzlichen Durchschnürung gehen auch diese letzten Ueberreste verloren. Die Chromatinschleifen
sind inzwischen bis zu den Polen der achromatischen Spindel auseinander gerückt (s. Taf. 9,
Fi«-. 27 28). Auf diesem Wege erleiden die Chromatinschleifen eine Veränderung, insofern sie sich
nämlich in ganz auffälliger Weise verkürzen, ohne dass ihr Durchmesser entsprechend viel wüchse.
Vorläufig zeigen sie noch ihre ursprüngliche Schleifenform; sie sind vollkommen homogen, glatt konturirt
und haben den Farbstoff in weit grösserer Menge als früher aufgespeichert. Doch bald ändern sich
diese Verhältnisse. Die Chromosomen verlieren ihre homogene Beschaffenheit und nehmen einen mehr
Bibliotbeca zoologica. Heft VII. >r>