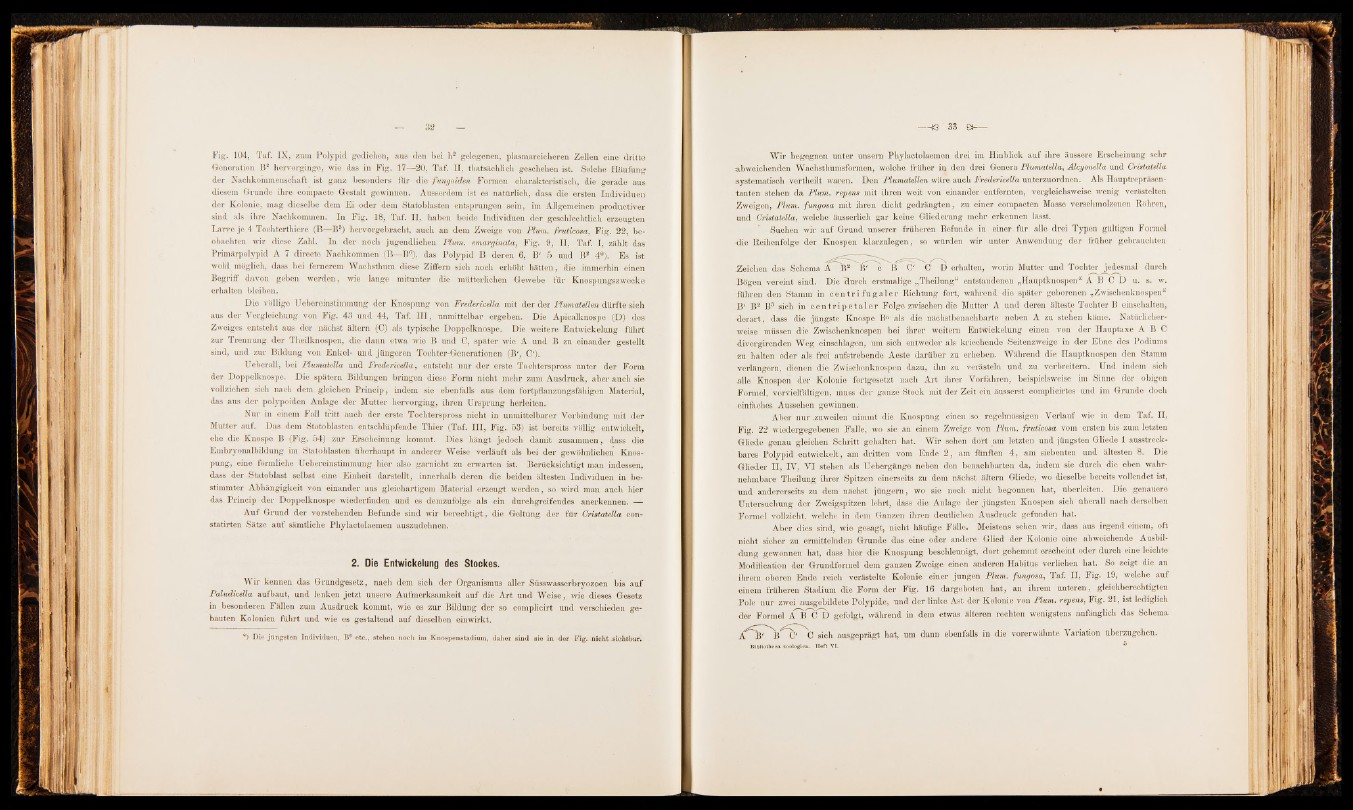
Fig. 104, Taf. IX, zum Polypid gediehen, aus den bei h2 gelegenen, plasmareicheren Zellen eine dritte
Generation B2 hervorginge, wie das in Fig. 17—20, Taf. H, thatsächlich geschehen ist. Solche Häufung
der Nachkommenschaft ist ganz besonders für die fungoiden Formen charakteristisch, die gerade aus
diesem Grunde ihre compacte Gestalt gewinnen. Ausserdem ist es natürlich, dass die ersten Individuen
der Kolonie, mag dieselbe dem Ei oder dem Statoblasten entsprungen sein, im Allgemeinen productiver
sind als ihre Nachkommen. In Fig. 18, Taf. II, haben beide Individuen der geschlechtlich erzeugten
Larve je 4 Tochterthiere (B—B8) hervorgebracht, auch an dem Zweige von Plum. fruticosa, Fig. 22, beobachten
wir diese Zahl. In der noch jugendlichen Plum. emarginata, Fig. 9, II, Taf. I, zählt das
Primärpolypid A 7 directe Nachkommen (B—B6), das Polypid B deren 6, B' 5 und B2 4*). Es ist
wohl möglich, dass bei fernerem Wachsthum diese Ziffern sich noch erhöht hätten, die immerhin einen
Begriff davon geben werden, wie lange mitunter die mütterlichen Gewebe für Knospungszwecke
erhalten bleiben.
Die völlige Uebereinstimmung der Knospung von Fredericella mit der der Plumatellen dürfte sich
aus der Vergleichung von Fig. 43 und 44, Taf. H I, unmittelbar ergeben. Die Apicalknospe (D) des
Zweiges entsteht aus der nächst ältern (C) als typische Doppelknospe. Die weitere. Entwickelung führt
zur Trennung der Theilknospen, die dann etwa wie B und C, später wie A und B zu einander gestellt
sind, und zur Bildung von Enkel- und jüngeren Tochter-Generationen (B', C').
Ueberall, bei Plumatella und Fredericella, entsteht nur der erste Tochterspross unter der Form
der Doppelknospe. Die spätem Bildungen bringen diese Form nicht mehr zum Ausdruck, aber auch sie
vollziehen sich nach dem gleichen Princip, indem sie ebenfalls aus dem fortpflanzungsfähigen Material,
das aus der polypoiden Anlage der Mutter hervorging, ihren Ursprung herleiten.
Nur in einem Fall tritt auch der erste Tochterspross nicht in unmittelbarer Verbindung mit der
Mutter auf. Das dem Statoblasten entschlüpfende Thier (Taf. III, Fig. 53) ist bereits völlig entwickelt,
ehe die Knospe B (Fig. 54) zur Erscheinung kommt. Dies hängt jedoch damit zusammen, dass die
Embryonalbildung im Statoblasten überhaupt in anderer Weise verläuft als bei der gewöhnlichen Knos-
pung, eine förmliche Uebereinstimmung hier also garnicht zu erwarten ist. Berücksichtigt man indessen,
dass der Statoblast selbst eine Einheit darstellt, innerhalb deren die beiden ältesten Individuen in bestimmter
Abhängigkeit von einander aus gleichartigem Material erzeugt werden, so wird man auch hier
das Princip der Doppelknospe wiederfinden und es demzufolge als ein durchgreifendes anerkennen. —
Auf Grund der vorstehenden Befunde sind wir berechtigt, die Geltung der für Cristatella con-
statirten Sätze auf sämtliche Phylactolaemen auszudehnen.
2. Die Entwickelung des Stockes.
Wir kennen das Grundgesetz, nach dem sich der Organismus aller Süsswasserbryozoen bis auf
Paludicella aufbaut, und lenken jetzt unsere Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie dieses Gesetz
in besonderen Fällen zum Ausdruck kommt, wie es zur Bildung der so complicirt und verschieden gebauten
Kolonien führt und wie es gestaltend auf dieselben ein wirkt.
*) Die jüngsten Individuen, B® etc., stehen noch im Knospenstadium, daher sind sie in der Fig.-nicht .sichtbar.
Wir begegnen unter unsem Phylactolaemen drei im Hinblick auf ihre äussere Erscheinung sehr
«,bweichenden Wachsthumsformen, welche früher in den drei Genera Plumatella, Alcyonella und Cristatella
systematisch vertheilt waren. Den Plumatellen wäre auch Fredericella unterzuordnen. Als Hauptrepräsentanten
stehen da Plum. repens mit ihren weit von einander entfernten, vergleichsweise wenig verästelten
Zweigen, Plum. fungosa mit ihren dicht gedrängten, zu einer compacten Masse verschmolzenen Röhren,
und Cristatella, welche äusserlich gar keine Gliederung mehr erkennen lässt.
Suchen wir auf Grund unserer früheren Befunde in einer, für alle drei Typen gültigen Formel
•die Reihenfolge der Knospen klarzulegen, so würden wir unter Anwendung der früher gebrauchten
Zeichen das Schema A~^B2 B ^ c B ^ G <3 D erhalten, worin Mutter und Töchter jedesmal durch
Bögen vereint sind. Die 'durch erstmalige „Theilung“ entstandenen „Hauptknospen“ A B C D u. s. w.
führen den Stamm in c e n t r i f u g a le r Richtung fort, während die später geborenen „Zwischenknospen“
B' B2 B8 sich in c e n t r i p e t a l e r Folge zwischen die Mutter A und deren älteste Tochter B einschalten,
•derart, dass die jüngste Knospe B“ als die nächstbenachbarte neben A zu stehen käme. Natürlicherweise
müssen die Zwischenknospen bei ihrer weitern Entwickelung einen von der Hauptaxe A B C
di vergütenden Weg einschlagen, um sich entweder als kriechende Seitenzweige in der Ebne des Podiums
zu halten oder als frei aufstrebende Aeste darüber zu erheben. Während die Hauptknospen den Stamm
verlängern, dienen die Zwischenknospen dazu, ihn zu verästeln und zu verbreitern. Und indem sich
-alle Knospen der Kolonie fortgesetzt nach Art ihrer Vorfahren, beispielsweise im Sinne der obigen
Formel, vervielfältigen, muss der ganze Stock mit der Zeit ein äusserst complicirtes und im Grande doch
•einfaches Aussehen gewinnen.
Aber nur .zuweilen nimmt die Knospung einen so regelmässigen Verlauf wie in dem Taf. II,
Fig. 22 wiedergegebenen Falle, wo sie an einem Zweige von Plum. fruticosa vom ersten bis zum letzten
Gliede genau gleichen Schritt gehalten hat. Wir sehen dort am letzten und jüngsten Gliede 1 ausstreckbares
Polypid entwickelt, am dritten vom Ende 2 , am fünften 4 , am siebenten und ältesten 8. Die
■Glieder II, IV, VI stehen als Uebergänge neben den benachbarten da, indem sie durch die eben wahrnehmbare
Theilung ihrer Spitzen einerseits zu dem nächst ältern Gliede, wo dieselbe bereits vollendet ist,
nnd andererseits zu dem nächst jüngem, wo sie noch nicht begonnen hat, überleiten. Die genauere
Untersuchung der Zweigspitzen lehrt, dass die Anlage der jüngsten Knospen sich überall nach derselben
Formel vollzieht, welche in dem Ganzen ihren deutlichen Ausdruck gefunden hat.
Aber dies sind, wie gesagt, nicht häufige Fälle* Meistens sehen wir, dass aus irgend einem, oft
nicht sicher zu ermittelnden Grande das eine oder andere Glied der Kolonie eine abweichende Ausbildung
gewonnen hat, dass hier die Knospung beschleunigt, dort gehemmt erscheint oder durch eine leichte
Modifikation der Grundformel dem ganzen Zweige einen anderen Habitus verliehen hat. So zeigt die an
ihrem oberen Ende reich verästelte Kolonie einer jungen Plum. fungosa, Taf. II, Fig. 19, welche auf
•einem früheren Stadium die Form der Fig. 16 dargeboten hat, an ihrem unteren, gleichberechtigten
Pole nur zwei ausgebildete Polypide, und der linke Ast der Kolonie von Plum. repens, Fig. 21, ist lediglich
■der Formel A~B~CfD gefolgt, während in dem etwas älteren rechten wenigstens anfänglich das Schema
CJ sich ausgeprägt hat, um dann ebenfalls in die vorerwähnte Variation überzugehen.
Bibllotheca zoologlca. Heft VI.