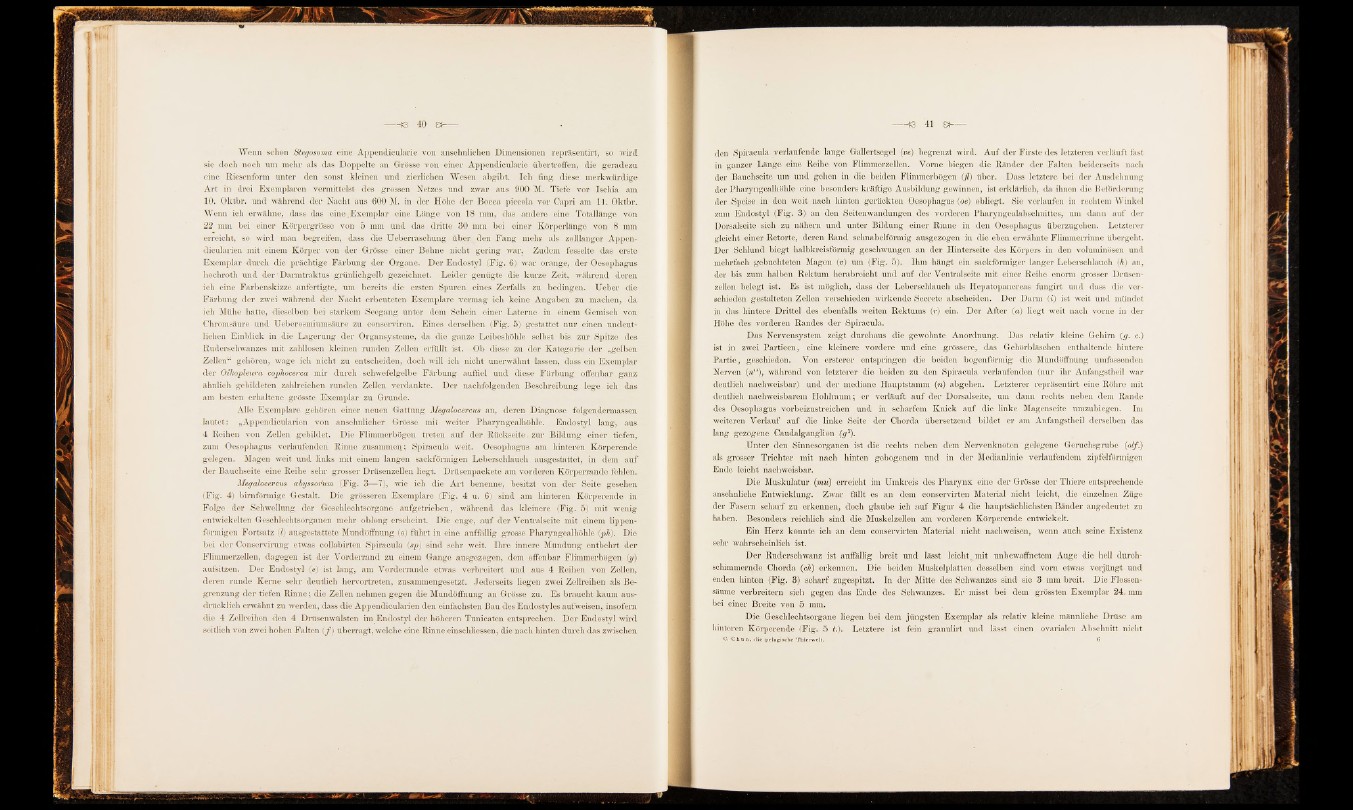
Wenn schon Stegosoma eine Appendicularie von ansehnlichen Dimensionen repräsentirt, so wird
sie doch noch um mehr als, das Doppelte an Grösse von einer Appendicularie übertroffen, die geradezu
eine Riesenform unter den sonst kleinen und zierlichen Wesen abgibt. loh fing diese merkwürdige^
Art in drei Exemplaren vermittelst des grossen Netzes und zwar aus 900 "M. Tiefe vor Ischia am
10. Oktbr. und während der Nacht aus 600 M. in der Höhe der Bocca piccola vor Capri am 11. Oktbr.
Wenn ich erwähne, dass das eine . Exemplar eine Länge von 18 mm, das andere eine Totallänge von
22 mm bei einer Körpergrösse von 5 mm und das dritte 30 mm bei einer Körperlänge von 8 mm
erreicht, so wird man begreifen, dass die Ueberrascbung über..den Fang mehr als zolllanger Appendicularien
mit einem Körper von der Grösse einer Böhne nicht gering war. Zudem fesselte das erste-
Exemplar durch die prächtige Färbung der Organe. Der Endostyl (Fig. 6) war orange, der Oesophagus
hochroth und der' Darmtraktus grünlichgelb gezeichnet. Leider genügte die kurze Zeit, während deren
ich eine Farbenskizze anfertigte, um bereits die ersten Spuren eines Zerfalls zu bedingen. Ueber die-
Färbung der zwei während der Nacht erbeuteten Exemplare vermag ich keine Angaben zu machen, da
ich Mühe hatte, dieselben bei starkem Seegang unter dem Schein einer Laterne in einem Gemisch von
Chromsäure und Ueberosmiumsäure zu eonserviren. Eines derselben (Fig. 5) gestattet nur einen undeutlichen
Einblick in die Lagerung der Organsysteme, da die ganze Leibeshöhle selbst bis zur Spitze des-
Ruderschwanzes mit zahllosen ldeinen runden Zellen erfüllt ist. Ob diese zu der Kategorie der „gelben
Zellen“ gehören, wage ich nicht zu entscheiden, doch will ich nicht unerwähnt lassen, dass ein Exemplar
der Oikopleura cophocerca mir durch schwefelgelbe Färbung auffiel und diese Färbung offenbar ganz
ähnlich gebildeten zahlreichen runden Zellen verdankte. Der nachfolgenden Beschreibung lege ich das-
am besten erhaltene grösste Exemplar zu Grunde.
Alle Exemplare gehören einer neuen Gattung Megalocercus an, deren Diagnose folgendermassen
lautet: „Appendicularien von ansehnlicher Grösse mit weiter Pharyngealhöhle. Endostyl lang, aus-
4 Reihen von Zellen gebildet. Die Flimmerbögen treten auf der Rückseite, zur Bildung einer tiefen,
zum Oesophagus verlaufenden Rinne zusammen; Spiraeula weit. Oesophagus am hinteren Körperende
gelegen. Magen weit und links mit einem langen sackförmigen Leberschlauch ausgestattet, in dem auf
der Bauchseite eine Reihe sehr grösser Drüsenzellen liegt. Drüsenpackete am vorderen Körperrande fehlen.
Megalocercus abyssor'um (Fig. 3—7), wie ich die Art benenne, besitzt von der Seite gesehen
(Fig. 4) bimförmige Gestalt. Die grösseren Exemplare (Fig. 4 u. 6) sind am hinteren Körperende in
Folge der Schwellung der Geschlechtsorgane aufgetrieben, während das Meinere (Fig. 5) mit wenig
entwickelten Geschlechtsorganen mehr oblong erscheint. Die enge, auf der Ventralseite mit einem lippenförmigen
Fortsatz (l) ausgestattete Mundöffnung (o) führt in eine auffällig grosse Pharyngealhöhle (ph). Die
bei der Conservirung etwas collabirten Spiraeula (sp) sind sehr weit. Ihre innere Mündung entbehrt der
Flimmerzellen, dagegen ist der Vorderrand zu einem Gange ausgezogen, dem offenbar Flimmerbögen (y)
aufsitzen. Der Endostyl (e) ist lang, am Vorderrande etwas verbreitert und aus 4 Reihen von Zellen,
deren runde Kerne sehr deutlich hervortreten, zusammengesetzt. Jederseits hegen zwei Zellreihen als Begrenzung
der tiefen Rinne; die Zellen nehmen gegen die Mundöffnung an Grösse zu. Es braucht kaum ausdrücklich
erwähnt zu werden, dass die Appendicularien den einfachsten Bau des Eridostyles aufweisen, insofern
die 4 Zellreihen den 4 Drüsenwülsten im Endostyl der höheren Tunicaten entsprechen. Der Endostyl wird
seitlich von zwei hohen Falten ( f) überragt, welche eine Rinne einschliessen, die nach hinten durch das zwischen
den Spiraeula verlaufende lange Gallertsegel (ve) begrenzt wird. Auf der Firste des letzteren verläuft fast
in ganzer Länge eine Reihe von Flimmerzelleh. Vorne biegen die Ränder der Falten beiderseits nach
der Bauchseite um und gehen in die beiden Flimmerbögen (fl) über. Dass letztere bei der Ausdehnung
der Pharyngealhöhle eine besonders kräftige Ausbildung gewinnen, ist erklärlich, da ihnen die Beförderung
der Speise in den weit nach hinten gerückten Oesophagus (oe) obhegt. Sie verlaufen in rechtem Winkel
zum Endostyl (Fig. 3) an den Seitenwandungen des vorderen Pharyngealabschnittes, um dann auf der
Dorsalseite sich zu nähern und unter Bildung einer Rinne in den Oesophagus überzugehen. Letzterer
gleicht einer Retorte, deren Rand schnabelförmig ausgezogen in die eben erwähnte Flimmerrinne übergeht.
Der Schlund biegt halbkreisförmig geschwungen an der Hinterseite des Körpers in den voluminösen und
mehrfach gebuchteten Magen (v) um (Fig. 5). Ihm hängt ein sackförmiger langer Leberschlauch (h) an,
der bis zum halben Rektum herabreicht und auf der Ventralseite mit einer Reihe enorm grösser Drüsenzellen
belegt ist. Es ist. möglich, dass der Leberschlauch als Hepatopancreas fungirt und dass die verschieden
gestalteten Zellen verschieden wirkende Secrete abscheiden. Der Darm (i) ist weit und mündet
in das hintere Drittel des ebenfalls weiten Rektums (r) ein. Der After (a) liegt weit nach vorne in der
Höhe des vorderen Randes der Spiraeula.
Das Nervensystem zeigt durchaus die gewohnte Anordnung. Das relativ kleine Gehirn (g. c.)
ist in zwei Partieen, eine kleinere vordere und eine grössere, das Gehörbläschen enthaltende hintere
Partie, geschieden. Von ersterer entspringen die beiden bogenförmig die Mundöffnung umfassenden
Nerven (w"), während von letzterer die beiden zu den Spiraeula verlaufenden (nur ihr Anfangstheil war
deutlich nachweisbar) und der mediane Hauptstamm (w) abgehen. Letzterer repräsentirt eine Röhre mit
deutlich nachweisbarem Hohlraum; er verläuft auf der Dorsalseite, um dann rechts neben dem Rande
des Oesophagus vorbeizustreichen und in scharfem Knick auf die linke Magenseite umzubiegen. Im
weiteren Verlauf auf die linke Seite der Chorda übersetzend bildet er am Anfangstheil derselben das
lang gezogene Caudalganglion (g1).
.Unter den Sinnesorganen ist die rechts neben dem Nervenknoten gelegene Geruchsgrube (olf.)
als grösser Trichter mit nach hinten gebogenem und in der Medianlinie verlaufendem zipfelförmigen
Ende leicht nachweisbar.
Die Muskulatur (mu) erreicht im Umkreis des Pharynx eine der Grösse der Thiere entsprechende
ansehnliche EntwicMung. Zwar fällt es an dem conservirten Material nicht leicht, die einzelnen Züge
der Fasern scharf zu erkennen, doch glaube ich auf Figur 4 die hauptsächlichsten. Bänder angedeutet zu
haben. Besonders reichlich sind die Muskelzellen am vorderen Körperende entwickelt.
Ein Herz konnte ich an dem conservirten Material nicht nachweisen, wenn auch seine Existenz
sehr wahrscheinlich ist.
Der Ruderschwanz ist auffällig breit und lässt leicht^mit unbewaffnetem Auge die hell durchschimmernde
Chorda (ch) erkennen. Die beiden Muskelplatten desselben sind vom etwas verjüngt und
enden hinten (Fig. 3) scharf zugespitzt. In der Mitte des Schwanzes sind sie 3 mm breit. Die Flossensäume
verbreitern sich gegen das Ende des Schwanzes. Er misst hei dem grössten Exemplar 24. mm
bei einer Breite von 5 mm.
Die Geschlechtsorgane liegen bei dem jüngsten Exemplar als relativ kleine männliche Drüse am
hinteren Körperende (Fig. 5 t.). Letztere ist fein granulirt und lässt einen ovarialen Abschnitt nicht
C. C h u n , die pelagische Thierwelt. . 6