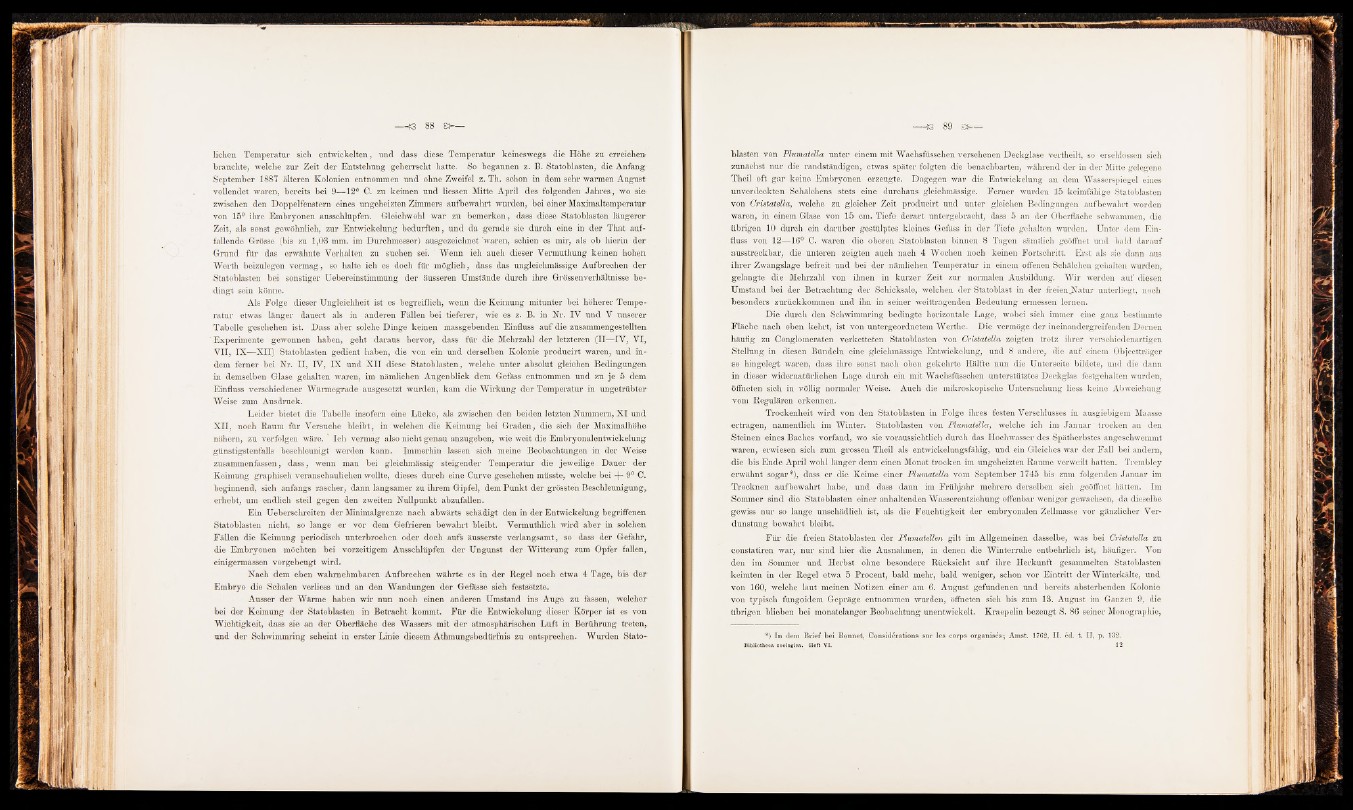
liehen Temperatur sich entwickelten, nnd dass diese Temperatur keineswegs die Höhe zu erreichen
brauchte, welche zur Zeit der Entstehung geherrscht hatte. So begannen z. B. Statoblasten, die Anfang-
September 1887 älteren Kolonien entnommen und ohne Zweifel z. Th. schon in dem sehr warmen August
vollendet waren, bereits bei 9—12° C. zu keimen und liessen Mitte April des folgenden Jahres, wo sie
zwischen den Doppelfenstern eines ungeheizten Zimmers aufbewahrt wurden, bei einer Maximaltemperatur
von 15° ihre Embryonen ausschlüpfen. Gleichwohl war zu bemerken, dass diese Statoblasten längerer
Zeit, als sonst gewöhnlich, zur Entwickelung bedurften, und da gerade sie durch eine in der That auffallende
Grösse (bis zu 1,03 mm. im Durchmesser) ausgezeichnet waren, schien es mir, als ob hierin der
Grund für das erwähnte Verhalten zu suchen sei. ' Wenn ich auch dieser Vermuthung keinen hohen
Werth beizulegen vermag, so halte ich es doch für möglich, dass das ungleichmässige Aufbrechen der
Statoblasten bei sonstiger Uebereinstimmung der äusseren Umstände durch ihre Grössenverhältnisse bedingt
sein könne.
Als Folge dieser Ungleichheit ist es begreiflich, wenn die Keimung mitunter bei höherer Temperatur
etwas länger dauert als in anderen Fällen bei tieferer, wie es z. B. in Nr. IV und V unserer
Tabelle geschehen ist. Dass aber solche Dinge keinen massgebenden Einfluss auf die zusammengestellten
Experimente gewonnen haben, geht daraus hervor, dass für die Mehrzahl der letzteren (II—IV, VI,
VII, IX—XII) Statoblasten gedient haben, die von ein und derselben Kolonie producirt waren, und indem
ferner bei Nr. II, IV, IX und XII diese Statoblasten, welche unter absolut gleichen Bedingungen
in demselben Glase gehalten waren, im nämlichen Augenblick dem Gefäss entnommen und zu je 5 dem
Einfluss verschiedener Wärmegrade ausgesetzt wurden, kam die Wirkung der Temperatur in ungetrübter
Weise zum Ausdruck.
Leider bietet die Tabelle insofern eine Lücke, als zwischen den beiden letzten Nummern, X I und
XII, noch Raum für Versuche bleibt, in welchen die Keimung bei Graden, die sich der Maximalhöhe
nähern, zu verfolgen wäre. Ich vermag also nicht genau anzugeben, wie weit die Embryonalentwickelung
günstigstenfalls beschleunigt werden kann. Immerhin lassen sich meine Beobachtungen in der Weise
zusammenfassen, dass, wenn man bei gleichmässig steigender Temperatur die jeweilige Dauer der
Keimung graphisch veranschaulichen wollte, dieses durch eine Curve geschehen müsste, welche bei -|- 9° C.
beginnend, sich anfangs rascher, dann langsamer zu ihrem Gipfel, dem Punkt der grössten Beschleunigung,,
erhebt, um endlich steil gegen den zweiten Nullpunkt abzufallen.
Ein Ueberschreiten der Minimalgrenze nach abwärts schädigt den in der Entwickelung begriffenen
Statoblasten nicht, so lange er vor dem Gefrieren bewahrt bleibt. Vermuthlich wird aber in solchen
Fällen die Keimung periodisch unterbrochen oder doch aufs äusserste verlangsamt, so dass der Gefahr>
die Embryonen möchten bei vorzeitigem Ausschlüpfen der Ungunst der Witterung zum Opfer fallen,,
einigermassen vorgebeugt wird.
Nach dem eben wahrnehmbaren Aufbrechen währte es in der Regel noch etwa 4 Tage, bis der
Embryo die Schalen verliess und an den Wandungen der Gefässe sich fests’ótzte.
Ausser der Wärme haben wir nun noch einen anderen Umstand ins Auge zu fassen, welcher
bei der Keimung der Statoblasten in Betracht kommt. Für die Entwickelung dieser Körper ist es von
Wichtigkeit^ dass sie an der Oberfläche des Wassers mit der atmosphärischen Luft in Berührung treten,,
und der Schwimmring scheint in erster Linie diesem Athmungsbedürfhis zu entsprechen. Wurden Statoblasten
von Plumatella unter einem mit Wachsfüsschen versehenen Deckglase vertheilt, so erschlossen sich
zunächst nur die randständigen, etwas später folgten die benachbarten, während der in der Mitte gelegene
Theil oft. gar keine Embryonen erzeugte. Dagegen war die Entwickelung an dem Wasserspiegel eines
unverdeckten Schälchens stets eine durchaus gleichmässige. Ferner wurden 15 keimfähige Statoblasten
von Cristatella, welche zu gleicher Zeit producirt und unter gleichen Bedingungen aufbewahrt worden
waren, in einem Glase von 15 cm. Tiefe derart untergebracht, dass 5 an der Oberfläche schwammen, die
übrigen 10 durch , ein darüber gestülptes kleines Gefäss in der Tiefe gehalten wurden. Unter dem Einfluss
von 12—16° C. waren die oberen Statoblasten binnen 8 Tagen sämtlich geöffnet und bald darauf
ausstreckbar, die unteren zeigten auch nach 4 Wochen noch keinen Fortschritt. Erst als sie dann aus
ihrer Zwangslage befreit und bei der nämlichen Temperatur in einem offenen Schälchen gehalten wurden,
gelangte die Mehrzahl von ihnen in kurzer Zeit zur normalen Ausbildung. Wir werden auf diesen
Umstand bei der Betrachtung der Schicksale, welchen der Statoblast in der freien ^Natur unterliegt, noch
besonders zurückkommen und ihn in seiner weittragenden Bedeutung ermessen lernen.
Die durch den Schwimmring bedingte horizontale Lage, wobei sich immer eine ganz bestimmte
Fläche nach oben kehrt, ist von untergeordnetem Werthe. Die vermöge der ineinandergreifenden Dornen
häufig zu Conglomeraten verketteten Statoblasten von Cristatella zeigten trotz ihrer verschiedenartigen
Stellung in diesen Bündeln eine gleichmässige Entwickelung, und 8 andere, die auf einem Objectträger
so hingelegt waren, dass ihre sonst nach oben gekehrte Hälfte nun die Unterseite bildete, und die dann
in dieser widernatürlichen Lage durch ein mit Wachsfüsschen unterstütztes Deckglas festgehalten wurden,
öffneten sich in völlig normaler Weise. Auch die mikroskopische Untersuchung liess keine Abweichung
vom Regulären erkennen.
Trockenheit wird von den Statoblasten in Folge ihres festen Verschlusses in ausgiebigem Maasse
ertragen, namentlich im Winter. Statoblasten von Plumatdla, welche ich im Januar trocken an den
Steinen eines Baches vorfand, wo sie voraussichtlich durch das Hochwasser des Spätherbstes angeschwemmt
waren, erwiesen sich zum grossen Theil als entwickelungsfähig, und ein Gleiches war der Fall bei ändern,
die bis Ende April wohl länger denn einen Monat trocken im ungeheizten Raume verweilt hatten. Trembley
erwähnt sogar*), dass er die Keime einer Plumatella vom September 1745 bis zum folgenden Januar im
Trocknen aufbewahrt habe, und dass dann im Frühjahr mehrere derselben sich geöffnet hätten. Im
Sommer sind die Statoblasten einer anhaltenden Wasserentziehung offenbar weniger gewachsen, da dieselbe
gewiss nur so lange unschädlich ist, als die Feuchtigkeit der embryonalen Zellmasse vor gänzlicher Verdunstung
bewahrt bleibt.
Für die freien Statoblasten der Plumatellen gilt im Allgemeinen dasselbe, was bei Cristatella zu
constatiren war, nur sind hier die Ausnahmen, in denen die Winterruhe entbehrlich ist, häufiger. Von
den im Sommer und Herbst ohne besondere Rücksicht auf ihre Herkunft gesammelten Statoblasten
keimten in der Regel etwa 5 Procent, bald mehr, bald weniger, schon vor Eintritt der Winterkälte, und
von 160, welche laut meinen Notizen einer am 6. August gefundenen und bereits absterbenden Kolonie
von typisch fungoidem Gepräge entnommen wurden, öffneten sich bis zum 13. August im Ganzen 9, die
übrigen blieben bei monatelanger Beobachtung unentwickelt. Kraepelin bezeugt S. 86 seiner Monographie,
*) In dem Brief bei Bonnet, Considérations sur les corps organisés; Âmst. 1 7 6 2 , II. éd. t. II, p. 132.
Bibliotheca zoologica. Heft VI. 1 2