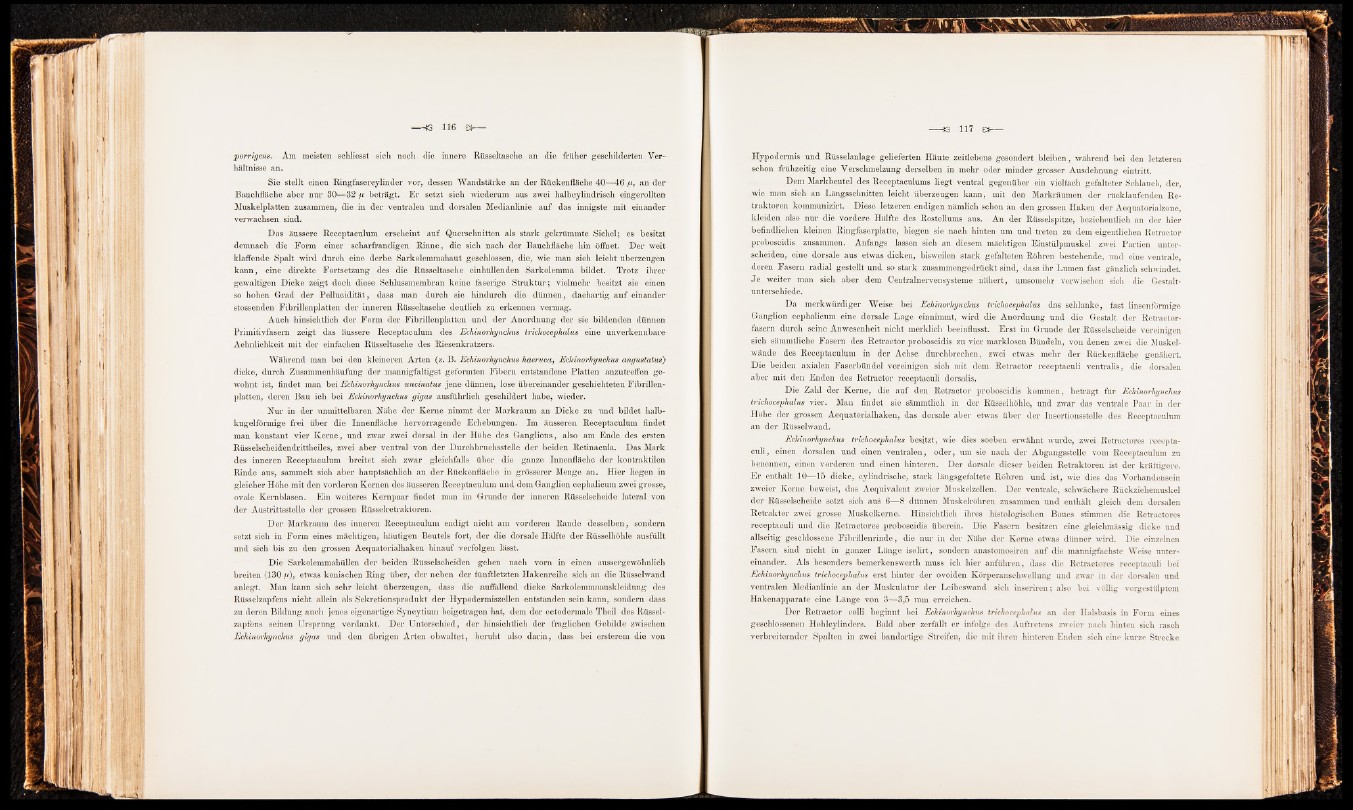
porrigens. Am meisten schliesst sich noch die innere Rüsseltasche an die früher geschilderten Verhältnisse
an.
Sie stellt einen Ringfasercylinder vor, dessen Wandstärke an der Rückenfläche 40—46 /<, an d e r
Bauchfläche aber nur 30—32 /.t beträgt. Er setzt sich wiederum aus zwei halbcylindrisch eingerollten
Muskelplatten zusammen, die in der ventralen und dorsalen Medianlinie auf das innigste mit einander
verwachsen sind.
Das äussere Receptaculum erscheint auf Querschnitten als stark gekrümmte Sichel; es besitzt
demnach die Form einer scharfrandigen Rinne, die sich nach der Bauchfläche hin öffnet. Der weit
klaffende Spalt wird durch eine derbe Sarkolemmahaut geschlossen, die, wie man sich leicht überzeugen
kann, eine direkte Fortsetzung des die Rüsseltasche einhüllenden Sarkolemma bildet. Trotz ihrer-
gewaltigen Dicke zeigt doch diese Schlussmembran keine faserige Struktur; vielmehr besitzt sie einen
so hohen Grad der Pellucidität, dass man durch sie hindurch die dünnen, dachartig auf einander-
stossenden Fibrillenplatten der inneren Rüsseltasche deutlich zu erkennen vermag.
Auch hinsichtlich der Form der Fibrillenplatten und der Anordnung der sie bildenden dünnen
Primitivfasem zeigt das äussere Receptaculum des Echinorhynchus trichocephalus eine unverkennbare
Aehnlichkeit mit der einfachen Rüsseltasche des Riesenkratzers.
Während man bei den kleineren Arten (z. B. Echinorhynchus haeruca, Echinorhynchus angustatus}
dicke, durch Zusammenhäufung der mannigfaltigst geformten Fibern entstandene Platten anzutreffen gewohnt
ist, findet man bei Echinorhynchus uncinatus jene dünnen, lose übereinander geschichteten Fibrillenplatten,
deren Bau ich bei Echinorhynchus gigas ausführlich geschildert habe, wieder.
Nur in der unmittelbaren Nähe der Kerne nimmt der Markraum an Dicke zu und bildet halb-
kugelförmige frei über die Innenfläche hervorragende Erhebungen. Im äusseren Receptaculum findet
man konstant vier Kerne, und zwar zwei dorsal in der Höhe des Ganglions, also am Ende des ersten
Rüsselscheidendrittheiles, zwei aber ventral von der Durchbruchsstelle der beiden Retinacula. Das Mark
des inneren Receptaculum breitet sich zwar gleichfalls über die ganze Innenfläche der kontraktilen
Rinde aus, sammelt sich aber hauptsächlich an der Rückenfläche in grösserer Menge an. Hier liegen in
gleicher Höhe mit den vorderen Kernen des äusseren Receptaculum und dem Ganglion cephalicum zwei grosse,.
ovale Kernblasen. Ein weiteres Kernpaar findet man im Grunde der inneren Rüsselscheide lateral von
der Austrittsstelle der grossen Rüsselretraktoren.
Der Markraum des inneren Receptaculum endigt nicht am vorderen Rande desselben, sondern
setzt sich in Form eines mächtigen, häutigen Beutels fort, der die dorsale Hälfte der Rüsselhöhle ausfüllt
und sich bis zu den grossen Aequatorialhaken hinauf verfolgen lässt.
Die Sarkolemmahüllen der beiden Rüsselscheiden gehen nach vorn in einen aussergewöhnliöh
breiten (130 p), etwas konischen Ring über, der neben der fünftletzten Hakenreihe sich an die Rüsselwand
anlegt. Man kann sich sehr leicht überzeugen, dass die auflallend dicke Sarlcolemmaauskleidung des
Rüsselzapfens nicht allein als Sekretionsprodukt der Hypodermiszellen entstanden sein kann, sondern dass
zu deren Bildung auch jenes eigenartige Syncytium beigetragen hat, dem der ectodermale Theil des Rüsselzapfens
seinen Ursprung verdankt. Der Unterschied, der hinsichtlich der fraglichen Gebilde zwischen
Echinorhynchus gigas und den übrigen Arten obwaltet, beruht also dai'in, dass bei ersterem die von
Hypo dermis und Rüsselanlage gelieferten Häute zeitlebens gesondert bleiben, während bei den letzteren
schon frühzeitig eine Verschmelzung derselben in mehr oder minder grösser Ausdehnung eintritt.
Dem Markbeutel des Receptaculums liegt ventral gegenüber ein vielfach gefalteter Schlauch, der,
wie inan sich an Längsschnitten leicht überzeugen kann, mit den Markräumen der rücklaufenden Re-
traktoren kommunizirt. Diese letzeren endigen nämlich schon an den grossen Haken der Aequatorialzone,
kleiden also nur die vordere Hälfte des Rosteilums aus. An der Rüsselspitze, beziehentlich an der hier
befindlichen kleinen Ringfaserplatte, biegen sie nach hinten um und treten zu dem eigentlichen Retractor
proboscidis zusammen. Anfangs lassen sich an diesem mächtigen Einstülpmuskel zwei Partien unterscheiden,
eine dorsale aus etwas dicken, bisweilen stark gefalteten Röhren bestehende, und eine ventrale,
deren Fasern radial gestellt und so stark zusammengedrückt sind, dass ihr Lumen fast gänzlich schwindet.
Je weiter man sich aber dem Centralnervensysteme nähert, umsomehr verwischen sich die Gestaltunterschiede.
Da merkwürdiger Weise bei Echinorhynchus trichocephalus das schlanke, fast linsenförmige
Ganglion cephalicum eine dorsale Lage einnimmt, wird die Anordnung und die Gestalt der Retractor-
fasern durch seine Anwesenheit nicht merklich beeinflusst. Erst im Grunde der Rüsselscheide vereinigen
sich sämmtliche Fasern des Retractor proboscidis zu vier marklosen Bündeln, von denen zwei die Muskelwände
des Receptaculum in der Achse durchbrechen, zwei etwas mehr der Rückenfläche genähert.
Die beiden axialen Faserbündel vereinigen sich mit dem Retractor receptaculi ventralis, die dorsalen
aber mit den Enden des Retractor receptaculi dorsalis.
Die Zahl der Kerne, die auf den Retractor proboscidis kommen, beträgt für Echinorhynchus
trichocephalus vier. Man findet sie sämmtlich in der Rüsselhöhle, und zwar das ventrale Paar in der
Höhe der grossen Aequatorialhaken, das dorsale aber etwas über der Insertionsstelle des Receptaculum
an der Rüsselwand.
Echinorhynchus trichocephalus besitzt, wie dies soeben erwähnt wurde, zwei Retractores receptaculi,
einen dorsalen und einen ventralen, oder, um sie nach der Abgangsstelle vom Receptaculum zu
benennen, einen vorderen und einen hinteren. Der dorsale dieser beiden Retraktoren ist der kräftigere.
Er enthält 10—15 dicke, cylindrische, stark längsgefaltete Röhren und ist, wie dies das Vorhandensein
zweier Kerne beweist, das Aequivalent zweier Muskelzellen. Der ventrale, schwächere Rückziehemuskel
der Rüsselscheide setzt sich aus 6— 8 dünnen Muskelröhren zusammen und enthält gleich dem dorsalen
Retraktor zwei grosse Muskelkerne. Hinsichtlich ihres histologischen Baues stimmen die Retractores
receptaculi und die Retractores proboscidis überein. Die Fasern besitzen eine gleichmässig dicke und
allseitig geschlossene Fibrillenrinde, die nur in der Nähe der Kerne etwas dünner wird. Die einzelnen
Fasern sind nicht in ganzer Länge isolirt, sondern anastomosiren auf die mannigfachste Weise untereinander.
Als besonders bemerkenswerth muss ich hier anführen, dass die Retractores receptaculi bei
Echinorhynchus trichocephalus erst hinter der ovoiden Körperanschwellung und zwar in der dorsalen und
ventralen Medianlinie an der Muskulatur der Leibeswand sich inseriren; also bei völlig vorgestülptem
Hakenapparate eine Länge von 3—3,5 mm erreichen.
Der Retractor colli beginnt bei Echinorhynchus trichocephalus an der Halsbasis in Form eines
geschlossenen Hohlcylinders. Bald aber zerfällt er infolge des Auftretens zweier nach hinten sich rasch
verbreiternder Spalten in zwei bandartige Streifen, die mit ihren hinteren Enden sich eine kurze Strecke