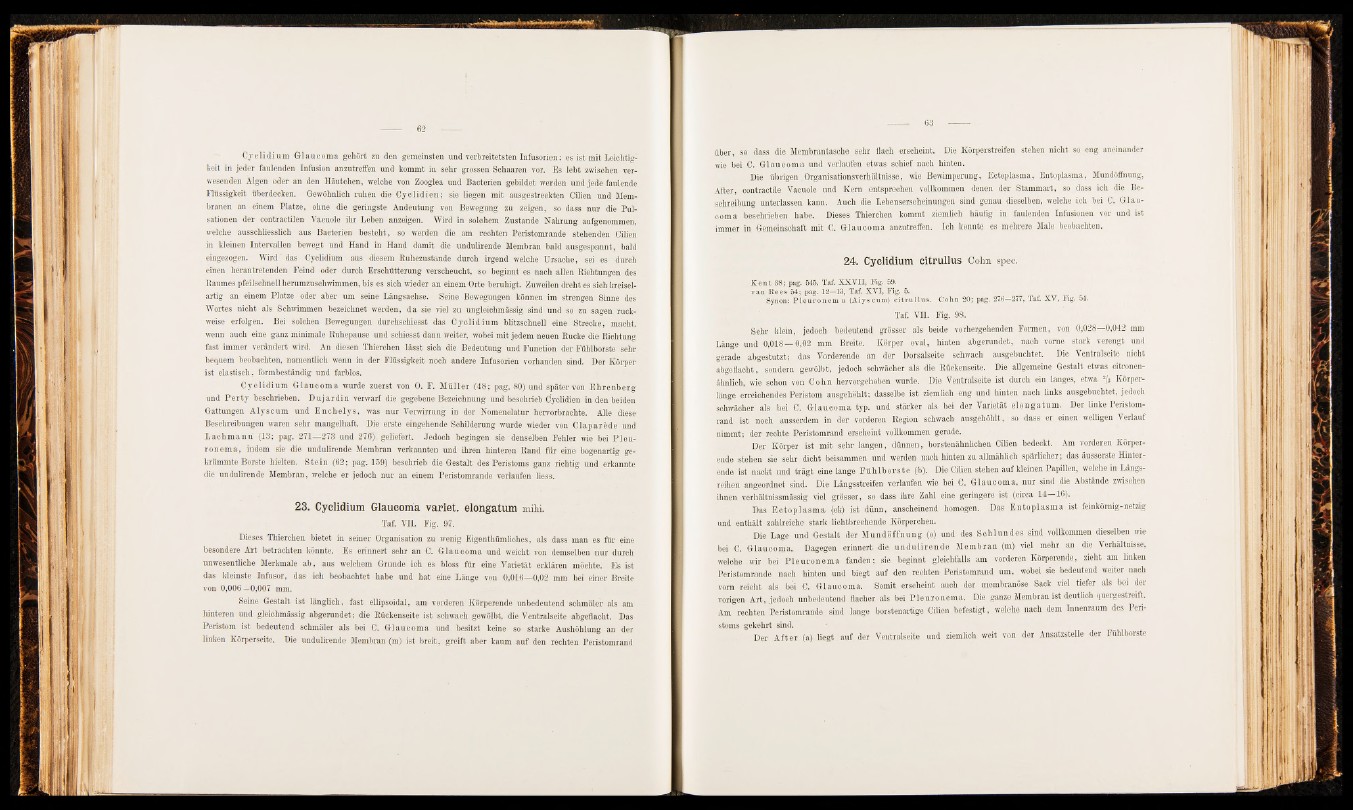
Cyclidium Glaucoma gehört zu den gemeinsten und verbreitetsten Infusorien; es ist mit Leichtigkeit
in jeder faulenden Infusion anzutreffen und kommt in sehr grossen Schaaren vor. Es lebt zwischen verwesenden
Algen oder an den Häutchen, welche von Zooglea und Bacterien gebildet werden und jede faulende
Flüssigkeit überdecken. Gewöhnlich ruhen die Cyclidien; sie liegen mit ausgestreckten Cilien und Membranen
an einem Platze, ohne die geringste Andeutung von Bewegung zu zeigen, so dass nur die Pulsationen
der contractilen Väcuole ihr Leben anzeigen. Wird in solchem Zustande Nahrung aufgenommen,
welche ausschliesslich aus Bacterien besteht, so werden die am rechten Peristomrande stehenden Cilien
in kleinen Intervallen bewegt und Hand in Hand damit die undulirende Membran bald ausgespannt, bald
eingezogen. Wird' das Cyclidium aus diesem Ruhezustände durch irgend welche Ursache, sei es durch
einen herantretenden Feind oder durch Erschütterung verscheucht, so beginnt es nach allen Richtungen des
Raumes pfeilschnell herumzuschwimmen, bis es sich wieder an einem Orte beruhigt. Zuweilen dreht es sich kreiselartig
an einem Platze oder aber um seine Längsachse. Seine Bewegungen können im strengen Sinne des
Wortes nicht als Schwimmen bezeichnet werden, da sie viel zu ungleichmässig sind und so zu sagen ruckweise
erfolgen. Bei solchen Bewegungen durchschiesst das Cyclidium blitzschnell eine Strecke, macht,
wenn auch eine ganz minimale Ruhepause und schiesst dann weiter, wobei mit jedem neuen Rucke die Richtung
fast immer verändert wird. An diesen Thierchen lässt sich die Bedeutung und Function der Fühlborste sehr
bequem beobachten, namentlich wenn in der Flüssigkeit noch andere Infusorien vorhanden sind. Der Körper
ist elastisch, formbeständig und farblos.
Cyclidium Glaucoma wurde zuerst von 0. F. Müller (48; pag. 80) und später von Ehrenberg
und P e rty beschrieben. Dujardin verwarf die gegebene Bezeichnung und beschrieb Cyclidien in den beiden
Gattungen Alyscum und Enchelys, was nur Verwirrung in der Nomenclatur hervorbrachte. Alle diese
Beschreibungen waren sehr mangelhaft. Die erste eingehende Schilderung wurde wieder von Claparede und
Lachmanri (13; pag. 271—273 und 276) geliefert. Jedoch begingen sie denselben Fehler wie bei Pleu-
ronema, indem sie die undulirende Membran verkannten und ihren hinteren Rand für eine bogenartig gekrümmte
Borste hielten. Stein (62; pag. 159) beschrieb die Gestalt des Peristoms ganz richtig und erkannte
die undulirende Membran, welche er jedoch nur an einem Peristomrande verlaufen liess.
23. Cyclidium Glaucoma variet. elongatum mihi.
Taf. VH. Fig. 97.
Dieses Thierchen bietet in seiner Organisation zu wenig Eigentümliches, als dass man es für eine
besondere Art betrachten könnte. Es .erinnert sehr an C. Glaucoma und weicht von demselben nur durch
unwesentliche Merkmale ab, aus welchem Grunde ich es bloss für eine Varietät erklären möchte. Es ist
das kleinste Infusor, das ich beobachtet habe und hat eine Länge von 0,016—0,02 mm bei einer Breite
von 0,006—0,007 mm.
Seine Gestalt ist länglich, fast ellipsoidal, am vorderen Körperende unbedeutend schmäler als am
hinteren und gleichmässig abgerundet; die Rückenseite ist schwach gewölbt, die Ventralseife abgeflacht. Das
Peristom ist bedeutend schmäler als bei C. Glaucoma und besitzt keine so starke Aushöhlung an der
linken Körperseite. Die undulirende Membran (m) ist breit, greift aber kaum auf den rechten Peristomrand
über, so dass die Membrantasche sehr flach erscheint. Die Körperstreifen stehen nicht so eng aneinander
wie bei C. Glauppma und verlaufen etwas schief nach hinten.
Die übrigen Organisationsverhältnisse, wie Bewimperung, Ectoplasma, Entoplasma, Mundöffnung,
After, contractile Vacuole und Kern entsprechen vollkommen denen der Stammart, so dass ich die Beschreibung
unterlassen kann. Auch die Lebenserscheinungen sind genau dieselben, welche ich bei C. Glaucoma
beschrieben habe.. Dieses Thierchen kommt ziemlich häufig in faulenden Infusionen vor und ist
immer in Gemeinschaft mit 0. Glaucoma anzutreffen. Ich konnte es mehrere Male beobachten.
24. Cyclidium citrullus Cohn spec.
Ke n t 38; pag. 545, Taf. XXVII, Fig. 59.
v an Rees 54; pag. i2—13, Taf. XVI, Fig. 5.
Synon: P le u ro n em a (Aiyscum) c itru llu s . Cohn 20; pag. 276—277, Taf. XV, Fig. 54.
Taf. VH. Fig. 98.
Sehr klein, jedoch bedeutend grösser als beide vorhergehenden Formen, von 0,028—0,042 mm
Länge und 0,018— 0,02 mm Breite. Körper oval, hinten abgerundet, nach vorne stark verengt und
gerade abgestutzt; das Vorderende an der Dorsalseite schwach ausgebuchtet. Die Ventralseite nicht
abgeflacht, sondern gewölbt, jedoch schwächer als die Rückenseite. Die allgemeine Gestalt etwas citronen-
ähnlich, wie schon von Cohn hervorgehoben wurde. Die Ventralseite ist durch ein langes, etwa 2/$ Körperlänge
erreichendes Peristom ausgehöhlt; dasselbe ist ziemlich eng und hinten nach links ausgebuchtet, jedoch
schwächer als bei C. Glaucoma typ. und stärker als bei der Varietät elongatum. Der liiike Peristomrand
ist noch ausserdem in der vorderen Region schwach ausgehöhlt, so dass er einen welligen Verlauf
nimmt; der rechte Peristomrand erscheint vollkommen gerade.
Der Körper ist mit sehr langen, dünnen, borstenähnlichen Cilien bedeckt. Am vorderen Körperende
stehen sie sehr dicht beisammen Und werden nach hinten zu allmählich spärlicher; das äusserste Hinterende
ist nackt und trägt eine lange F ü h lb o rste (b). Die Cilien stehen auf kleinen Papillen, welche in Längsreihen
angeordnet sind. Die Längsstreifen verlaufen wie bei C. Glaucoma, nur sind die Abstände zwischen
ihnen verhältnissmässig viel grösser, so dass ihre Zahl eine geringere ist (circa 14^.6).
Das E c to p la sm a (ek) ist dünn, anscheinend homogen. Das Entoplasma ist feinkörnig-netzig
und enthält zahlreiche stark lichtbrechende Körperchen.
Die Lage und Gestalt der Mundöffnung (o).und des Schlundes sind vollkommen dieselben wie
bei C. Glaucoma., Dagegen erinnert die u n d ulirende Membran (m) viel mehr an die Verhältnisse,
welche wir bei Pleuronema fanden; sie beginnt .gleichfalls am vorderen Körperende, zieht am linken
Peristomrande nach hinten und biegt auf den rechten Peristomrand um, wobei sie bedeutend weiter nach
vorn reicht als bei C. Glaucoma. Somit erscheint auch der membranöse Sack viel tiefer als bei der
vorigen Art, jedoch unbedeutend flacher als bei Pleuronema. Die ganze Membran ist deutlich quergestreift.
Am rechten Peristomrande sind lange borstenartige Cilien befestigt, welche nach dem Innenraum des Peristoms
gekehrt sind.
Der After (a) liegt auf der Ventralseite und ziemlich weit von der Ansatzstelle der Fühlborste