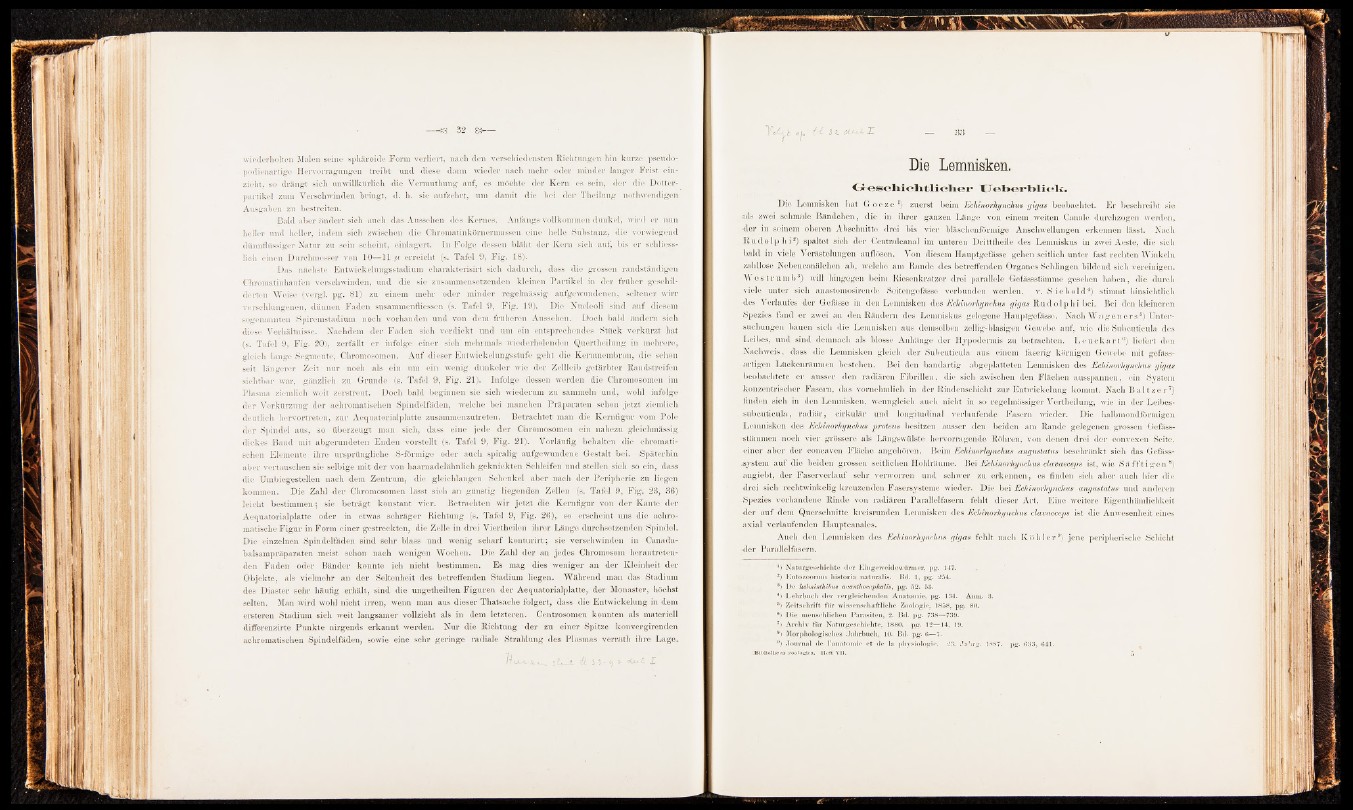
■wiederholten Malen seine sphäroide Form verliert, nach den verschiedensten Richtungen hin kurze .pseudopodienartige
Hervorragungen treibt und diese dann wieder nach mehr oder minder langer Frist einzieht,
so drängt sich unwillkürlich die Vermuthung auf, es möchte der Kern es sein, der die Dotterpartikel
zum Verschwinden bringt, d.--S» sie aufzehrt, um damit die bei der Theilung notwendigen
Ausgaben zu bestreiten.
Bald aber ändert sich auch das Aussehen des Kernes. Anfangs vollkommen dunkel, wird er nun
heller und heller, indem sich zwischen die Chromatinkörnermassen eine helle Substanz, die vorwiegend
dünnflüssiger Natur zu sein scheint, einlagert. In Folge dessen bläht der Kern sich auf, bis er schliesslich
einen Durchmesser von 10—11./« erreicht (s. Tafel 9, Fig. 18).
Das nächste Entwickelungsstadium charakterisirt sich dadurch, dass die grossen randständigen
Chromatinhaufen verschwinden, und die sie zusammensetzenden kleinen Partikel' in der früher geschilderten
Weise (vergl. pg. 81) zu einem mehr oder minder regelmässig aufgewundenen, seltener Avirr
verschlungenen, dünnen Faden susammenfliessen (s. Tafel 9, Fig. 19). Die Nucleoli sind auf diesem
sogenannten Spiremstadium noch vorhanden und von dem früheren Aussehen. Doch bald ändern sich
diese Verhältnisse. Nachdem der Faden sich verdickt und um ein entsprechendes Stück verkürzt hat
(s. Tafel 9, Fig. 20), zerfällt er infolge einer sich mehrmals Aviederholenden Querthcilung in mehrere,
gleich lange Segmente, Chromosomen. Auf dieser Entwickelungsstufe geht die Kernmembran, die schon
seit längerer Zeit nur noch als ein um ein wenig dunkeier Avie der Zellleib gefärbter Randstreifen
sichtbar Avar, gänzlich zu Grunde (s. Tafel 9, Fig. 21). Infolge dessen werden die Chromosomen im
Plasma ziemlich weit zerstreut. Doch bald beginnen sie sich wiederum zu sammeln und, wohl infolge
der Verkürzung der achromatischen Spindelfäden, Avelche bei manchen Präparaten schon jetzt ziemlich
deutlich hervortreten, zur Aequatorialplatte zusammenzutreten. Betrachtet man die Kernfigur vom Pole
der Spindel aus, so überzeugt man sich, dass eine jede der Chromosomen ein nahezu gleichmässig
dickes Band mit abgerundeten Enden vorstellt (s. Tafel 9, Fig. 21). Vorläufig behalten die chromatischen
Elemente ihre ursprüngliche S-förmige oder auch spiralig aufgewundene Gestalt bei. Späterhin
aber vertauschen sie selbige mit der von haarnadelähnlich geknickten Schleifen und stellen sich so ein, dass
die Umbiegestellen nach dem Zentrum, die gleichlangen Schenkel aber nach der Peripherie zu liegen
kommen. Die Zahl der Chromosomen lässt sich an günstig liegenden Zellen (s. Tafel 9, Fig. 23, 36)
leicht bestimmen ;; sie beträgt konstant vier. Betrachten wir jetzt die Kernfigur von der Kante der
Aequatorialplatte oder in etwas schräger Richtung (s. Tafel 9, Fig. 26), so erscheint uns die achromatische
Figur in Form einer gestreckten, die Zelle ifi drei Viertheilen ihrer Länge durchsetzenden Spindel.
Die einzelnen Spindelfäden sind sehr blass und wenig scharf konturirt; sie verschwinden in Canada-
balsampräparaten meist schon nach Avenigen Wochen. Die Zahl der an jedes Chromosom heran tretenden
Fäden oder Bänder konnte ich nicht bestimmen. Es mag dies weniger an der Kleinheit der
Objekte, als vielmehr an der Seltenheit des betreffenden Stadium liegen. Während man das Stadium
des Diaster sehr häufig erhält, sind die ungetheilten Figuren der Aequatorialplatte, der Monaster, höchst
selten. Man wird wohl nicht irren, Avenn man aus dieser Thatsache folgert, dass die EntAvickelung- in dem
ersteren Stadium sich weit langsamer vollzieht als in dem letzteren. Centrosomen konnten als materiell
differenzirte Punkte nirgends erkannt werden. Nur die Richtung der zu einer Spitze konvergirenden
achromatischen Spindelfäden, sowie eine sehr geringe radiale Strahlung des Plasmas verräth ihre Lage.
Die Lemnisken.
Creseliichtlicher Ueberblick.
Die Lemnisken hat G o e z e 1) zuerst beim Echinorliynclius gigas beobachtet. Er beschreibt sie
iils zwei schmale Bändchen, die in ihrer ganzen Länge von einem weiten Canale durchzogen averden^
-der in seinem oberen Abschnitte drei bis A7ier bläschenförmige Anschwellungen erkennen lässt. Nach
R u d o l p h i 2) spaltet sich der Centralcanal im unteren Dritttheile des Lemniskus in zwei Aeste, die sich
bald in A’iele Verästelungen auflösen. Von diesem Hauptgefässe gehen seitlich unter fast rechten Winkeln
zahllose Nebencanälchen ab, Avelche am Rande des betreffenden Organes Schlingen bildend sich vereinigen.
W e s t r u m b 3) Avill hingegen beim Riesenkratzer drei parallele Gefässstämme gesehen haben, die durch
A’ielc unter sich anastomosirende Seitengefässe verbunden werden, v. S ie b o ld 4) stimmt hinsichtlich
des Verlaufes der Gefässe in den Lemnisken des Echinorhynchus gigas R u d o lp h i bei. Bei den kleineren
Spezies fand er zwei an den Rändern des Lemniskus gelegene Hauptgefässe. Nach W ag e n e r s 5) Untersuchungen
bauen sich die Lemnisken aus demselben zeilig-blasigen Gewebe auf, Avie die Subcuticula des
Leibes, und sind demnach als blosse Anhänge der Hypodermis zu betrachten. L e u c k a r t 8) liefert den
Nachweis, dass die Lemnisken gleich der Subcuticula aus einem faseiig, körnigen Gewebe mit gefäss-
artigen Lückenräumen bestehen. Bei den bandartig abgeplatteten Lemnisken des Echinorhynchus gigas
beobacl itete er ausser den radiären Fibrillen,* die sich zivischen den Flächen ausspannen, ein System
konzentrischer Fasern, das A'ornehmlich in der Rindenschicht zur EntAvickelung kommt. Nach B a i t z e r 7)
finden sich in den Lemnisken, Avenngleich auch nicht in so regelmässiger Verteilung, Avie in der Leibessubcuticula,
radiär, cirkulär und longitudinal A-erlauiende Fasern AA'ieder. Die halbmondförmigen
Lemnisken des Echinorhynchus proteus besitzen ausser den beiden am Rande gelegenen grossen Gefäss-
■stämmen nöch vier grössere als Längs wülste hervorragende Röhren, von denen drei der convexen Seite,
einer aber der concaven Fläche angehören. Beim Echinorhynchus angustatus beschränkt sich das Gefäss-
-system auf die beiden grossen seitlichen Hohlräume. Bei Echinorhynchus davaeceps ist, wie S ä f f t i g e n 8)
augiebt, der Faserverlauf sehr verworren und schwer zu erkennen, es finden sich aber auch hier die
drei sich rechtAvinkelig kreuzenden Fasersysteme wieder. Die bei Echinorhynchus angustatus und anderen
Spezies vorhandene Rinde von radiären Parallelfasern fehlt dieser Art. Eine Aveitere Eigentümlichkeit
■der auf dem Querschnitte kreisrunden Lemnisken des Echinorhynchus clavacceps ist die Auivesenheit eines
-axial A'erlaufenden Hauptcanales.
Auch den Lemnisken des Echinorhynchus gigas fehlt nach K ö h l e r 9) jene peripherische Schicht
der Parallelfasern.
') Naturgeschichte der Eiivgeweidewtirmer. pg. 147.
- 2) Entozoorum historia natnralis. Bd. 1, pg. 254.
| l Lehrbuch der A’ergleichenden Anatomie, pg. 134. Anm. 3.
6) Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie, 1858, pg. 80. .
6) Die menschlichen Parasiten, 2. Bd. pg. 738—739.
7) Archiv für Naturgeschichte, 1880. ■ pg. 12—14, 19.
8) Morphologisches Jahrbuch,. 10. Bd. pg. 6—7.1 1
#) Journal de ¡’anatomie et de ln phvsiologie. Jahrg. 1887. pg. 633, 641.