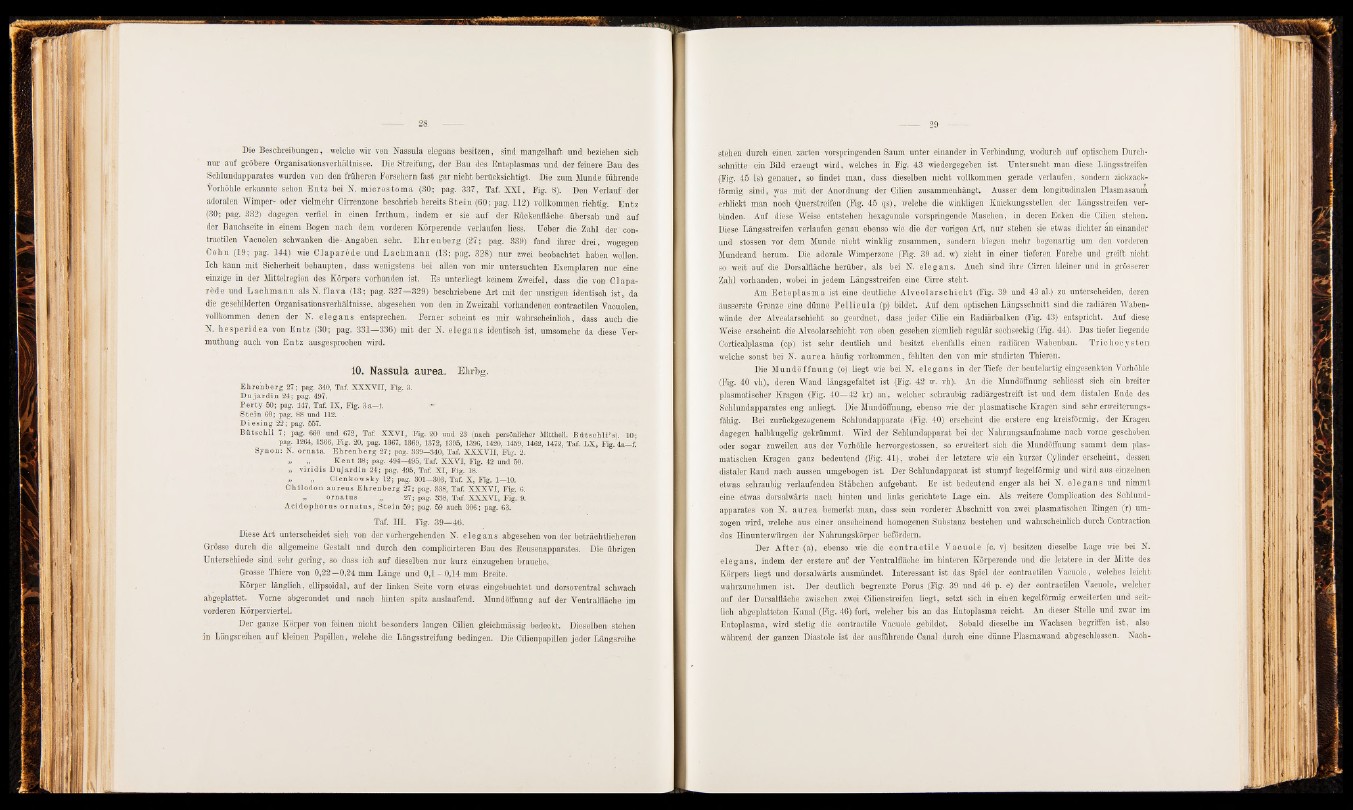
Die Beschreibungen, welche wir von Nassula elegans besitzen, sind mangelhaft und beziehen sich
nur auf gröbere Organisationsverhältnisse. Die Streifung, der Bau des Entoplasmas und der feinere Bau des
Schlundapparates wurden von den früheren Forschern fast gar nicht berücksichtigt. Die zum Munde führende
Vorhöhle erkannte schon Entz bei N. microstoma (30; pag. 337, Taf. XXI, Fig. 8), Den Verlauf der
ädoralen Wimper- oder vielmehr Cirrenzone beschrieb bereits S te in (60; pag. 112) vollkommen richtig. Entz
(30; pag. 332) dagegen verfiel in einen Irrthum, indem er sie auf der Rückenfläche, übersah und auf
der Bauchseite in einem Bogen nach dem vorderen Körperende verlaufen liess. Heber die Zahl der con-
tractilen Vacuolen schwanken die-Angaben sehr. E h ren b e rg (27; pag. 339) fand ihrer drei, wogegen
Cohn (19; pag. 144) wie Claparede und Lachmann (13; pag, 328) nur zwei beobachtet haben wollen.
Ich kann mit Sicherheit behaupten, dass wenigstens bei allen von mir untersuchten Exemplaren nur eine
einzige in der Mittelregion des Körpers vorhanden ist. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die von Clapa-
röde und Lachmann als N. flava (13; pag. 327—329) beschriebene Art mit der unsrigen identisch ist, da
die geschilderten Organisationsverhältnisse, abgesehen von den in Zweizahl vorhandenen contractilen Vacuolen,
vollkommen denen der K. elegans entsprechen. Ferner scheint es mir wahrscheinlich, dass auch die
N. h e sp e rid e a von Entz (30; pag. 331—336) mit der N. elegans identisch ist, umsomehr da diese Ver-
muthung auch von Entz ausgesprochen wird.
10. Nassula aurea. Ehrbg.
Ehrenberg 27; pag. 340, Taf. XXXVII, Fig. 3.
D u j a rd in 24; pag. 497.
Perty 50; pag. 147, Taf. IX, Fig. 3 a— f. •-
Stein 60; pag. 88 und 112. .
Diesing 22; pag. 557.
Bütschli 7; pag. 660 und 672, Taf. XX VI , Fig. 20 und 23 (nach persönlicher Mittheil, ßütschli’s). 10;
pag. 1264, 1366, Fig. 20, pag. 1367, 1369, 1372, 1395, 1396, 1420, 1459, 1462, 1472, Taf. LX, Fig. 4a— f.
Synon: N. ornata. Ehrenberg 27; pag. 339— 340, Taf. XXXVII, Fig. 2.
„ „ Ke nt 38; pag. 494— 495, Taf. XXVI, Fig. 42 und 50.
,i viridis Dujardin 24; pag. 495, Taf. XI, Fig. 18.
H ” Cienkowsky 12; pag. 301— 303, Taf. X, Fig. 1— 10.
Chilodön aureus Ehrenberg 27; pag. 338, Taf. X X X V I , Fig. 6'.
„ ornatus „ 27; pag. 338, Taf. X X X V I , Fig. 9.
Acidophorus ornatus, Stein 59; pag. 59 auch 306; pag. 63.
Taf. ID. Fig. 39—46.
Diese Art unterscheidet sich von der vorhergehenden N. e leg an s abgesehen von der beträchtlicheren
Grösse durch die allgemeine Gestalt und durch den complicirteren Bau des Reusenapparates. Die übrigen
Unterschiede sind sehr gering, so dass ich auf dieselben nur kurz einzugehen brauche.
Grosse Thiere von 0,22—0,24 mm Länge und 0,1-0,14 mm Breite.
Körper länglich, ellipsoidal, auf der linken Seite vorn etwas eingebuchtet und dorsoventral schwach
abgeplattet. Vorne abgerundet und nach hinten spitz auslaufend. Mundöffnung auf der Ventralfläche im
vorderen Körperviertel.
Der ganze Körper von feinen nicht besonders langen Cilien gleichmässig bedeckt. Dieselben stehen
in Längsreihen auf kleinen Papillen, welche die Längsstreifung bedingen. Die Cilienpapillen jeder Längsreihe
stehen durch einen zarten vorspringenden Saum unter einander in Verbindung, wodurch auf optischem Durchschnitte
ein Bild erzeugt wird, welches in Fig. 43 wiedergegeben ist. Untersucht man diese Längsstreifen
(Fig. 45 ls) genauer, so findet man, dass dieselben nicht vollkommen gerade verlaufen, sondern zickzackförmig
sind, was mit der Anordnung der Cilien zusammenhängt. Ausser dem longitudinalen Plasmasaum
erblickt man noch Querstreifen (Fig. 45 qs), welche die winkligen Knickungsstellen der Längsstreifen verbinden..
Auf diese Weise entstehen hexagonale vorspringende Maschen, in deren Ecken die Cilien stehen.
Diese Längsstreifen verlaufen genau ebenso wie die der vorigen Art, nur stehen ‘sie etwas dichter an einander
und stossen vor dem Munde nicht winklig zusammen, sondern biegen mehr bogenartig um den vorderen
Mundrand herum. Die adorale Wimperzone (Fig.’ 39 ad.. w) zieht in einer tieferen Furche und greift nicht
so weit auf die Dorsalfläche herüber, als bei N. elegans. Auch sind ihre Cirren kleiner und in grösserer
Zahl vorhanden, wobei in jedem Längsstreifen eine Cirre steht.
Am E ctoplasma ist eine deutliche Alveolarschicht (Fig. 39 und 43 al.) zu unterscheiden, deren
äusserste Grenze eine dünne P e llic u la (p) bildet. Auf dem optischen Längsschnitt sind die radiären Wabenwände
der Alveolarschicht so geordnet, dass jeder Cilie ein Radiärbalken (Fig. 43) entspricht. Auf diese
Weise erscheint die Alveolarschicht von oben gesehen ziemlich regulär sechseckig (Fig. 44). Das tiefer liegende
Corticalplasma (cp) ist sehr deutlich und besitzt ebenfalls einen radiären Wabenbaji. Trichocysten
welche sonst bei N. au re a häufig Vorkommen, fehlten den von mir studirten Thieren.
Die Mundöffnung (o) liegt wie bei N. elegans in der Tiefe der beutelartig eingesenkten Vorhöhle
(Fig. 40 vh), deren Wand längsgefaltet ist (Fig. 42 w. vh). An die Mundöffnung schliesst sich ein breiter
plasmatischer Kragen (Fig. 40—42 kr) an, welcher schraubig radiärgestreift ist und dem distalen Ende des
Schlundapparates eng anliegt. Die Mundöfinung, ebenso wie der plasmatische Kragen sind sehr erweiterungsfähig.
Bei zurückgezogenem Schlundapparate (Fig. 40) erscheint die erstere eng kreisförmig, der Kragen
dagegen halbkugelig gekrümmt. Wird der Schlundapparat bei der Nahrungsaufnahme nach vorne geschoben
oder sogar zuweilen aus der Vorhöhle hervorgestossen, so erweitert sich die Mundöffnung sammt dem plasmatischen
Kragen ganz bedeutend (Fig. 41), wobei der letztere wie ein kurzer Cylinder erscheint, dessen
distaler. Rand nach aussen umgebogen ist. Der Schlundapparat ist stumpf kegelförmig und wird aus einzelnen
etwas schraubig verlaufenden Stäbchen aufgebaut. Er ist bedeutend enger als bei N. eleg an s und nimmt
eine etwas dorsalwärts nach hinten und links gerichtete Lage ein. Als weitere Complication des Schlundapparates
von N. au re a bemerkt man, dass sein vorderer Abschnitt von zwei plasmatischen Ringen (r) umzogen
wird, welche aus einer anscheinend homogenen Substanz bestehen und wahrscheinlich durch Contraction
das Hinunterwürgen der Nahrungskörper befördern.
Der After-(a), ebenso wie die co n tra c tile Vacuole' (c. v) besitzen dieselbe Lage wie bei N.
elegans, indem der erstere auf der Ventralfläche im hinteren Körperende und die letztere in der Mitte des
Körpers liegt und dorsalwärts ausmündet. Interessant ist das Spiel der contractilen Vacuole, welches leicht
wahrzunehmen ist. Der deutlich begrenzte Porus (Fig. 39 und 46 p. e) der contractilen Vacuole, welcher
auf der Dorsalfläche zwischen zwei Cilienstreifen liegt, setzt sich in einen kegelförmig erweiterten und seitlich
abgeplatteten Kanal (Fig. 46) fort, welcher bis an das Entoplasma reicht. An dieser Stelle und zwar im
Entoplasma, wird stetig die contractile Vacuole gebildet. Sobald dieselbe im Wachsen begriffen ist, also
während der ganzen Diastole ist der ausführende Canal durch eine dünne Plasmawand abgeschlossen. Nach