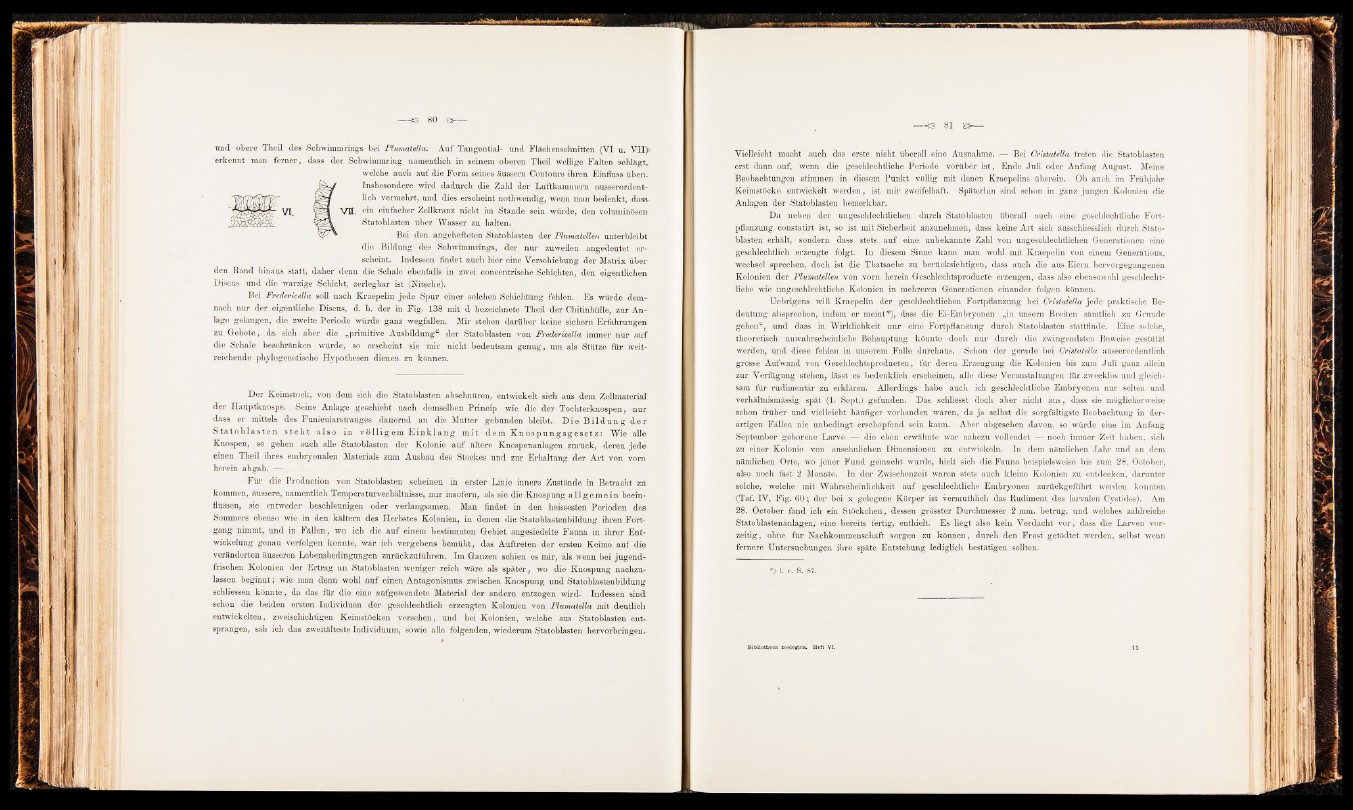
und obere Theil des Schwimmrings bei Plumatella. Auf Tangential- lind Flächenschnitten (VI u. VII>
erkennt man ferner, dass der Schwimmring namentlich in seinem oberen Theil wellige Falten schlägt,.
welche auch auf die Form seines äussern Contours ihren Einfluss üben.
Insbesondere wird dadurch die Zahl der Luftkammern ausserordentlich
vermehrt, und dies erscheint nothwendig, wenn man bedenkt, dass-
VI. |§ 3 VII. ein einfacher Zellkranz nicht im Stande sein würde, den voluminösen
Statoblasten über Wasser zu halten.
Bei den angehefteten Statoblasten der PlumateUen unterbleibt
die Bildung des Schwimmrings, der nur zuweilen angedeutet erscheint.
Indessen findet auch hier eine Verschiebung der Matrix über
den Band hinaus statt, daher denn die Schale ebenfalls in zwei concentrische Schichten, den eigentlichen
Discus und die warzige Schicht, zerlegbar ist (Nitsche).
Bei Fredericella soll nach Kraepelin jede Spur einer solchen Schichtung fehlen. Es würde demnach
nur der eigentliche Discus, d. h. der in Fig. 138 mit d bezeichnete Theil der Chitinhülle, zur Anlage
gelangen, die zweite Periode würde ganz wegfallen. Mir stehen darüber keine sichern Erfahrungen
zu Gebote, da sich aber die „primitive Ausbildung“ der Statoblasten von Fredericella immer nur auf
die Schale beschränken würde, so erscheint sie mir nicht bedeutsam genug, um als Stütze für weitreichende
phylogenetische Hypothesen dienen zu können.
Der Keimstock, von dem sich die Statoblasten abschnüren, entwickelt sich aus dem Zellmateria!
der Hauptknospe. Seine Anlage geschieht nach demselben Princip wie die der Tochterknospen, nur
dass er mittels des Funicularstranges dauernd an die Mutter gebunden bleibt. D ie B i l d u n g d e r
S t a t o b l a s t e n s t e h t al so in vö l l i g e m E i n k l a n g m i t dem Kn o s p u n g s g e s e t z : Wie alle
Knospen, so gehen auch alle Statoblasten der Kolonie auf ältere Knospenanlagen zurück, deren jede
einen Theil ihres embryonalen Materials zum Ausbau des Stockes und zur Erhaltung der Art von vom
herein abgab. —
Für die Production von Statoblasten scheinen in erster Linie innere Zustände in Betracht zu
kommen, äussere, namentlich Temperaturverhältnisse, nur insofern, als sie die Knospung a l l g eme i n beeinflussen,
sie entweder beschleunigen oder verlangsamen. Man findet in den heissesten Perioden des
Sommers ebenso wie in den kältern des Herbstes Kolonien, in denen die Statoblastenbildung ihren Fortgang
nimmt, und in Fällen, wo ich die auf einem bestimmten Gebiet angesiedelte Fauna in ihrer Entwickelung
genau verfolgen konnte, war ich vergebens bemüht, das Auftreten der ersten Keime auf die
veränderten äusseren Lebensbedingungen zurückzuführen. Im Ganzen schien es mir, als wenn bei jugendfrischen
Kolonien der Ertrag an Statoblasten weniger reich wäre als später, wo die Knospung nachzulassen
beginnt; wie man denn wohl auf einen Antagonismus zwischen Knospung und Statoblastenbildung
schliessen könnte, da das für die eine aufgewendete Material der ändern entzogen wird. Indessen sind
schon die beiden ersten Individuen der geschlechtlich erzeugten Kolonien von Plumatella mit deutlich
entwickelten, zweischichtigen Keimstöcken versehen, und bei Kolonien, welche aus Statoblasten entsprangen,
sah ich das Zweitälteste Individuum, sowie alle folgenden, wiederum Statoblasten hervorbringen-
Vielleicht macht auch das erste nicht überall eine Ausnahme. — Bei Cristatella treten die Statoblasten
erst dann auf, wenn die geschlechtliche Periode vorüber ist, Ende Juli oder Anfang August. Meine
Beobachtungen stimmen in diesem Punkt völlig mit denen Kraepelins überein. Ob auch im Frühjahr
Keimstöcke entwickelt werden, ist mir zweifelhaft. Späterhin sind schon in ganz jungen Kolonien die
Anlagen der Statoblasten bemerkbar.
Da neben der ungeschlechtlichen durch Statoblasten überall auch eine geschlechtliche Fortpflanzung
constatirt ist, so ist mit Sicherheit anzunehmen, dass keine Art sich ausschliesslich durch Statoblasten
erhält, sondern dass stets auf eine unbekannte Zahl von ungeschlechtlichen Generationen eine
geschlechtlich erzeugte folgt. In diesem Sinne kann man wohl mit Kraepelin von einem Generations.
Wechsel sprechen, doch ist die Thatsache zu berücksichtigen, dass auch die aus Eiern hervorgegangenen
Kolonien der Plumatellen von vorn herein Geschlechtsproducte erzeugen, dass also ebensowohl geschlechtliche
wie ungeschlechtliche Kolonien in mehreren Generationen einander folgen können.
Uebrigens will Kraepelin der geschlechtlichen Fortpflanzung bei Cristatella jede praktische Bedeutung
absprechen, indem er meint*), dass die Ei-Embryonen „in unsern Breiten sämtlich zu Grunde
gehen“, und dass in Wirklichkeit nur eine Fortpflanzung durch Statoblasten stattfinde. Eine solche,
theoretisch unwahrscheinliche Behauptung könnte doch nur durch die zwingendsten Beweise gestützt
werden, und diese fehlen in unserem Falle durchaus. Schon der gerade bei Cristatella ausserordentlich
grosse Aufwand von Geschlechtsproducten, für deren Erzeugung die Kolonien bis zum Juli ganz allein
zur Verfügung stehen, lässt es bedenklich erscheinen, alle diese Veranstaltungen für zwecklos und gleichsam
für rudimentär zu erklären. Allerdings habe auch ich geschlechtliche Embryonen nur selten und
verhältnismässig spät (1. Sept.) gefunden. Das schliesst doch aber nicht aus, dass sie möglicherweise
schon früher und vielleicht häufiger vorhanden waren, da ja selbst die sorgfältigste Beobachtung in derartigen
Fällen nie unbedingt erschöpfend sein kann. Aber abgesehen davon, so würde eine im Anfang
September geborene Larve — die eben erwähnte war nahezu vollendet — noch immer Zeit haben, sich
zu einer Kolonie von ansehnlichen Dimensionen zu entwickeln. In dem nämlichen Jahr und an dem
nämlichen Orte, wo jener Fund gemacht wurde, hielt sich die Fauna beispielsweise bis zum 28. October,
also noch fast 2 Monate. In der Zwischenzeit waren stets auch kleine Kolonien zu entdecken, darunter
solche, welche mit Wahrscheinlichkeit auf geschlechtliche Embryonen zurückgeführt werden konnten
(Taf. IV, Fig. 60; der bei x gelegene Körper ist vermuthlich das Rudiment des larvalen Cystides). Am
28. October fand ich ein Stöckchen, dessen grösster Durchmesser 2 mm. betrug, und welches zahlreiche
Statoblastenanlagen, eine bereits fertig, enthielt. Es liegt also kein Verdacht vor, dass die Larven vorzeitig,
ohne für Nachkommenschaft sorgen zu können, durch den Frost getödtet werden, selbst wenn
fernere Untersuchungen ihre späte Entstehung lediglich bestätigen sollten.
1 1 . c. S. 87.
Bibliotheca zoologica. Heft VI. 11