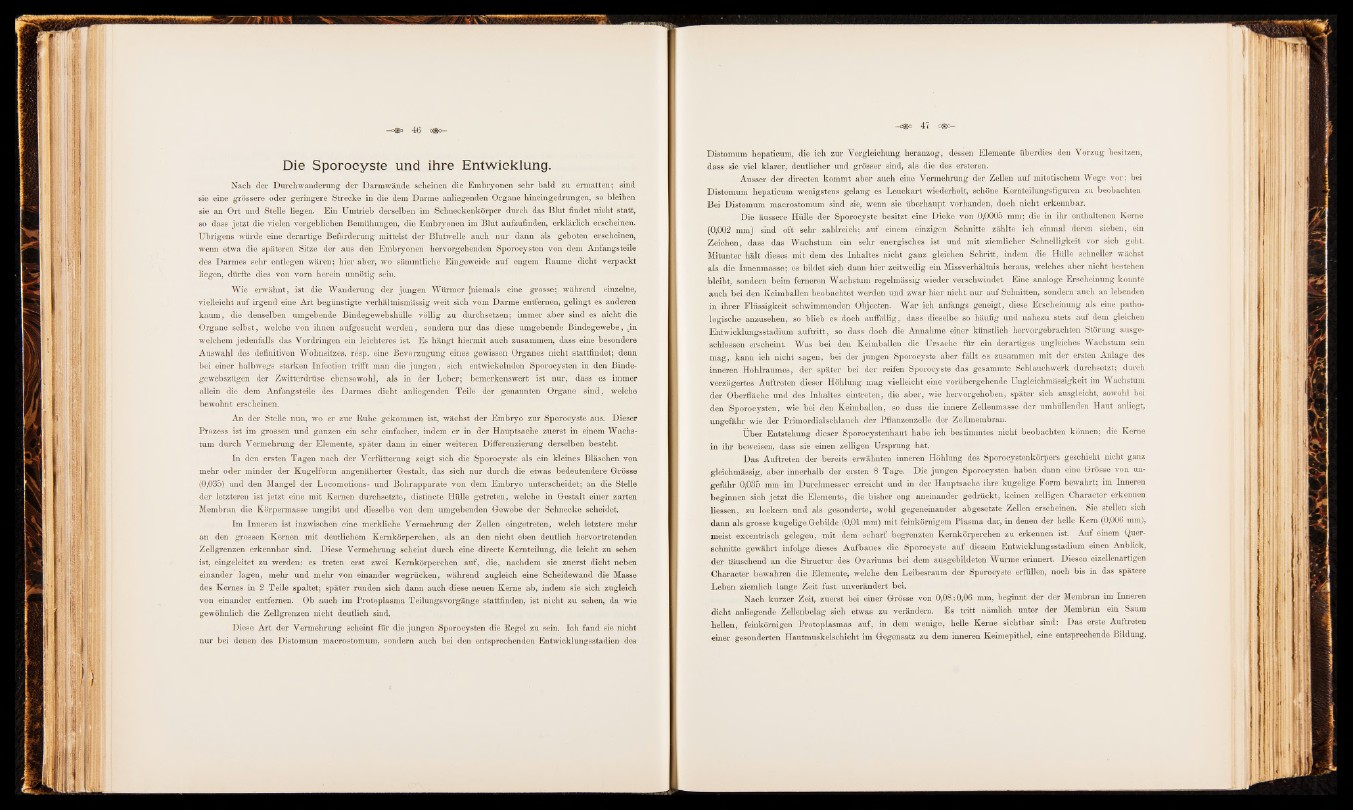
Die Sporoeyste und ihre Entwicklung.
Nach der Durchwanderung der Darm wände scheinen die Embryonen sehr bald zu ermatten; sind
sie eine grössere oder geringere Strecke in die dem Darme anliegenden Organe hineingedrungen, so bleiben
sie an Ort und Stelle liegen. Ein Umtrieb derselben im Schneckenkörper durch das Blut findet nicht statt,
so dass jetzt die vielen vergeblichen Bemühungen, die Embryonen im Blut aufzufinden, erklärlich erscheinen.
Übrigens würde eine derartige Beförderung mittelst der Blutwelle auch nur dann als geboten erscheinen,
wenn etwa die späteren Sitze der aus den Embryonen hervorgehenden Sporocysten von dem Anfangsteile
des Darmes sehr entlegen wären; hier aber, wo sämmtliche Eingeweide auf engem Raume dicht verpackt
liegen, dürfte dies von vorn herein unnötig sein.
Wie erwähnt, ist die Wanderung der jungen Würmer (niemals eine grosse;, während einzelne,
vielleicht auf irgend eine Art begünstigte verhältnismässig weit sich vom Darme entfernen, gelingt es anderen
kaum, die denselben umgebende Bindegewebshülle völlig zu durchsetzen; immer aber sind es nicht die
Organe selbst, welche von ihnen aufgesucht werden, sondern nur das diese umgebende Bindegewebe, jin
welchem jedenfalls das Vordringen ein leichteres ist. Es hängt hiermit auch zusammen, dass eine besondere
Auswahl des definitiven Wohnsitzes, resp. eine Bevox’zugung eines gewissen Organes nicht stattfindet; denn
bei einer halbwegs starken Infection trifft man die jungen, sich entwickelnden Sporocysten in den Binde-
gewebszügen der Zwitterdrüse ebensowohl, als in der Leber; bemerkenswert ist nur, dass es immer
allein die dem Anfangsteile des Darmes dicht anliegenden Teile der genannten Organe sind, welche
bewohnt erscheinen.
An der Stelle nun, wo er zur Ruhe gekommen ist, wächst der Embryo zur Sporoeyste aus. Dieser
Prozess ist im grossen und ganzen ein sehr einfacher, indem er in der Hauptsache zuerst in einem Wachstum
durch Vermehrung der Elemente, später dann in einer weiteren Differenzierung derselben besteht.
In den ersten Tagen nach der Verfütterung zeigt sich die Sporoeyste' als ein kleines Bläschen von
mehr oder minder der Kugelform angenäherter Gestalt, das sich nur durch die etwas bedeutendere Grösse
(0,035) und den Mangel der Locomotions- und Bohrapparate von dem Embryo unterscheidet; an die Stelle
der letzteren ist jetzt eine mit Kernen durchsetzte, distincte Hülle getreten, welche in Gestalt einer zarten
Membran die Körpermasse umgibt und dieselbe von dem umgebenden Gewebe der Schnecke scheidet.
Im Inneren ist inzwischen eine merkliche Vermehrung der Zellen eingetreten, welch letztere mehr
an den grossen Kernen mit deutlichem Kernkörperchen, als an den nicht eben deutlich hervortretenden
Zellgrenzen erkennbar sind. Diese Vermehrung scheint durch eine directe Kernteilung, die leicht zu sehen
ist, eingeleitet zu werden; es treten erst zwei Kemkörperchen auf, die, nachdem sie zuerst dicht neben
einander lagen, mehr und mehr von einander wegrücken, während zugleich eine Scheidewand die Masse
des Kernes in 2 Teile spaltet; später runden sich dann auch diese neuen Kerne ab, indem sie sich zugleich
von einander entfernen. Ob auch im Protoplasma Teilungsvorgänge stattfinden, ist nicht zu sehen, da wie
gewöhnlich die Zellgrenzen nicht deutlich sind.
Diese Art der Vermehrung scheint für die jungen Sporocysten die Regel zu sein. Ich fand sie nicht
nur bei denen des Distomum macrostomum, sondern auch bei den entsprechenden Entwicklungsstadien des
Distomum hepaticum, die ich zur Vergleichung heranzog, dessen Elemente überdies den Vorzug besitzen,
dass sie viel klarer, deutlicher und grösser sind, als die des ersteren.
Ausser der directen kommt aber auch eine Vermehrung der Zellen auf mitotischem Wege vor; bei
Distomum hepaticum wenigstens gelang es Leuckart wiederholt, schöne Kernteilungsfiguren zu beobachten
Bei Distomum macrostomum sind sie, wenn sie überhaupt vorhanden, doch nicht erkennbar.
Die äussere Hülle der Sporoeyste besitzt eine Dicke von 0,0005 mm; die in ihr enthaltenen Kerne
(0,002 mm) sind oft sehr zahlreich; auf einem einzigen Schnitte zählte ich einmal deren sieben, ein
Zeichen, dass das Wachstum ein sehr energisches ist und mit ziemlicher Schnelligkeit vor sich geht.
Mitunter hält dieses mit dem des Inhaltes nicht ganz gleichen Schritt, indem die Hülle schneller wächst
als die Innenmasse; es bildet sich dann hier zeitweilig ein Missverhältnis heraus, welches aber nicht bestehen
bleibt, sondern beim ferneren Wachstum regelmässig wieder verschwindet. Eine analoge Erscheinung konnte
auch bei den Keimballen beobachtet werden und zwar hier nicht nur auf Schnitten, sondern’auch an lebenden
in ihrer Flüssigkeit schwimmenden Objecten. War ich anfangs geneigt, diese Erscheinung als eine pathologische
anzusehen, so blieb es doch auffällig, dass dieselbe so häufig und nahezu stets auf dem gleichen
Entwicklungsstadium auftritt, so dass doch die Annahme einer künstlich hervorgebrachten Störung ausgeschlossen
erscheint;. Was bei den Keimballen die Ursache für ein derartiges ungleiches Wachstum sein
mag, kann ich nicht sagen, bei der jungen Sporoeyste aber fällt es zusammen mit der ersten Anlage des
inneren Hohlraumes, der später bei der reifen Sporoeyste das gesammte Schlauchwerk durchsetzt; durch
verzögertes Auftreten dieser Höhlung mag vielleicht eine vorübergehende Ungleichmässigkeit im Wachstum
der Oberfläche und des Inhaltes eintreten, die aber, wie hervorgehoben, später sich ausgleicht, sowohl bei
den Sporocysten, wie bei den Keimballen, so dass die innere Zellenmasse der umhüllenden Haut anliegt,
ungefähr wie der Primordialschlauch der Pflanzenzelle der Zellmembran.
Über Entstehung dieser Sporocystenhaut habe ich bestimmtes nicht beobachten können; die Kerne
in ihr beweisen, dass sie einen zelligen Ursprung hat.
Das Auftreten der bereits erwähnten inneren Höhlung des Sporocystenkörpers geschieht nicht ganz
gleichmässig, aber innerhalb der ersten 8 Tage. Die jungen Sporocysten haben dann eine Grösse von ungefähr
0,035 mm im Durchmesser erreicht und in der Hauptsache ihre kugelige Form bewahrt; im Inneren
beginnen sich jetzt die Elemente, die bisher eng aneinander gedrückt, keinen zelligen Character erkennen
Hessen, zu lockern und als gesonderte, wohl gegeneinander abgesetzte Zellen erscheinen. Sie steUen sich
dann als grosse kugeHge Gebilde (0,01 mm) mit feinkörnigem Plasma dar, in denen der helle Kern (0,006 mm),
meist excentrisch gelegen, mit dem scharf begrenzten Kernkörperchen zu erkennen ist. Auf einem Querschnitte
gewährt infolge dieses Aufbaues die Sporoeyste auf diesem Entwicklungsstadium einen AnbHck,
der täuschend an die Structur des Ovariums bei dem ausgebildeten Wurme erinnert. Diesen eizeUenartigen
Character bewahren die Elemente, welche den Leibesraum der Sporoeyste erfüllen, noch bis in das spätere
Leben ziemHch lange Zeit fast unverändert bei.
Nach kurzer Zeit, zuerst bei einer Grösse von 0,08:0,06 mm, beginnt der der Membran im Inneren
dicht anHegende Zellenbelag sich etwas zu verändern. Es tritt nämHch unter der Membran ein Saum
hellen, feinkörnigen Protoplasmas auf, in dem wenige, helle Kerne sichtbar sind: Das erste Auftreten
einer gesonderten Hautmuskelschicht im Gegensatz zu dem inneren Keimepithel, eine entsprechende Bildung,