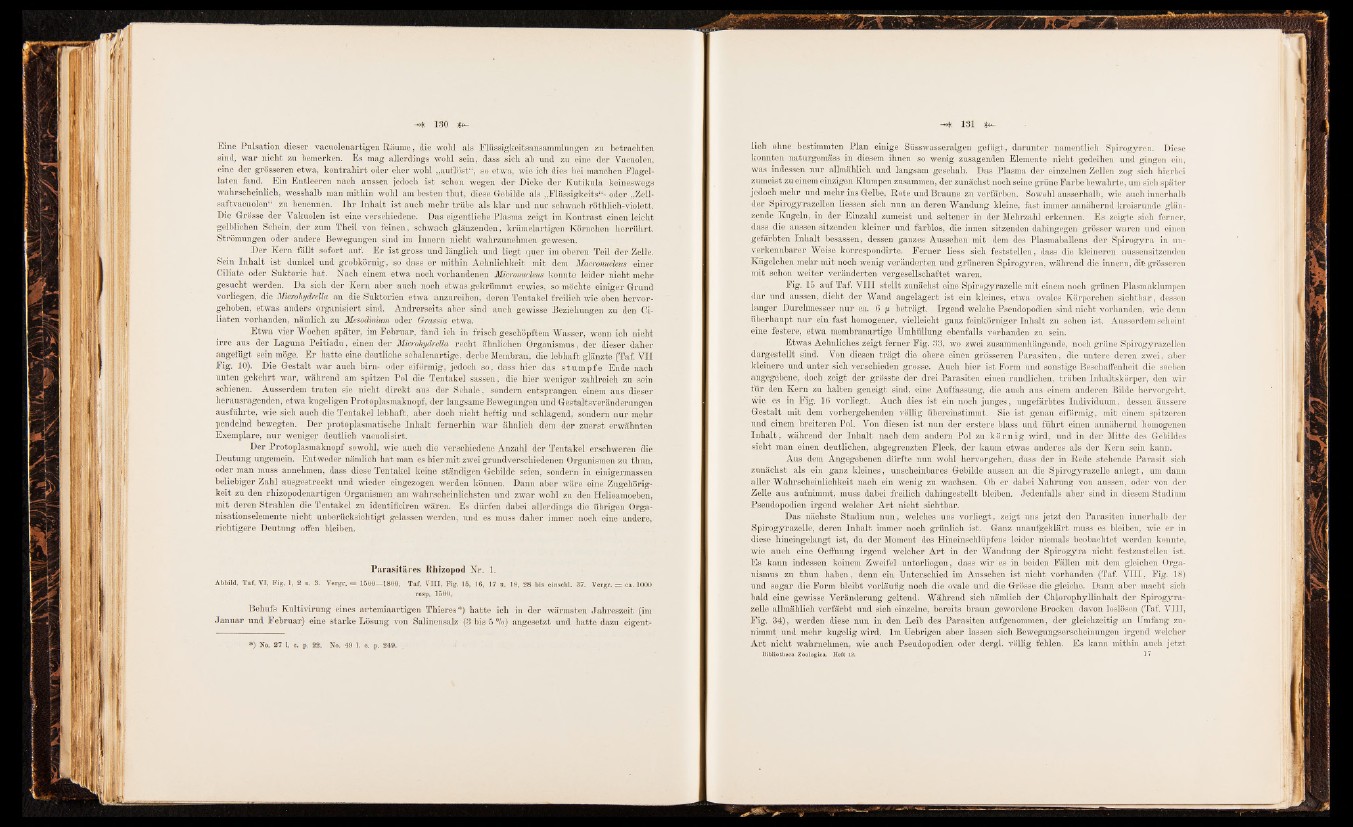
Eine Pu lsatio n dieser vacuolenartigen Räum e, die wohl als Flüssigkeitsansammlungen zu betrachten
sind, w a r n ic h t zu bemerken. Es mag allerdings wohl sein, dass sich ab und zu eine der Vacuolen,
eine d e r grösseren etwa, k o n tra h irt oder eher wohl „ auflöst“ , so etwa, wie ich dies bei manchen F lag e lla
ten fand. E in E ntlee ren nach aussen jedoch is t schon wegen der Dicke d e r K u tik u la keineswegs
wahrscheinlich, wesshalb man mithin wohl am besten th u t, diese-Gebilde als „Flüssigkeits“ - oder „Zell-
saftvacuolen“ zu benennen. I h r In h a lt is t auch mehr trü b e als k la r und n u r schwach röthlich-violett.
Die Grösse d e r Vakuolen is t eine verschiedene. Das eigentliche Plasma ze igt im K o n tra s t einen leicht
gelblichen Schein, d e r zum Theil von feinen, schwach glänzenden, k rüme lartigen Körnchen h e rrü h rt.
Strömungen oder andere Bewegungen sind im In n e rn n ich t wahrzunehmen gewesen.
D e r K e rn fä llt so fo rt auf. E r is tg ro s s und länglich und lieg t quer im oberen Teil der Zelle.
Sein In h a lt is t dunkel und grob kö rn ig , so dass e r mithin Aehnlichkeit m it dem Macronucleus einer
Ciliate oder Suktorie h at. Nach einem etwa noch vorhandenen Micronucleus konnte leider n ich t mehr
g esucht werden. D a sich d e r Kern abe r auch noch etwas gekrümmt erwies, so möchte einiger Grund
vorliegen, die Microhydrella an die Suktorien etwa anzureihen, deren T en tak el freilich wie oben h e rv o rgehoben,
etwas anders o rg an isiert sind. Andrerseits aber sind auch gewisse Beziehungen zu den Cilia
te n vorhanden, nämlich zu Mesodinium oder Grassia etwa.
E tw a v ie r Wochen sp äte r, im F eb ru a r, fand ich in frisch geschöpftem Wasser, wenn ich nich t
i r r e aus d e r Lag u n a P e itiad u . einen d e r Microhydrella re ch t ähnlichen Organismus, d e r dieser daher
angefügt sein möge. E r h a tte eine deutliche schalenartige, derbe Membran, die leb h a ft glänzte (Taf. V II
Fig . 10). Die G e s ta lt w a r auch birn- oder eiförmig, jedoch so , dass h ie r das s t u m p f e Ende nach
u n ten g ek e h rt w a r, während am spitzen P o l die Tentakel sa s sén , die h ie r weniger zahlreich zu sein
schienen. Ausserdem tra te n sie nich t d ire k t aus der Schale, sondern entsprangen einem aus dieser
herausragenden, etwa kugeligen Protoplasmaknopf, d e r langsame B ewegungen und Gestaltsveränderungen
ausführte, wie sich auch die Tentakel lebhaft, aber doch nicht h eftig und schlagend, sondern n u r mehr
pendelnd bewegten. D er protoplasmatische In h a lt fe rn erh in w a r ähnlich dem d e r zu e rst erwähnten
Exemplare, n u r weniger deutlich vacuolisirt.
D e r Protoplasmaknopf sowohl, wie auch die verschiedene Anzahl d e r Tentakel erschweren die
Deutung ungemein. Entweder nämlich h a t man es h ie r m it zwei grundverschiedenen Organismen zu thun,
oder man muss annehmen, dass diese Tentakel keine ständigen Gebilde seien, sondern in einigermassen
beliebiger Zah l ausgestreckt und wieder eingezogen werden können. Dann ab e r wäre eine Zugehörigk
e it zu den rhizopodenartigen Organismen am wahrscheinlichsten und zw a r wohl zu den Helioamoeben,
m it deren Strah len die Tentakel zu identificiren wären. Es dürfen dabei allerdings die übrigen Organisationselemente
n ich t unberücksichtigt gelassen werden, und es muss dah e r immer noch eine andere,
rich tig e re Deutung offen bleiben.
P a ra sitä re s Rhizopod N r. 1.
Abbild. Taf. VI, Fig. 1, 2 n. 3. Vergr. = 1500—1800. Taf. VIII, Fig. 15, 16, 17 n. 18, 28 bis einschl. 37. Vergr. = ca. 1000
resp.. 1500.
Behufs K u ltiv iru n g eines artem ia a rtig en Thieres*) h a tte ich in d e r wärmsten Jah re sz e it (im
J a n u a r und F eb ru a r) eine s ta rk e Lösung von Salinensalz (3 bis 5 °/o) angesetzt und h a tte dazu eigent*)
No. 27 1. c. p. 22. No. 49 1. c. p. 249.
lieh ohne bestimmten P lan einige Süsswasseralgen g efü g t, d a ru n te r namentlich Spirogyren. Diese
konnten naturgemäss in . diesem ihnen so wenig zusagenden Elemente n ich t gedeihen und gingen ein,
was indessen n u r allmählich und langsam geschah. Das Plasma der einzelnen Zellen zog sich hierbei
zumeist zu einem einzigen Klumpen zusammen, d e r zunächst noch seine grüne F a rb e bewahrte, um sich späte r
jedoch mehr und mehr ins Gelbe, R o te und B raune zu verfärben. Sowohl ausserhalb, wie auch innerhalb
der Spirogyrazellen Hessen sich nun an deren "Wandung kleine, fast immer annähernd kreisrunde glänzende
Kugeln, in d e r Einzahl zumeist und seltener in der Mehrzahl erkennen. E s zeigte sich ferner,
dass die aussen sitzenden kleiner und farblos, die innen sitzenden dahingegen grösser waren und einen
g efärbten In h a lt besassen, dessen ganzes Aussehen m it dem des Plasmaballens d e r S p iro g y ra in unv
erkennba rer Weise korrespondirte. F e rn e r Hess sich festste llen, dass die kleineren aussensitzenden
Kügelchen mehr mit noch wenig verän d e rten und grüneren Spirogyren, während die innern, di% grösseren
mit schon w eiter verände rten vergesellschaftet waren.
Fig. 15 au f Taf. V I I I steUt zunächst eine Spirogyrazelle mit einem noch grünen Plasmaklumpen
d a r und aussen, dich t der Wand ange lagert is t ein kleines, etwa ovales Körperchen s ich tb a r, dessen
langer Durchmesser n u r ca. 6 p b e träg t. Irgend welche Pseudopodien sind nicht, vorhanden, wie denn
überh au p t n u r ein fa s t homogener, vielleicht ganz feinkörniger In h a lt zu sehen ist. Ausserdem scheint
eine festere, etwa membranartige UmhüHung ebenfaUs vorhanden zu sein.
Etwa s Aehnliches zeigt ferner Fig. 33, wo zwei zusammenhängende, noch grüne Spirogyrazellen
d arg e ste llt sind. Von diesen tr ä g t die obere einen grösseren P a ra s iten , die u n te re deren zwei, aber,
kleinere und u n te r sich verschieden grosse. Auch h ie r is t Form und sonstige Beschaffenheit die soeben
angegebene, doch ze igt d e r - grösste d e r drei P a ra siten einen rundlichen, trü b en In h altsk ö rp er, den w ir
fü r den K e rn zu h a lten geneigt sind, eine Auffassung, die auch aus einem anderen Bilde hervorgeht,
wie es in Fig. 16 vorliegt. Auch dies is t ein noch junges, ungefärbtes Individuum, dessen äussere
G e sta lt m it dem vorhergehenden völlig übereinstimmt. Sie is t genau eiförmig, mit einem spitzeren
und einem b re ite ren Pol. Von diesen is t nun d e r e rste re blass und fü h r t einen annähernd homogenen
I n h a lt, während der In h a lt nach dem ändern Pol zu k ö r n i g wird, und in d e r Mitte des Gebildes
s ieh t man einen deutlichen, abgegrenzten Fleck, d e r kaum etwas anderes als d e r K e rn sein kann.
Aus dem Angegebenen d ü rfte nun wohl hervorgehen, dass d e r in Rede stehende P a ra s it sich
zunächst als ein ganz kle ines, unscheinbares Gebilde aussen an die SpirogyrazeHe an leg t, um dann
aHer WahrscheinHchkeit nach ein wenig zu wachsen. Ob e r dabei Nah ru n g von aussen, oder von der
Zelle aus aufnimmt, muss dabei freiHch dahingestellt bleiben. Jedenfalls aber sind in diesem Stadium
Pseudopodien irgend welcher A r t nicht sichtbar.
Das nächste Stadium n u n , welches uns vorHegt, zeigt uns je tz t den P a rasiten innerhalb der
Spirogyrazelle, deren In h a lt immer noch grünlich ist. Ganz unau fg ek lärt muss es bleiben, wie er in
diese hineingelangt ist, da der Moment des Hineinschlüpfens leider niemals beobachtet werden konnte,
wie auch eine Oeffnung irgend welcher A r t in d e r Wandung der S p iro g y ra n ich t festzustellen ist.
Es kann indessen keinem Zweifel u n te rlieg en , dass w ir es in beiden F ällen mit dem gleichen Organismus
zu th u n haben, denn ein Unterschied im Aussehen is t n ich t vorhanden (Taf. V I I I , Fig. 18)
und sogar die Form bleibt vorläufig noch die ovale und die Grösse die gleiche. Dann aber macht sich
bald eine gewisse Veränderung geltend. Während sich nämlich der Chlorophyllinha lt der S p iro g y ra zelle
allmähHch v e rfä rb t und sich einzelne, bereits b rau n gewordene Brocken davon loslösen (Taf. V III,
Fig. 34), werden diese nun in den Leib des P a ra s iten aufgenommen, d e r gleichzeitig an Umfang zunimmt
und mehr kugelig wird. Im Uebrigen aber lassen sich Bewegungserscheinungen irgend welcher
A r t n ich t wahrnehmen, wie auch Pseudopodien oder dergl. vöUig fehlen. E s kann mithin auch je tz t
Bib lio th e ca Zoolog ica. H e ft 12. 1 7