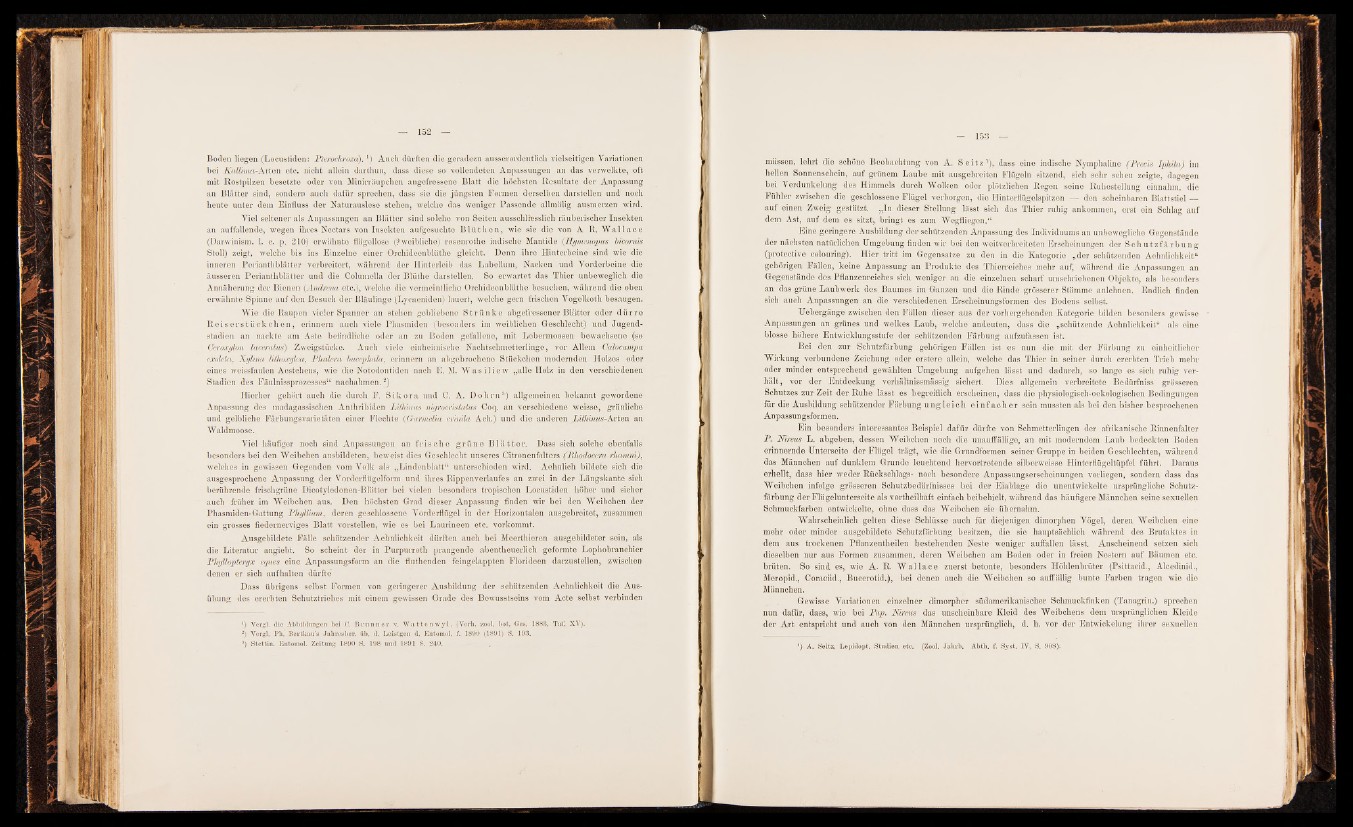
Boden liegen (Locustiden: Pterochrosd). *) Auch dürften die geradezu ausserordentlich vielseitigen Variationen
bei KaUinia-Arten etc. nicht allein darthun, dass diese so vollendeten Anpassungen an das verwelkte, oft
mit Rostpilzen besetzte oder von Minirräupchcn angcfressene Blatt die höchsten Resultate der Anpassung
an Blätter sind, sondern auch dafür sprechen, dass sie die jüngsten Formen derselben darstellen und noch
heute unter dem Einfluss der Naturauslese stehen, welche das weniger Passende allmälig ausmerzen wird.
Viel seltener als Anpassungen an Blätter sind solche von Seiten ausschliesslich räuberischer Insekten
an auffallende, wegen ihres Nectars von Insekten aufgesuchto B l ü t h e n , wie sie die von A R. W a l l a c e
(Darwinism. 1. c. p. 210) erwähnte flügellose (? weibliche) rosenrothe indische Mantide {Hymenopus Incorms
Stoll) zeigt, welche bis ins Einzelne einer Orchidcenblüthe gleicht. Denn ihre Hinterbeine sind wie die
inneren Pcrianthblätter verbreitert, während der Hinterleib das Labellum, Nacken und Vorderbeine die
äusseren Perianthblätter und die Columella der Blüthe darstellen. So erwartet das Thier unbeweglich die
Annäherung der Bienen {Andrem etc.), welche die vermeintliche Orchideenblüthe besuchen, während die oben
erwähnte Spinne auf den Besuch der Bläulinge (Lycaeniden) lauert, welche gern frischen Vogelkoth besaugen.
Wie die Raupen vieler Spanner an stehen gebliebene S t r ü n k e abgefressener Blätter oder d ü r r e
R e i s er S t ü c k c h e n , erinnern auch viele Phasmiden (besonders im weiblichen Geschlecht) und Jugend-
stad ien an nackte am Aste befindliche oder an zu Boden gefallene, mit Lebermoosen bewachsene (so
Geroxylon laceratus) Zweigstücko. Auch viele einheimische Nachtschmetterlinge, vor Allem Galocampa
exöleta, Xylina Uthoxylea, Phalera bucephcila, erinnern an abgebrochene Stückchen modernden Holzes oder
eines weissfaulen Aostchens, wie die Notodontiden nach E. M. Wa s i l i c w „alle Holz in den verschiedenen
Stadien des Fäulnissprozesses“ nachahmen.2)
Hierher gehört auch die durch F. S i k o r a und C. A. D o h m 3) allgemeinen bekannt gewordene
Anpassung des madagassischen Anthribiden Lithinus nigrocristatus Ooq. an verschiedene weisse, grünliche
und gelbliche Färbungsvarietäten einer Flechte (Garmelia crinila Ach.) und die anderen Lithinus-Arten an
Waldmoose..
Viel häufiger noch sind Anpassungen an f r i s c h e g r ü n e B l ä t t e r . Dass sich solche ebenfalls
besonders bei den Weibchen ausbildeten, beweist dies Geschlecht unseres Citronenfalters (Rhoclocera rJmmni),
welches in gewissen Gegenden vom Volk als „Lindenblatt“ unterschieden wird. Aehnlich bildete sich die
ausgesprochene Anpassung der Vorderflügelform und ihres Rippenverlaufes an zwei in der Längskante sich
berührende frischgrüne Dicotyledonen-Blättor bei vielen besonders tropischen Locustiden höher und sicher
auch früher im Weibchen aus. Den höchsten Grad dieser Anpassung finden wir bei den Weibchen der
Phasmiden-Gattung Phyllmm, deren geschlossene Vorderflügel in der Horizontalen ausgebreitet, zusammen
ein grosses fiedernerviges Blatt vorstellen, wie es bei Laurineen etc. vorkommt.
Ausgebildete Fälle schützender Aehnlichkeit dürften auch bei Meerthieren ausgebildeter sein, als
die Literatur angiebt. So scheint der in Purpurroth prangende abentheuerlich geformte Lophobranchier
PlvyUopteryx egues eine Anpassungsform an die fluthenden feingelappten Florideen darzustellen, zwischen
denen er sich aufhalten dürfte
Dass übrigens selbst Formen von geringerer Ausbildung der schützenden Aehnlichkeit die Ausübung
des ererbten Schutztriebcs mit einem gewissen Grade des Bewusstseins vom Acte selbst verbinden
*) Vergl. die Abbildungeil bei C. Brunner v. Wat tenwy 1. (Verb. zool. bot. Ges. 1883, Taf. XV).
*) Vergl. Ph. Bertkau’s Jahresber. üb. d. Leistgen d. Entomol. f. 1890 (1891) S. 193.
3) Stettin. Entomol. Zeitung 1890 S. 198. und 1891 S. 240,
müssen, lehrt die schöne Beobachtung von A. S e i t z 1), dass eine indische Nymphaline (Precis Iphita) im
hellen Sonnenschein, auf grünem Laube mit ausgebreiten Flügeln sitzend, sich sehr scheu zeigte, dagegen
bei Verdunkelung des Himmels durch Wolken oder plötzlichen Regen seine Ruhestellung einnahm, die
Fühler zwischen die geschlossene Flügel verborgen, die Hinterflügelspitzen — den scheinbaren Blattstiel —
auf einen Zweig gestützt. „In dieser Stellung lässt sich das Thier ruhig anko.mmen, erst ein Schlag auf
dem Ast, auf dem es sitzt, bringt es zum Wegfliegen.“
Eine geringere Ausbildung der schützenden Anpassung des Individuums an unbewegliche Gegenstände
der nächsten natürlichen Umgebung finden wir bei den weitverbreiteten Erscheinungen der S c h u t z f ä r b u n g
(protective colouring). Hier tritt im Gegensätze zu den in die Kategorie „der schützenden Aehnlichkeit“
gehörigen Fällen, keine Anpassung an Produkte des Thierreiches mehr auf, während die Anpassungen an
Gegenstände des Pflanzenreiches sich weniger an die einzelnen scharf umschriebenen Objekte, als besonders
an das grüne Laubwerk des Baumes im Ganzen und die Rinde grösserer Stämme anlehnen. Endlich finden
sich auch Anpassungen an die verschiedenen Erscheinungsformen des Bodens selbst.
Uebergänge zwischen den Fällen dieser aus der vorhergehenden Kategorie bilden besonders gewisse
Anpassungen an grünes und welkes Laub, welche andeuten, dass die „schützende Aehnlichkeit“ als eine
blosse höhere Entwicklungsstufe der schützenden Färbung aufzufassen ist.
Bei den zur Schutzfärbung gehörigen Fällen ist es nun die mit der Färbung zu einheitlicher
Wirkung verbundene Zeichung oder erstere allein, welche das Thier in seiner durch ererbten Trieb mehr
oder minder entsprechend gewählten Umgebung aufgehen lässt und dadurch, so lange es sich ruhig verh
ä lt, vor der Entdeckung verhältnissmässig sichert. Dies allgemein verbreitete Bedürfniss grösseren
Schutzes zur Zeit der Ruhe lässt es begreiflich erscheinen, dass die physiologisch-oekologischen Bedingungen
für die Ausbildung schützender Färbung u n g l e i c h e i n f a c h e r sein mussten als bei den bisher besprochenen
Anpassungsformen.
Ein besonders interessantes Beispiel dafür dürfte von Schmetterlingen der afrikanische Rinnenfalter
P. Nirms L. abgeben, dessen Weibchen noch die unauffällige, an mit moderndem Laub bedeckten Boden
erinnernde Unterseite der Flügel trägt, wie die Grundformen seiner Gruppe in beiden Geschlechten, während
das Männchen auf dunklem Grunde leuchtend hervortretende silberweisse Hinterflügeltüpfel führt. Daraus
erhellt, dass hier weder Rückschlags- noch besondere Anpassungserscheinungen vorliegen, sondern dass das
Weibchen infolge grösseren Schutzbedürfnisses bei der Eiablage die unentwickelte ursprüngliche Schutzfärbung
der Flügelunterseite als vortheilhäft einfach beibehielt, während das häufigere Männchen seine sexuellen
Schmuckfarben entwickelte, ohne dass das Weibchen sie-übernahm.
Wahrscheinlich gelten diese-Schlüsse auch für diejenigen dimorphen Vögel, deren Weibchen eine
mehr oder minder ausgebildete Schutzfärbung besitzen, die sie hauptsächlich während des Brutaktes in
dem aus trockenen Pflanzentheilen bestehenden Neste weniger auffallen lässt. Anscheinend setzen sich
dieselben nur aus Formen zusammen, deren Weibchen am Boden oder in freien Nestern auf Bäumen etc.
brüten. So sind es, wie A. R. Wa l l a c e zuerst betonte, besonders Höhlenbrüter (Psittacid., Alcedinid.,
Meropid., Coraciid., Bucerotid.), bei denen auch die Weibchen so auffällig bunte Farben tragen wie die
Männchen.
Gewisse Variationen einzelner dimorpher südamerikanischer Schmuckfinken (Tanagrin.) sprechen
nun dafür, dass, wie bei Pap. Nireus das unscheinbare Kleid des Weibchens dem ursprünglichen Kleide
der A rt entspricht und auch von den Männchen ursprünglich, d. h. vor der Entwickelung ihrer sexuellen
') A. Seitz, Lepidopt. Studien etc. (Zool. Jalirb. Abtli. f. Syst. IV, S. 908).