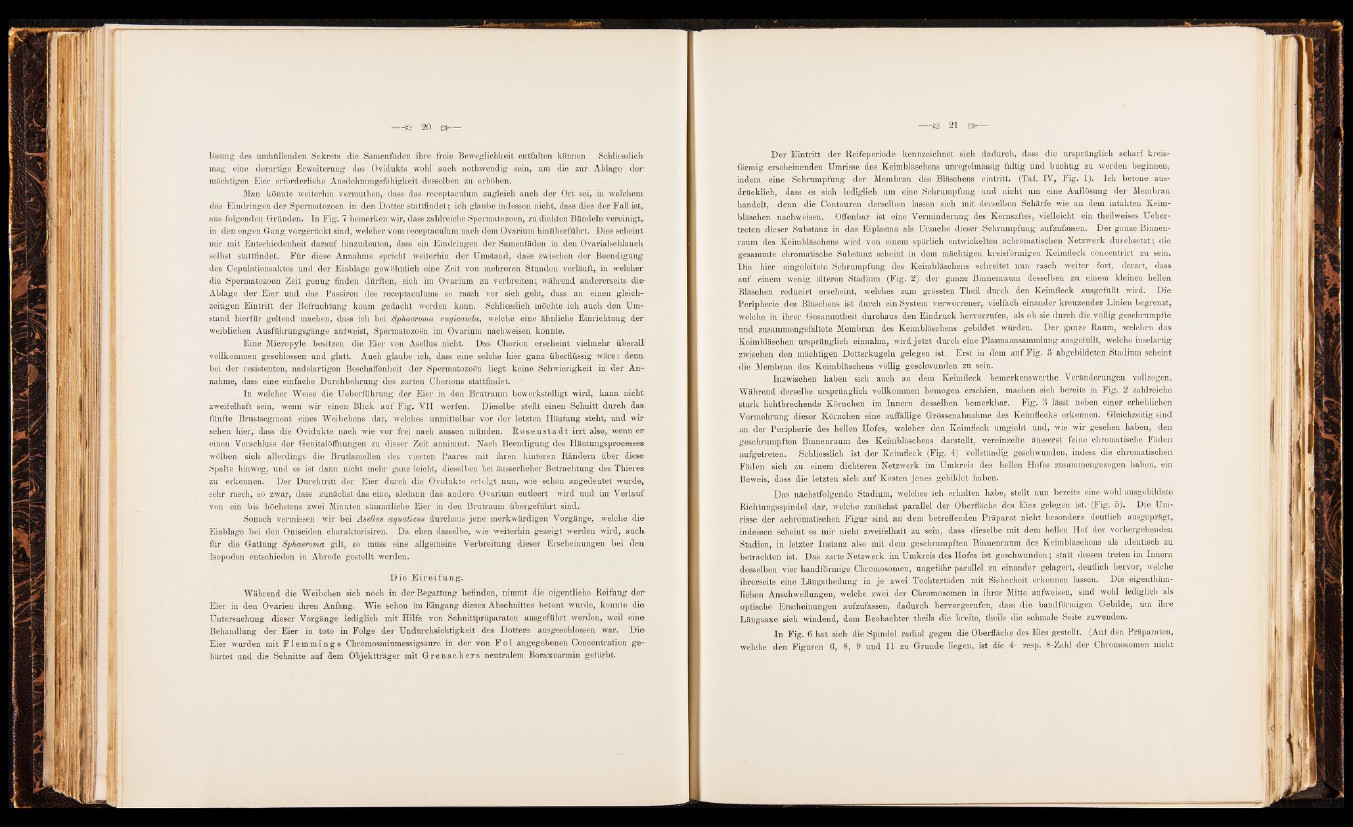
lösung des umhüllenden Sekrets die Samenfaden ihre freie Beweglichkeit entfalten können. Schliesslich-
mag eine derartige Erweiterung des Ovidukts wohl auch nothwendig sein, um die zur Ablage der~
mächtigen Eier erforderliche Ausdehnungsfähigkeit desselben zu erhöhen.
Man könnte weiterhin vermuthen, dass das receptaculum zugleich auch der Ort sei, in welchem
das Eindringen der Spermatozoen in den Dotter stattfindet; ich glaube indessen nicht, dass dies der Fall istr
aus folgenden Gründen. In Fig. 7 bemerken wir, dass zahlreiche Spermatozoen, zu dichten Bündeln vereinigt,,
in den engen Gang vorgerückt sind, welcher vom receptaculum nach dem Ovarium hinüberführt. Dies scheint,
mir mit Entschiedenheit darauf hinzudeuten, dass ein Eindringen der Samenfäden in den Ovarialschlauch
selbst stattfindet. F ü r diese Annahme spricht weiterhin der Umstand, dass zwischen der Beendigung
des Copulationsaktes und der Eiablage gewöhnlich eine Zeit von mehreren Stunden verläuft, in welcher
die Spermatozoen Zeit genug finden dürften, sich im Ovarium zu verbreiten; während andererseits die-
Ablage d e r Eier und das Passiren des receptaculums so rasch vor sich geht, dass an einen gleichzeitigen
Eintritt der Befruchtung kaum gedacht werden kann. Schliesslich möchte ich auch den Umstand
hierfür geltend machen, dass ich bei Sphaeroma rugicauda, welche eine ähnliche Einrichtung d e r
weiblichen Ausführungsgänge aufweist, Spermatozoen im Ovarium nachweisen konnte.
Eine Micropyle besitzen die Eier von Asellus nicht. Das Chorion erscheint vielmehr überall
vollkommen geschlossen und glatt. Auch glaube ich, dass eine solche hier ganz überflüssig wäre; denm
bei der resistenten, nadelartigen Beschaffenheit der Spermatozoen liegt keine Schwierigkeit in der Annahme,
dass eine einfache Durchbohrung des zarten Chorions stattfindet. -
In welcher Weise die Ueberführung der Eier in den Brutraum bewerkstelligt wird, kann nicht-
zweifelhaft sein, wenn wir einen Blick au f Fig. V II werfen. Dieselbe stellt einen Schnitt durch das
fünfte Brustsegment eines Weibchens dar, welches unmittelbar vor der letzten Häutung steht, und wirschen
hier, dass die Ovidukte nach wie vor frei nach aussen münden. R o s e n s t a d t irrt also, wenn er
einen Verschluss der Genitalöffnungen zu dieser Zeit annimmt. Nach Beendigung des Häutungsprocesses-
wölben sich allerdings die Brutlamellen des vierten Paares mit ihren hinteren Rändern über diese
Spalte hinweg, und es ist dann nicht mehr ganz leicht, dieselben bei äusserlicher Betrachtung des Thieres-
zu erkennen. D er Durchtritt der Eier durch die Ovidukte erfolgt nun, wie schon angedeutet wurde,
sehr rasch, so zwar, dass zunächst das eine, alsdann das andere Ovarium entleert wird und im Verlauf
von ein bis höchstens zwei Minuten sämmtliche Eier in den Brutraum übergeführt sind.
Sonach vermissen wir bei Asellus aquaticus durchaus jene merkwürdigen Vorgänge, welche die-
Eiablage bei den Onisciden charakterisiren. Da eben dasselbe, wie weiterhin gezeigt werden wird, auch
für die Gattung Sphaeroma gilt, so muss eine allgemeine Verbreitung dieser Erscheinungen bei den
Isopoden entschieden in Abrede gestellt werden.
D i e E i r e i f u n g .
Während die Weibchen sich noch in der Begattung befinden, nimmt die eigentliche Reifung d e r
Eier in den Ovarien ihren Anfang. Wie schon im Eingang dieses Abschnittes betont wurde, konnte die
Untersuchung dieser Vorgänge lediglich mit Hilfe von Schnittpräparaten ausgeführt werden, weil eine
Behandlung der Eier in toto in Folge der Undurchsichtigkeit des Dotters ausgeschlossen war. Die
E ier wurden mit F l e m m i n g s Chromosmiumessigsäure in der von F o l angegebenen Concentration gehärtet
und die Schnitte au f dem Objektträger mit G r e n a c h e r s neutralem Boraxcarmin gefärbt.
Der Ein tritt der Reifeperiode kennzeichnet sich dadurch, dass die ursprünglich scharf kreisförmig
erscheinenden Umrisse des Keimbläschens unregelmässig faltig und buchtig zu werden beginnen,
indem eine Schrumpfung der Membran des Bläschens eintritt. (Taf. IV, Fig. 1). Ich betone ausdrücklich,
dass es sich lediglich um eine Schrumpfung und nicht um eine Auflösung der Membran
handelt, denn die Contouren derselben lassen sich mit derselben Schärfe wie an dem intakten Keimbläschen
nachweisen. Offenbar ist eine Verminderung des Kernsaftes, vielleicht ein theilweises Ueber-
treten dieser Substanz in das Eiplasma als Ursache dieser Schrumpfung aufzufassen. Der ganze Binnenraum
des Keimbläschens wird von einem spärlich entwickelten achromatischen Netzwerk durchsetzt; die
gesammte chromatische Substanz scheint in dem mächtigen kreisförmigen Keimfleck concentrirt zu sein.
Die hier • eingeleitete Schrumpfung des Keimbläschens schreitet nun rasch weiter fort, derart, dass
auf einem wenig älteren Stadium (Fig. 2) der ganze Binnenraum desselben zu einem kleinen hellen
Bläschen reducirt erscheint, welches zum grössten Theil durch den Keimfleck ausgefüllt wird. Die
Peripherie des Bläschens ist durch ein System verworrener, vielfach einander kreuzender Linien begrenzt,
welche in ihrer Gesammtheit durchaus den Eindruck hervorrufen, als ob sie durch die völlig geschrumpfte
und zusammengefaltete Membran des Keimbläschens gebildet würden. Der ganze Raum, welchen das
Keimbläschen ursprünglich einnahm, wird je tz t durch eine Plasmaansammlung ausgefüllt, welche inselartig
zwischen den mächtigen Dotterkugeln gelegen ist. Erst in dem au f F ig. 3 abgebildeten Stadium scheint
die Membran des Keimbläschens völlig geschwunden zu sein.
Inzwischen haben sich auch an dem Keimfleck bemerkenswerthe Veränderungen vollzogen.
Während derselbe ursprünglich vollkommen homogen erschien, machen sich bereits in Fig. 2 zahlreiche
stark lichtbrechende Körnchen im Innern desselben bemerkbar. Fig. 3 lässt neben einer erheblichen
Vermehrung dieser Körnchen eine auffällige Grössenabnahme des Keimflecks erkennen. Gleichzeitig sind
an der Peripherie des hellen Hofes, welcher den Keimfleck umgiebt und, wie wir gesehen haben, den
geschrumpften Binnenraum des Keimbläschens darstellt, vereinzelte äusserst feine chromatische Fäden
aufgetreten. Schliesslich ist der Keimfleck (Fig. 4) vollständig geschwunden, indess die chromatischen
Fäd en , sich zu einem dichteren Netzwerk im Umkreis des hellen Hofes zusammengezogen haben, ein
Beweis, dass die letzten sich auf Kosten jenes gebildet haben.
Das nächstfolgende Stadium, welches ich erhalten habe, stellt nun bereits eine wohl ausgebildete
Richtungsspindel dar, welche zunächst parallel der Oberfläche des Eies gelegen ist. (Fig. 5). Die Umrisse
der achromatischen F ig u r sind an dem betreffenden Präparat nicht besonders deutlich ausgeprägt,
indessen scheint es mir nicht zweifelhaft zu sein, dass dieselbe mit dem hellen Hof der vorhergehenden
Stadien, in letzter Instanz also mit dem geschrumpften Binnenraum des Keimbläschens als identisch zu
betrachten ist. Das zarte Netzwerk im Umkreis des Hofes ist geschwunden | gtatt dessen treten im Innern
desselben vier bandförmige Chromosomen, ungefähr parallel zu einander gelagert, deutlich hervor, welche
ihrerseits eine Längstheilung in je zwei Tochterfäden mit Sicherheit erkennen lassen. Die e ig e n tüm lichen
Anschwellungen, welche zwei der Chromosomen in ihrer Mitte aufweisen, sind wohl lediglich als
optische Erscheinungen aufzufassen, dadurch hervorgerufen, dass die bandförmigen Gebilde, um ihre
Längsaxe sich windend, dem Beobachter theils die breite, theils die schmale Seite zuwenden.
In Fig. 6 h at sich die Spindel radial gegen die Oberfläche des Eies gestellt. (Auf den Präparaten,
welche den Figuren 6, 8, 9 und 11 zu Grunde liegen, ist die 4- resp. 8-Zahl der Chromosomen nicht