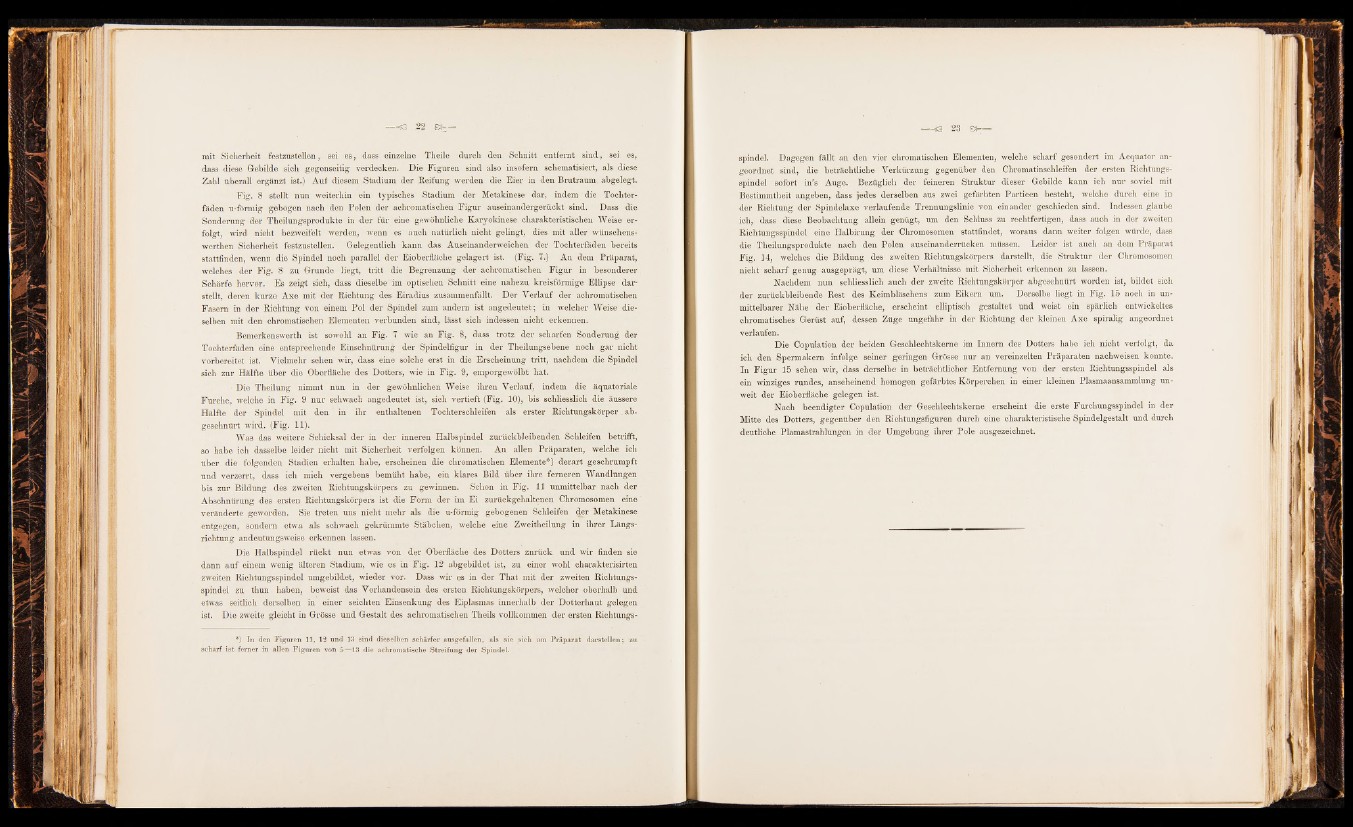
mit Sicherheit festzustellen, sei e s, dass einzelne Theile durch den Schnitt entfernt sind, sei es,
dass diese Gebilde sich gegenseitig verdecken. Die Figuren sind also insofern schematisiert, als diese
Zahl überall ergänzt ist.) Auf diesem Stadium der Reifung werden die Eier in den Brutraum abgelegt.
Fig. 8 stellt nun weiterhin ein typisches Stadium der Metakinese dar, indem die Tochterfäden
u-förmig gebogen nach den Polen der achromatischen F ig u r auseinandergerückt sind. Dass die
Sonderung der Theilungsprodukte in der für eine gewöhnliche Karyokinese charakteristischen Weise erfolgt,
wird nicht bezweifelt werden, wenn es auch natürlich nicht gelingt, dies mit aller wünschens-
werthen Sicherheit festzustellen. Gelegentlich kann das Auseinanderweichen der Tochter faden bereits
stattfinden, wenn die Spindel noch parallel der Eioberfläche gelagert ist. (Fig. 7.) An dem Präparat,
welches der Fig. 8 zu Grunde liegt, tritt die Begrenzung d e r achromatischen F ig u r in besonderer
Schärfe hervor. Es zeigt sich, dass dieselbe im optischen Schnitt eine nahezu kreisförmige Ellipse d a rstellt,
deren kurze Axe mit der Richtung des Eiradius zusammenfällt. Der Verlauf der achromatischen
Fasern in der Richtung von einem Pol der Spindel zum ändern ist angedeutet; in welcher Weise dieselben
mit den chromatischen Elementen verbunden sind, lässt sich indessen nicht erkennen.
Bemerkenswerth ist sowohl an Fig . 7 wie an Fig. 8, dass trotz der scharfen Sonderung der
Tochterfäden eine entsprechende Einschnürung der Spindelfigur in der Theilungsebene noch g a r nicht
vorbereitet ist. Vip.lmp.br sehen wir, dass eine solche erst in die Erscheinung tritt, nachdem die Spindel
sich zur Hälfte über die Oberfläche des Dotters, wie in Fig. 9, emporgewölbt hat.
■ Die Theilung nimmt nun in der gewöhnlichen Weise ihren Verlauf, indem die äquatoriale
Furche, welche in Fig. 9 n u r schwach angedeutet ist, sich vertieft (Fig. 10), bis schliesslich die äussere
Hälfte d e r Spindel mit den in ihr enthaltenen Tochterschleifen als erster R ichtungskörper. abgeschnürt
wird. (Fig. 11).
Was das weitere Schicksal der in der inneren Halbspindel zurückbleibenden Schleifen betrifft,
so habe ich dasselbe leider nicht mit Sicherheit verfolgen können. An allen Präparaten, welche ich
über die folgenden Stadien erhalten habe, erscheinen die chromatischen Elemente*) d e rart geschrumpft
und verzerrt, dass ich mich vergebens bemüht habe, ein klares Bild über ihre ferneren Wandlungen
bis zur Bildung des zweiten Richtungskörpers zu gewinnen. Schon in Fig. 11 unmittelbar nach der
Abschnürung des ersten Richtungskörpers ist die Form der im Ei zurückgehaltenen Chromosomen eine
veränderte geworden. Sie treten uns nicht mehr als die u-förmig gebogenen Schleifen d e r Metakinese
entgegen, sondern etwa als schwach gekrümmte Stäbchen, welche eine Zweitheilung in ihrer Längsrichtung
andeutungsweise erkennen lassen.
Die Halbspindel rü ck t nun etwas von der Oberfläche des Dotters znrüek und wir finden sie
dann au f einem wenig älteren Stadium, wie es in Fig. 12 abgebildet ist, zu einer wohl charakterisirten
zweiten Richtungsspindel umgebildet, wieder vor. Dass wir es in der That mit der zweiten Richtungsspindel
zu thun haben, beweist das Vorhandensein des ersten Richtungskörpers, welcher oberhalb und
etwas seitlich derselben in einer seichten Einsenkung des Eiplasmas innerhalb der Dotterhaut gelegen
ist. Die zweite gleicht in Grösse und Gestalt des achromatischen Theils vollkommen d e r ersten Richtungs*)
In den Figuren 1 1 , 12 und 13 sind dieselben schärfer ausgefallen, als sie sich am Präparat darstellen; za
scharf ist ferner in allen Figuren von 5—13 die achromatische Streifung der Spindel.
spindel. Dagegen fällt an den vier chromatischen Elementen, welche scharf gesondert im Aequator angeordnet
sind, die beträchtliche Verkürzung gegenüber den Chromatinschleifen der ersten Richtungsspindel
sofort in’s Auge. Bezüglich der feineren Struktur dieser Gebilde kann ich nur soviel mit
Bestimmtheit angeben, dass jedes derselben aus zwei gefärbten Partieen besteht, welche durch eine in
der Richtung der Spindelaxe verlaufende Trennungslinie von einander geschieden sind. Indessen glaube
ich, dass diese Beobachtung allein genügt, um den Schluss zu rechtfertigen, dass auch in der zweiten
Richtungsspindel eine Halbirung der Chromosomen stattfindet, woraus dann weiter folgen würde, dass
die Theilungsprodukte nach den Polen auseinanderrücken müssen. Leider ist auch an dem Präparat
Fig. 14, welches die Bildung des zweiten Richtungskörpers darstellt, die Struktur der Chromosomen
nicht scharf genug ausgeprägt, um diese Verhältnisse mit Sicherheit erkennen zu lassen.
Nachdem nun schliesslich auch der zweite Richtungskörper abgeschnürt worden ist, bildet sich
d e r zurückbleibende Rest des Keimbläschens zum Eikern um. Derselbe liegt in Fig. 15 noch in unmittelbarer
Nähe der Eioberfläche, erscheint elliptisch gestaltet und weist ein spärlich entwickeltes
chromatisches Gerüst auf, dessen Züge ungefähr in der Richtung der kleinen Axe spiralig angeordnet
verlaufen.
Die Copulation der beiden Geschlechtskerne im Innern des Dotters habe ich nicht verfolgt, da
ich den Spermakern infolge seiner geringen Grösse nur an vereinzelten Präparaten nachweisen konnte.
In F ig u r 15 sehen wir, dass derselbe in beträchtlicher Entfernung von der ersten Richtungsspindel als
ein winziges rundes, anscheinend homogen gefärbtes Körperchen in einer kleinen Plasmaansammlung unweit
der Eioberfläehe gelegen ist.
Nach beendigter Copulation der Geschlechtskerne erscheint die erste Furchungsspindel in der
Mitte des Dotters, gegenüber den Richtungsfiguren durch eine charakteristische Spindelgestalt und durch
deutliche Plamastrahlungcn in der Umgebung ihrer Pole ausgezeichnet.