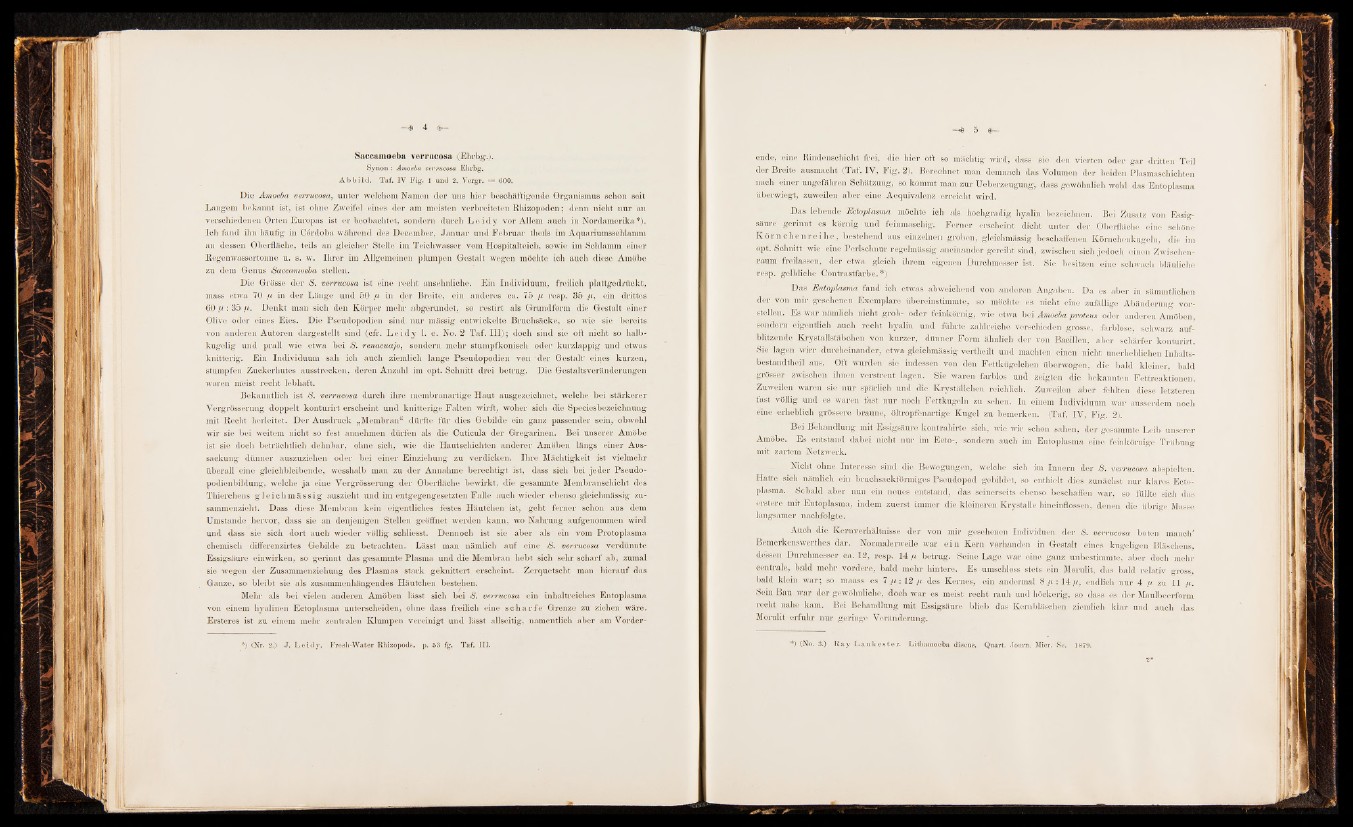
Saccamoeba v e rra c o sa (Ehrbg.).
Synon: Amoeba verrucosa Ehrbg.
A b b ild . Taf. IV Fig. 1 und 2, .Vergr. == 600.
Die Amoeba verrucosa, unter welchem Namen d e r uns hier beschäftigende Organismus schon seit
Langem bekannt ist, ist ohne Zweifel eines der am meisten verbreiteten Rhizopoden; denn nicht nur an
verschiedenen Orten Europas ist er beobachtet, sondern durch L e i d y vor Allem auch in Nordamerika*).
Ich fand ihn häufig in Cordoba während des December, Jan u a r und F eb ru a r theds im Aquariumsschlamm
an dessen Oberfläche, teils an gleicher Stelle' im Teiclrwasser vom Hospitalteich, sowie im Schlamm einer
Regenwassertonne u. s. w. Ih re r im Allgemeinen plumpen Gestalt wegen möchte ich auch diese Amöbe
zu dem Genus Saccamoeba stellen.
Die Grösse der S . verrucosa ist eine recht ansehnliche. Ein Individuum, freilich plattgedriickt,
mass etwa 70 ¡x in der Länge und 50 f-i in der Breite, ein anderes ca. 75 (x resp. 35 f.i, ein drittes
60 f-i : 35 fx. Denkt man sich den Körper mehr abgerundet, so restirt als Grundform die Gestalt einer
Olive oder eines Eies. Die Pseudopodien sind nur mässig entwickelte Bruchsäcke, so wie sie bereits
von anderen Autoren dargestellt sind (cfr. L e i d y 1. c. No. 2 Taf. I I I ) ; doch sind sie oft nicht so halbkugelig
und prall wie etwa bei S . renacuajo, sondern, mehr stumpfkonisch oder kurzlappig und etwas
knitterig. Ein Individuum sah ich auch ziemlich lange Pseudopodien von 'd e r Gestalt' eines kurzen,
stumpfen Zuckerhutes ausstrecken, deren Anzahl im opt. Schnitt drei betrug. Die Gestaltsveränderungen
waren meist recht lebhaft.
Bekanntlich ist S. verrucosa durch ihre membranartige Haut ausgezeichnet, welche bei stärkerer
Vergrösserung doppelt k onturirt erscheint und knitterige Falten wirft, woher sich die Speciesbezeichnung
mit Recht herleitet. D e r Ausdruck „Membran“ dürfte für dies Gebilde ein ganz passender sein, obwohl
wir sie bei weitem nicht so fest annehmen dürfen als die Cuticula der Gregarinen. Bei unserer Amöbe
ist sie doch beträchtlich dehnbar, ohne sich, wie die Hautschichten anderer Amöben längs einer Aussackung
dünner auszuziehen oder bei einer Einziehung zu verdicken. Ih re Mächtigkeit ist vielmehr
überall eine gleichbleibende, wesslialb man zu der Annahme berechtigt ist, dass sich bei jed e r Pseudopodienbildung,
welche ja eine Vergrösserung der Oberfläche bewirkt; die gesammte Membranschicht des
Tliierchens g l e i c h m ä s s i g auszieht und im entgegengesetzten Falle auch wieder ebenso gleichmässig zusammenzieht.
Dass diese Membran kein eigentliches festes Häutchen' ist, geht ferner schon aus dem
Umstande hervor, dass sie an denjenigen Stellen geöffnet werden kann, wo Nahrung aufgenommen wird
und dass sie sich dort auch wieder völlig schliesst. Dennoch ist sie ab e r als ein vom Protoplasma
chemisch differenzirtes Gebilde zu betrachten. Lässt man nämlich au f eine S. verrucosa verdünnte
Essigsäure ein wirken, so gerinnt das gesammte Plasma und die Membran hebt sich sehr scharf ab, zumal
sie wegen der Zusammenziehung des Plasmas stark geknittert erscheint. • Zerquetscht man hierauf das
Ganze, so bleibt sie als zusammenhängendes Häutchen bestehen.
Mehr als bei vielen anderen Amöben lässt sich bei S. verrucosa ein inhaltreiches Entoplasma
von einem hyalinen Ectoplasma unterscheiden, ohne dass freilich eine s c h a r f e Grenze zu ziehen wäre.
Ersteres ist zu einem mein* zentralen Klumpen vereinigt und lässt allseitig, namentlich aber am Vorder*)
(Nr. 2.) J. L e id y . Fresh-Water Rhizopods. p. 53 fg. Taf. III.
ende, eine EindenSehioht frei, die hie r ;oft so mächtig wird, dass sie den vierten oder g a r dritten Teil
der Breite ausmacht (Taf. IV, Fig. 2). Berechnet man demnach das Volumen der beiden Plasmasehichten
nach einer ungefähren Schätzung, so kommt man zur Ueherzeugung, dass gewöhnlich wohl das Entoplasma
tiberwiegt, zuweilen aber eine Aequivalenz erreicht wird.
Das lebende Eotoptamc,i möchte ich als hochgradig hyalin bezeichnen. Bei Zusatz von Essigsäure
gerinnt es körnig und feinmaschig. Fern er erscheint' dicht unter der Oberfläche eine schöne
K ö r n c h e n r e i h e , bestehend aus einzelnen groben, gleichmässig beschaffenen Körnchcukugchi, die im
opt. Schnitt wie eine IVrlschnx.' regelmässig au,-¡minder gereiht sind, zwischen sich jedoch einen Zwischenraum!
freilassen, der etwa gleich ihrem eigenen Durchmesser ist. . Sie besitzen eine schwach bläuliche
resp. gelbliche Contrastfarbe. *)
Das Entoplasma fand ich etwas abweichend von anderen Angaben. D a es aher in sämmtliehen
der Ä mir gesehenen Exemplare ttbereinstimmfej,j f b ‘möchte es -nicht eine zufälüge Abänderung v o rstellen,
Es war nämlich nicht gTob- , «der feinkörnig, wie etwa bei Amoeba proteus oder anderen Amöben,
sondern eigentlich auch recht hyalin und führte zahlreiche verschieden grosso, farblose schwarz aufblitzende
Krystallstäbchen von kurzer, dünner Form ähnlich d e r von Bacillen, aber schärfer konturirt.
Sie lagen wirr durcheinander, etwa gleichmässig vertheilt und machten einen nicht unerheblichen Inhalts-
bestandtheil aus. Oft wurden sie indessen von den Fettkügelchen Überwegen, die bald kleiner bald
gtösser zwischen ihnen verstreut lagen. (Sie waren farblos und zeigten die bekannten Fettreaktionen.
Z W iÄ p w w m sie nur spädiph und die Kryställehen. ifeichlich. Zuweilen aber fehlten diese letzteren
fast völlig und es waren fast, n u r noch Fettkugeln zu sehen. In einem Individuum war äusserdem noch
eine erheblich grössere braune, öltropfenartige Kugel zu b em e rk e n ^ (Taf. IV Fig. 2).
:Y ‘Bei Behandlung mit Essigsäure kontra hin e sich, wie wir Schon «allen, der gesammte Leib unserer
Amöbe. E s;en tstan d dabei nicht n u r im Ecto-, sondern auch im Entoplasma eine feinkörnige Trübung
mit zartem Netzwerk.
Nicht ohne Interesse sind die Bewegungen, welche sich im Innern der S . verrucosa abspielten.
Hatte sich nämlich ein bruchsackförmiges Pseudopod gebildet, so enthielt dies zunächst nur klares Ectoplasma.
Sobald abe r nun ein neues entstand, das seinerseits ebenso beschaffen war, so füllte sich das
erstere mit Entoplasma, indem zuerst immer die kleineren Krystalle hineinflossen, denen die übrige Masse
langsamer nachfolgte.
Auch die Kern Verhältnisse der von mir gesehenen Individuen d e r S . verrucosa boten manch'
Bemerkenswerthes dar. Normalerweile war e i n Kern vorhanden in Gestalt eines kugeligen Bläschens,
dessen Durchmesser ca. 12, resp. 14 f.i betrug. Seine Lage war eine ganz unbestimmte, aber doch mehr
centrale, bald mehr vordere, bald mehr hintere. Es umschloss stets ein Morulit, das bald relativ gross,
bald klein w a r; so maass es 7 f.i: 12 f.i des Kernes, ein andermal 8 f.i : 14 f.i, endlich n u r 4 /.i zu 11 fx.
Sein Bau war der gewöhnliche, doch war es meist recht rauh und höckerig, so dass es der Maulbeerform
recht nahe kam. Bei Behandlung mit Essigsäure blieb das Kernbläschen ziemlich klar* und auch das
Morulit erfuhr n u r geringe Veränderung.
*) (No. 3.) Ray L a n k e s t er. Lithamoeba disens. Quart. Journ. Micr. Sc. 1879.