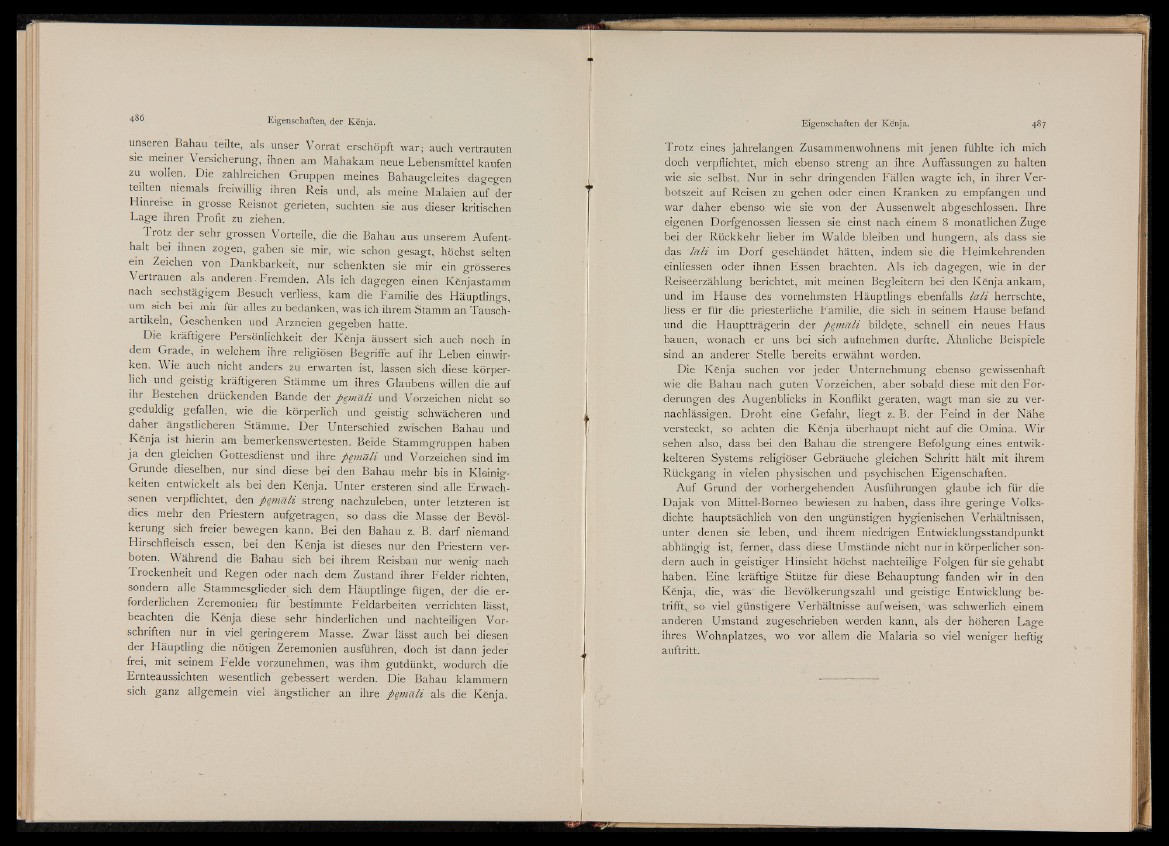
unseren Bahau teilte, als unser Vorrat erschöpft war; auch vertrauten
sie meiner Versicherung, ihnen am Mahakam neue Lebensmittel kaufen
zu wollen. Die zahlreichen Gruppen meines Bahaugeleites dagegen
teilten niemals freiwillig ihren Reis und, als meine Malaien auf der
Hinreise in grosse Reisnot gerieten, suchten sie aus dieser kritischen
Lage ihren Profit zu ziehen.
Trotz der sehr grossen Vorteile, die die Bahau aus unserem Aufenthalt
bei ihnen zogen, gaben sie mir, wie schon gesagt, höchst selten
ein Zeichen von Dankbarkeit, nur schenkten sie mir ein grösseres
Vertrauen als anderen Fremden. Als ich dagegen einen Könjastamm
nach sechstägigem Besuch verliess, kam die Familie des Häuptlings,
um sich bei mir für alles zu bedanken, was ich ihrem Stamm an Tauschartikeln,
Geschenken und Arzneien gegeben hatte.
Die kräftigere Persönlichkeit der Könja äussert sich auch noch in
dem Grade, in welchem ihre religiösen Begriffe auf ihr Leben einwirken.
Wie auch nicht anders zu erwarten ist, lassen sich diese körperlich
und geistig kräftigeren Stämme um ihres Glaubens willen die auf
ihr Bestehen drückenden Bande der pemali und Vorzeichen nicht so
geduldig gefallen, wie die körperlich und geistig schwächeren und
daher ängstlicheren Stämme. Der Unterschied zwischen Bahau und
Könja ist hierin am bemerkenswertesten. Beide Stammgruppen haben
ja den gleichen Gottesdienst und ihre pemali und Vorzeichen sind im
Grunde dieselben, nur sind diese bpi den Bahau mehr bis in Kleinigkeiten
entwickelt als bei den Könja. Unter ersteren sind alle Erwachsenen
verpflichtet, den pemali streng nachzuleben, unter letzteren ist
dies mehr den Priestern aufgetragen, so dass die Masse der Bevölkerung
sich freier bewegen kann. Bei den Bahau z. B. darf niemand
Hirschfleisch essen, bei den Könja ist dieses nur den Priestern verboten.
Während die Bahau sich bei ihrem Reisbau nur wenig nach
Trockenheit und Regen oder nach dem Zustand ihrer Felder richten,
sondern alle Stammesglieder sich dem Häuptlinge fügen, der die erforderlichen
Zeremonien für bestimmte Feldarbeiten verrichten lässt,
beachten die Könja diese sehr hinderlichen und nachteiligen Vorschriften
nur in viel geringerem Masse. Zwar lässt auch bei diesen
der Häuptling die nötigen Zeremonien ausführen, doch ist dann jeder
frei, mit seinem Felde vorzunehmen, was ihm gutdünkt, wodurch die
Einteaussichten wesentlich gebessert werden. Die Bahau klammern
sich ganz allgemein viel ängstlicher an ihre pemali als die Könja.
Trotz eines jahrelangen Zusammenwohnens mit jenen fühlte ich mich
doch verpflichtet, mich ebenso streng an ihre Auffassungen zu halten
wie sie selbst. Nur in sehr dringenden Fällen wagte ich, in ihrer Verbotszeit
auf Reisen zu gehen oder einen Kranken zu empfangen. und
war daher ebenso wie sie von der Aussenwelt abgeschlossen. Ihre
eigenen Dorfgenossen Hessen sie einst nach einem 8 monatlichen Zuge
bei der Rückkehr lieber im Walde bleiben und hunog ern,’ als dass sie
das la li im Dorf geschändet hätten, indem sie. die Heimkehrenden
einliessen oder ihnen Essen brachten. Als ich dagegen, wie in der
Reiseerzählung berichtet, mit meinen Begleitern bei den Könja ankam,
und im Hause des vornehmsten Häuptlings ebenfalls lä li herrschte,
Hess er für die priesterliche Familie, die sich in seinem Hause befand
und die Hauptträgerin der pgmäli bildete, schnell ein neues Haus
bauen, wonach er uns bei sich aufnehmen durfte. Ähnliche Beispiele
sind an anderer Stelle bereits erwähnt worden.
Die Könja suchen vor jeder Unternehmung ebenso gewissenhaft
wie die Bahau nach guten Vorzeichen, aber sobald diese mit den ForderunOg
en des AugOe nblicks in Konflikt 0gerat*en, 0wagt man sie zu vernachlässigen.
Droht eine Gefahr, Hegt z. B. der Feind in der Nähe
versteckt, so achten die Könja überhaupt nicht auf die Omina. Wir
sehen also, dass bei den Bahau die strengere Befolgung eines entwik-
kelteren Systems religiöser Gebräuche gleichen Schritt hält mit ihrem
Rückgang in vielen physischen und psychischen Eigenschaften.
Auf Grund der vorhergehenden Ausführungen glaube ich für die
Dajak von Mittel-Borneo bewiesen zu haben, dass ihre geringe Volksdichte
hauptsächlich von den ungünstigen hygienischen Verhältnissen,
unter:' denen sie leben, und ihrem niedrigen Entwicklungsstandpunkt
abhängig ist, ferner, dass diese Umstände nicht nur in körperlicher sondern
auch in geistiger Hinsicht höchst nachteilige Folgen für sie gehabt
haben. Eine kräftige Stütze für diese Behauptung fanden wir in den
Könja, die, was- die Bevölkerungszahl und geistige Entwicklung betrifft,
so viel, günstigere Verhältnisse aufweisen, was schwerlich einem
anderen Umstand zugeschrieben werden kann, als der höheren Lage
ihres Wohnplatzes, wo vor allem , die Malaria so viel weniger heftig
auftritt.