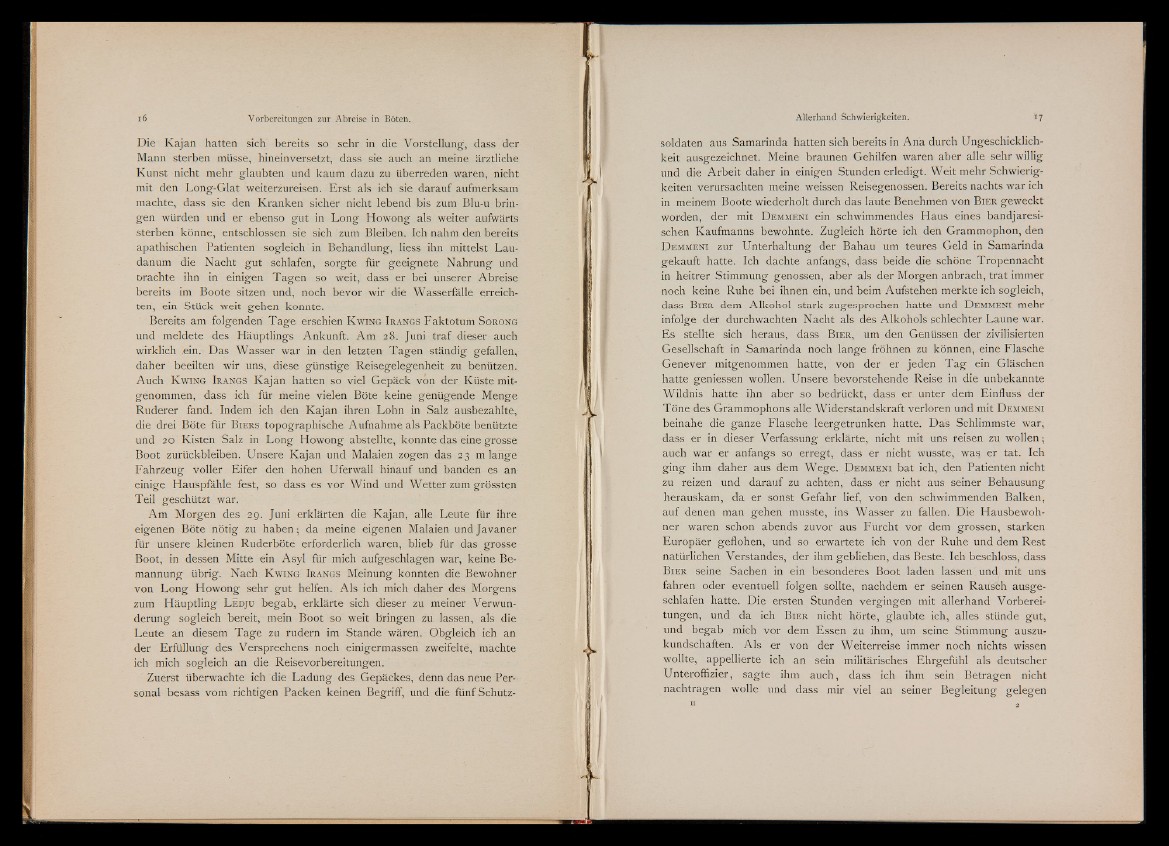
Die Kajan hatten sich bereits so sehr in die Vorstellung, dass der
Mann sterben müsse, hineinversetzt, dass sie auch an meine ärztliche
Kunst nicht mehr glaubten und kaum dazu zu überreden waren, nicht
mit den Long-Glat weiterzureisen. Erst als ich sie darauf aufmerksam
machte, dass sie den Kranken sicher nicht lebend bis zum Blu-u bringen
würden und er ebenso gut in Long Howong als weiter aufwärts
sterben könne, entschlossen sie sich zum Bleiben. Ich nahm den bereits
apathischen Patienten sogleich in Behandlung, liess ihn mittelst Lau-
danum die Nacht gut schlafen, sorgte O ' O für Og eeigOn ete NahrunOg und
orachte ihn in einigen Tagen so weit, dass er bei unserer Abreise
bereits im Boote sitzen und, noch bevor wir die Wasserfälle erreichten,
ein Stück weit gehen konnte.
Bereits am folgenden Tage erschien K w in g I r a n g s Faktotum S o r o n g
und meldete des Häuptlings Ankunft. Am 28. Juni traf dieser auch
wirklich ein. Das Wasser war in den letzten Tagen ständig gefallen,
daher beeilten wir uns, diese günstige Reisegelegenheit zu benützen.
Auch K w in g I r a n g s Kajan hatten so viel Gepäck von der Küste mitOg
enommen,I dass ich für meine vielen Böte keine 0gen0üg ende MenOge
Ruderer fand. Indem ich den Kajan ihren Lohn in Salz ausbezahlte,
die drei Böte für B i e r s topographische Aufnahme als Packböte benützte
und 20 Kisten Salz in Long Howong abstellte, konnte das eine grosse
Boot Zurückbleiben. Unsere Kajan und Malaien zogen das 23 m lange
Fahrzeug voller Eifer den hohen Uferwall hinauf und banden es an
einige Hauspfähle fest, so dass es vor Wind und Wetter zum grössten
Teil geschützt war.
Am Morgen des 29. Juni erklärten die Kajan, alle Leute für ihre
eigenen Böte nötig zu haben; da meine eigenen Malaien und Javaner
für unsere kleinen Ruderböte erforderlich waren, blieb für das grosse
Boot, in dessen Mitte ein Asyl für mich aufgeschlagen war, keine Bemannung
übrig. Nach K w in g Ir a n g s Meinung konnten die Bewohner
von Long Howong sehr gut helfen. Als ich mich daher des Morgens
zum Häuptling L e d ju begab, erklärte sich dieser zu meiner Verwunderung
sogleich bereit, mein Boot so weit bringen zu lassen, als die
Leute an diesem Tage zu rudern im Stande wären, Obgleich ich an
der Erfüllung des Versprechens noch einigermassen zweifelte, machte
ich mich sogleich an die Reisevorbereitungen.
Zuerst überwachte ich die Ladung des Gepäckes, denn das neue Personal
besass vom richtigen Packen keinen Begriff, und die fünf Schutz-
Soldaten aus Samarinda hatten sich bereits in Ana durch Ungeschicklichkeit
ausgezeichnet. Meine braunen Gehilfen waren aber alle sehr willig
und die Arbeit daher in einigen Stunden erledigt. Weit mehr Schwierigkeiten
verursachten meine weissen Reisegenossen. Bereits nachts war ich
in meinem Boote wiederholt durch das laute Benehmen von B i e r geweckt
worden, der mit D e m m e n i ein schwimmendes Haus eines bandjaresi-
schen Kaufmanns bewohnte. Zugleich hörte ich den Grammophon, den
D e m m e n i zur Unterhaltung der Bahau um teures Geld in Samarinda
gekauft hatte. Ich dachte anfangs, dass beide die schöne Tropennacht
in heitrer Stimmung genossen, aber als der Morgen anbrach, trat immer
noch keine Ruhe bei ihnen ein, und beim Aufstehen merkte ich sogleich,
dass B i e r dem Alkohol stark zugesprochen hatte und D e m m e n i mehr
infolge der durchwachten Nacht als des Alkohols schlechter Laune war.
Es stellte sich heraus, dass B i e r , um den Genüssen der zivilisierten
Gesellschaft in Samarinda noch lange fröhnen zu können, eine Flasche
Genever mitgenommen hatte, von der er jeden Tag ein Gläschen
hatte gemessen wollen. Unsere bevorstehende Reise in die unbekannte
Wildnis hatte ihn aber so bedrückt, dass er unter dem Einfluss der
Töne des Grammophons alle Widerstandskraft verloren und mit D e m m e n i
beinahe die ganze Flasche leergetrunken hatte. Das Schlimmste war,
dass er in dieser Verfassung erklärte, nicht mit uns reisen zu wollen;
auch war er anfangs so erregt, dass er nicht wusste, was er tat. Ich
ging ihm daher aus dem Wege. D e m m e n i bat ich, den Patienten nicht
zu reizen und darauf zu achten, dass er nicht aus seiner Behausung
herauskam, da er sonst Gefahr lief, von den schwimmenden Balken,
auf denen man gehen musste, ins Wasser zu fallen. Die Hausbewohner
waren schon abends zuvor aus Furcht vor dem grossen, starken
Europäer geflohen, und so erwartete ich von der Ruhe und dem Rest
natürlichen Verstandes, der ihm geblieben, das Beste. Ich beschloss, dass
B i e r seine Sachen in ein besonderes Boot laden lassen und mit uns
fahren oder eventuell folOg en sollte,I nachdem er seinen Rausch ausgoeschlafen
hatte. Die ersten Stunden vergingen mit allerhand Vorbereitungen,
und da ich B i e r nicht hörte, glaubte ich, alles stünde gut,
und begab mich vor dem Essen zu ihm, um seine Stimmung auszukundschaften.
Als er von der Weiterreise immer noch nichts wissen
wollte, appellierte ich an sein militärisches Ehrgefühl als deutscher
Unteroffizier, sagte ihm auch, dass ich ihm sein Betragen nicht
nachtragen wolle und dass mir viel an seiner Begleitung gelegen
« 2