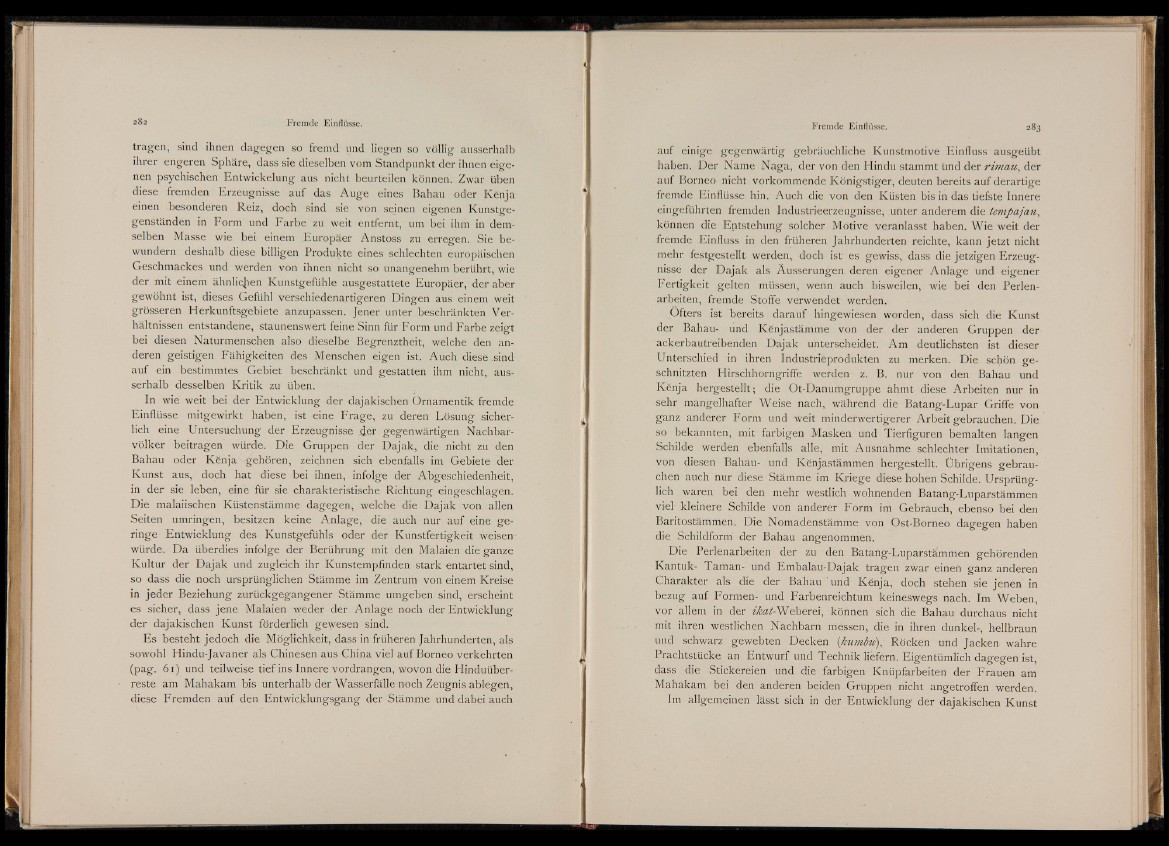
tragen, sind ihnen dagegen so fremd und liegen so völlig ausserhalb
ihrer engeren Sphäre, dass sie dieselben vom Standpunkt der ihnen eigenen
psychischen Entwickelung aus nicht beurteilen können. Zwar üben
diese fremden Erzeugnisse auf das Auge eines Bahau oder Könja
einen besonderen Reiz, doch sind sie von seinen eieor enen Kunsts6regenständen
in Form und Farbe zu weit entfernt, um bei ihm in demselben
Masse wie bei einem Europäer Anstoss zu erregen. Sie bewundern
deshalb diese billigen Produkte eines schlechten europäischen
Geschmackes und werden von ihnen nicht so unangenehm berührt, wie
der mit einem ähnlichen Kunstgefühle ausgestattete Europäer, der aber
gewöhnt ist, dieses Gefühl verschiedenartigeren Dingen aus einem weit
grösseren Herkunftsgebiete anzupassen. Jener unter beschränkten Verhältnissen
entstandene, staunenswert feine Sinn für Form und Farbe zeigt
bei diesen Naturmenschen also dieselbe Begrenztheit, welche den anderen
geistigen Fähigkeiten des Menschen eigen ist. Auch diese .sind
auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt und gestatten ihm nicht, ausserhalb
desselben Kritik zu üben.
In wie weit bei der Entwicklung der dajakischen Ornamentik fremde
Einflüsse mitgewirkt haben, ist eine Frage, zu deren Lösung sicherlich
eine Untersuchung der Erzeugnisse der gegenwärtigen Nachbarvölker
beitragen würde. Die Gruppen der Dajak, die nicht zu den
Bahau oder Könja gehören, zeichnen sich ebenfalls im Gebiete der
Kunst aus, doch hat diese bei ihnen, infolge der Abgeschiedenheit,
in der sie leben, eine für sie charakteristische Richtung- ein geschlagen. 0 0 o
Die malaiischen Küstenstämme dagegen, welche die Dajak von allen
Seiten umringen, besitzen keine Anlage, die auch nur auf eine geringe
Entwicklung des Kunstgefühls oder der Kunstfertigkeit weisen-
würde. Da überdies infolge der Berührung mit den Malaien die ganze
Kultur der Dajak und zugleich ihr Kunstempfinden stark entartet sind,
so dass die noch ursprünglichen Stämme im Zentrum von einem Kreise
in jeder Beziehung zurückgegangener Stämme umgeben sind, erscheint
es sicher, dass jene Malaien weder der Anlage noch der Entwicklung
der dajakischen Kunst förderlich gewesen sind.
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass in früheren Jahrhunderten, als
sowohl Hindu-Javaner als Chinesen aus China viel auf Borneo verkehrten
(pag. 61) und teilweise tief ins Innere vordrangen, wovon die Hinduüberreste
am Mahakam bis unterhalb der Wasserfälle noch Zeugnis ablegen,
diese Fremden auf den Entwicklungsgang der Stämme und dabei auch
auf einige gegenwärtig gebräuchliche Kunstmotive Einfluss ausgeübt
haben. Der Name Naga, der von den Hindu stammt und der rimau, der
auf Borneo nicht vorkommende Königstiger, deuten bereits auf derartige
fremde Einflüsse hin. Auch die von den Küsten bis in das tiefste Innere
eingeführten fremden Industrieerzeugnisse, unter anderem die tempajan,
können die Entstehung solcher Motive veranlasst haben. Wie weit der
fremde Einfluss in den früheren Jahrhunderten reichte, kann jetzt nicht
mehr festgestellt, werden, doch ist es gewiss, dass die jetzigen Erzeugnisse
der Dajak als Äusserungen deren eigener Anlage und eigener
Fertigkeit gelten müssen, wenn auch bisweilen, wie bei den Perlenarbeiten,
fremde Stoffe verwendet werden.
Öfters ist bereits darauf hingewiesen worden, dass sich die Kunst
der Bahau- und Könjastämme von der der anderen Gruppen der
ackerbautreibenden Dajak unterscheidet. Am deutlichsten ist dieser
Unterschied in ihren Industrieprodukten zu merken. Die schön geschnitzten
Hirschhorngriffe werden z. B. nur von den Bahau und
Könja hergestellt; die Ot-Danumgruppe ahmt diese Arbeiten nur in
sehr mangelhafter Weise nach, während die Batang-Lupar Griffe von
ganz anderer Form und weit minderwertigerer Arbeit gebrauchen. Die
so bekannten, mit farbigen Masken und Tierfiguren bemalten langen
Schilde werden ebenfalls alle, mit Ausnahme schlechter Imitationen,
von diesen Bahau- und Könjastämmen hergestellt. Übrigens gebrauchen
auch nur diese Stämme im Kriege diese hohen Schilde. Ursprünglich
waren bei den mehr westlich wohnenden Batang-Luparstämmen
viel kleinere Schilde von anderer Form im Gebrauch, ebenso bei den
Baritostämmen. Die Nomadenstämme von Ost-Borneo dagegen haben
die Schildform der Bahau angenommen.
Die Perlenarbeiten der zu den Batang-Luparstämmen gehörenden
Kantuk- Taman- und Embalau-Dajak tragen zwar einen ganz anderen
Charakter als die der Bahau 'und Könja, doch stehen sie jenen in
bezug auf. Formen- und Farbenreichtum keineswegs nach. Im Weben,
vor allem in der ikat-Weberei, können sich die Bahau durchaus nicht
mit ihren westlichen Nachbarn messen, die in ihren dunkel-, hellbraun
und schwarz gewebten Decken (kumbu); Röcken und Jacken- wahre
Prachtstücke an Entwurf und Technik liefern. Eigentümlich dagegen ist,
dass die Stickereien und die farbigen Knüpfarbeiten der Frauen am
Mahakam bei den anderen beiden Gruppen nicht angetroffen werden.
Im allgemeinen lässt sich in der Entwicklung der dajakischen Kunst