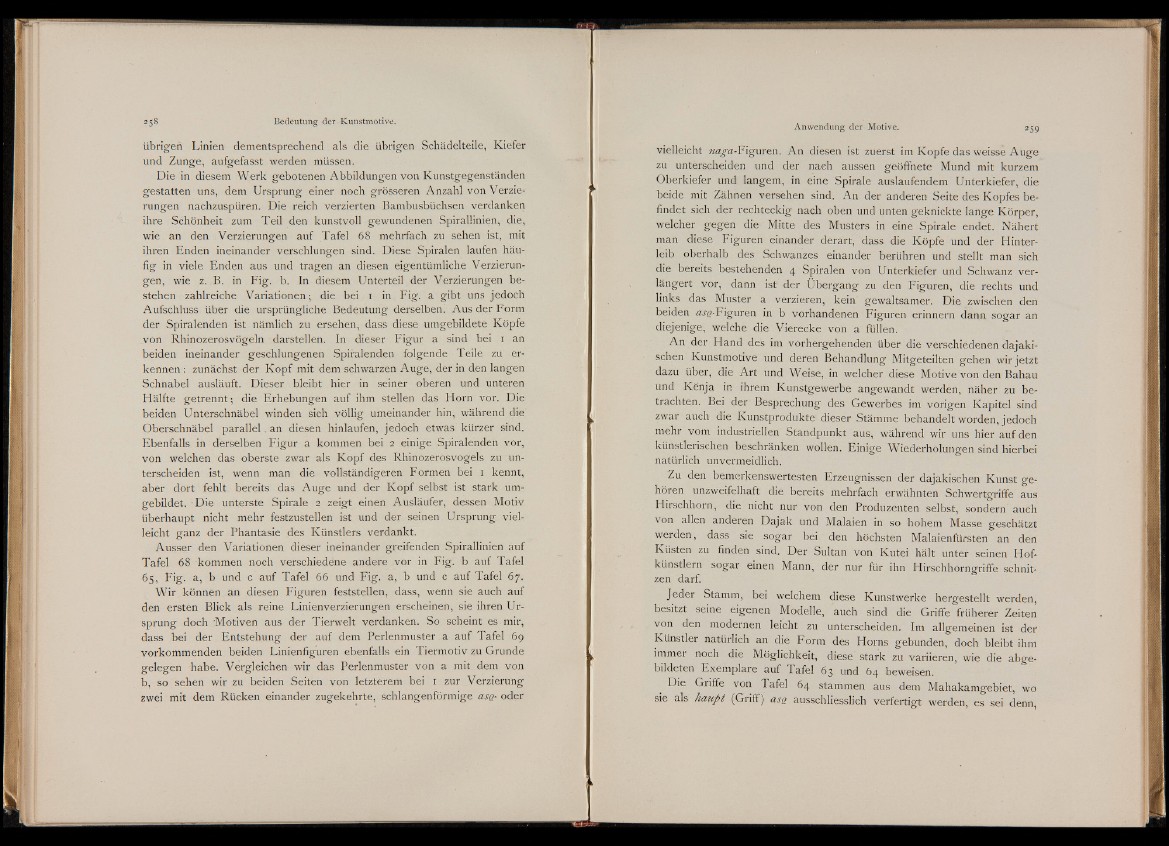
übrigen Linien dementsprechend als die übrigen Schädelteile, Kiefer
und Zungfe,0 * au0fnefasst werden müssen.
Die in diesem Werk gebotenen Abbildungen von Kunstgegenständen
gestatten uns, dem Ursprung einer noch grösseren Anzahl von Verzierungen
nachzuspüren. Die reich verzierten Bambusbüchsen verdanken
ihre Schönheit zum Teil den kunstvoll gewundenen Spirallinien, die,
wie an den Verzierungen auf Tafel 68 mehrfach zu sehen ist, mit
ihren Enden ineinander verschlungen sind. Diese Spiralen laufen häufig
in viele Enden aus und tragen an diesen eigentümliche Verzierungen,
wie z. B. in Fig. b. In diesem Unterteil der Verzierungen bestehen
zahlreiche Variationen; die bei i in Fig. a gibt uns jedoch
Aufschluss über die ursprüngliche Bedeutung derselben. Aus der Form
der Spiralenden ist nämlich zu ersehen, dass diese umgebildete Köpfe
von Rhinozerosvöog eln darstellen. In dieser Figour a sind bei i an
beiden ineinander geschlungenen Spiralenden folgende Teile zu erkennen
: zunächst der Kopf mit dem schwarzen Auge, der in den langen
Schnabel ausläuft. Dieser bleibt hier in seiner oberen und unteren
Hälfte Og etrennt IJ die Erhebunogen auf ihm stellen das Horn vor. Die
beiden Unterschnäbel winden sich völlig umeinander hin, während die
Oberschnäbel parallel. an diesen hinlaufen, jedoch etwas kürzer sind.
Ebenfalls in derselben Figur a kommen bei 2 einige Spiralenden vor,
von welchen das oberste zwar als Kopf des Rhinozerosvogels zu unterscheiden
ist, wenn man die vollständigeren Formen bei 1 kennt,
aber dort fehlt bereits das Auge und der Kopf selbst ist stark umgebildet.
Die unterste Spirale 2 zeigt einen Ausläufer, dessen Motiv
überhaupt nicht mehr festzustellen ist und der seinen Ursprung vielleicht
ganz der Phantasie des Künstlers verdankt.
Ausser den Variationen dieser ineinander greifenden Spirallinien auf
Tafel 68 kommen noch verschiedene andere vor in Fig. b auf Tafel
65, Fig. a, b und c auf Tafel 66 und Fig. a, b und c auf Tafel 67.
Wir können an diesen Figuren feststellen, dass, wenn sie auch auf
den ersten Blick als reine Linienverzierungen erscheinen, sie ihren Ursprung
doch Motiven aus der Tierwelt verdanken. So scheint es-mir,
dass bei der Entstehung der auf dem Perlenmuster a auf Tafel 69
vorkommenden beiden Linienfiguren ebenfalls ein Tiermotiv zu Grunde
gelegen habe. Vergleichen wir das Perlenmuster von a mit dem von
b, so sehen wir zu beiden Seiten von letzterem bei 1 zur Verzierung
zwei mit dem Rücken einander zugekehrte, schlangenförmige asa- oder
vielleicht naga-Figuren. An diesen ist zuerst im Kopfe das weisse Auge
zu unterscheiden und der naeh aussen geöffnete Mund mit kurzem
Oberkiefer und langem, in eine Spirale auslaufendem Unterkiefer, die
beide mit Zähnen versehen sind. An der anderen Seite des Kopfes befindet
sich der rechteckig nach oben und unten geknickte lange Körper,
welcher gegen die Mitte des Musters in eine Spirale endet. Nähert
man diese Figuren einander derart, dass die Köpfe und der Hinterleib
oberhalb des Schwanzes einander berühren und stellt man sich
die bereits bestehenden 4 Spiralen von Unterkiefer und Schwanz verlängert
vor, dann ist der Übergang zu den Figuren, die rechts und
links das Muster a verzieren, kein gewaltsamer. Die zwischen den
beiden aw-Figuren in b vorhandenen Figuren erinnern dann sogar an
diejenige, welche die Vierecke von a füllen.
An der Hand des im vorhergehenden über die verschiedenen dajaki-
schen Kunstmotive und deren Behandlung Mitgeteilten gehen wir jetzt
dazu über, die Art und Weise, in welcher diese Motive von den Bahau
und Könja in ihrem Kunstgewerbe angewandt werden, näher zu betrachten.
Bei der Besprechung des Gewerbes im vorigen Kapitel sind
zwar auch die Kunstprodukte dieser Stämme behandelt worden, jedoch
mehr vom industriellen Standpunkt aus, während wir uns hier auf den
künstletischen beschränken wollen. Einige Wiederholungen sind hierbei
natürlich unvermeidlich.
Zu den bemerkenswertesten Erzeugnissen der dajakischen Kunst gehören
unzweifelhaft die bereits mehrfach erwähnten Schwertgriffe aus
Hirschhorn, die nicht nur von den Produzenten selbst, sondern auch
von allen anderen Dajak und Malaien in so hohem Masse geschätzt
weiden, dass sie sogar bei den höchsten Malaienfürsten an den
Küsten zu finden sind. Der Sultan von Kutei hält unter seinen Hof-
künstlein sogar einen Mann, der nur für ihn Hirschhorngriffe schnitzen
darf.
Jeder Stamm, bei welchem diese Kunstwerke hergestellt werden,
besitzt seine eigenen Modelle, auch sind die Griffe früherer Zeiten
von den modernen leicht zu unterscheiden. Im allgemeinen ist der
Künstler natürlich an die Form des Horns gebunden, doch bleibt ihm
immer noch die Möglichkeit, diese stark zu variieren, wie die abgebildeten
Exemplare auf Tafel 63 und 64 beweisen.
Die Gtiffe von Tafel 64 stammen aus dem Mahakamgebiet, wo
sie als haupt (Griff) aso ausschliesslich verfertigt werden, es sei denn,