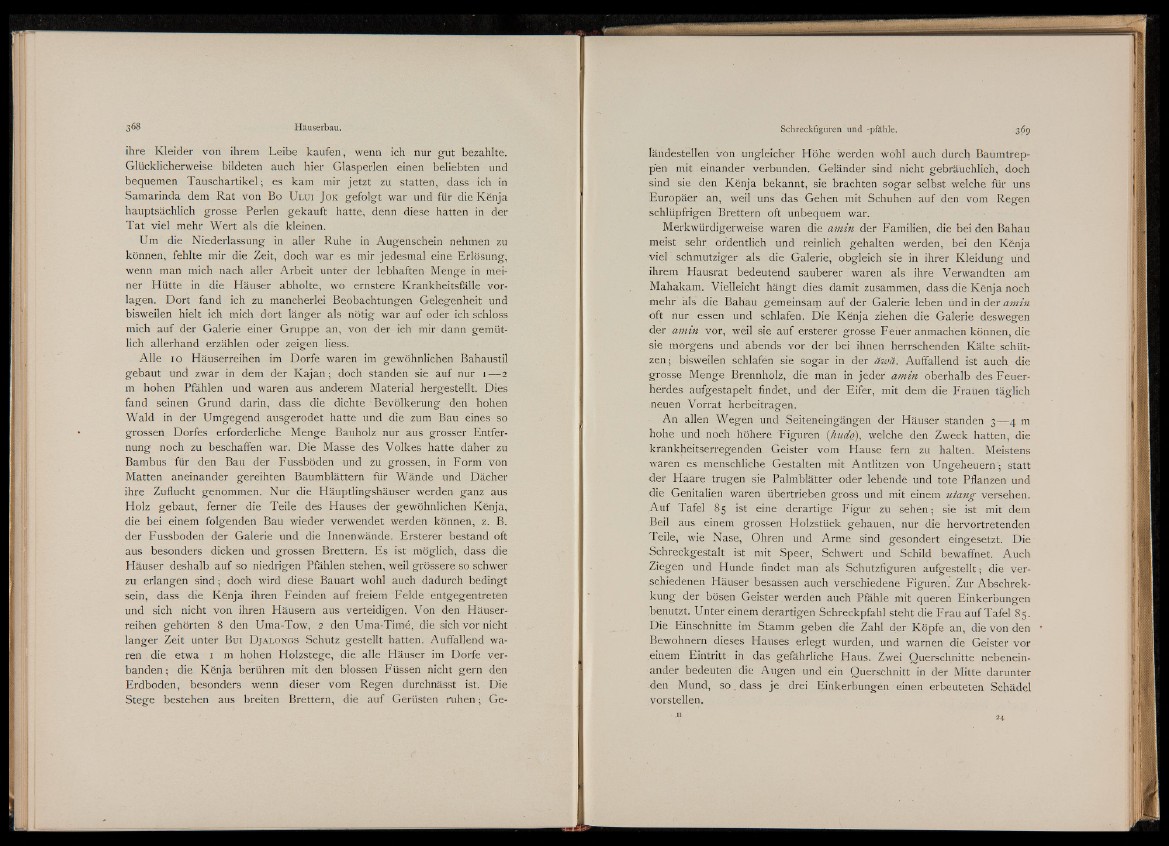
ihre Kleider von ihrem Leibe kaufen, wenn ich nur gut bezahlte.
Glücklicherweise bildeten auch hier Glasperlen einen beliebten und
bequemen Tauschartikel; es kam mir jetzt zu statten, dass ich in
Samarinda dem Rat von Bo U l u i J o k gefolgt war und für die Kénja
hauptsächlich grosse Perlen gekauft hatte, denn diese hatten in der
Tat viel mehr Wert als die kleinen.
Um die Niederlassung in aller Ruhe in Augenschein nehmen zü
können, fehlte mir die Zeit, doch war es mir jedesmal eine Erlösung,
wenn man mich nach aller Arbeit unter der lebhaften Menge in meiner
Hütte in die Häuser abholte, wo ernstere Krankheitsfälle Vorlagen.
Dort fand ich zu mancherlei Beobachtungen Gelegenheit und
bisweilen hielt ich mich dort länger als o nötiog war auf oder ich schloss
mich auf der Galerie einer Gruppe an, von der ich mir dann gemütlich
allerhand erzählen oder zeigen liess.
Alle io Häuserreihen im Dorfe waren im gewöhnlichen Bahaustil
gebaut und zwar in dem der Kajan; doch standen sie auf nur i—2
m hohen Pfählen und waren aus anderem Material hergestellt. Dies
fand seinen Grund darin, dass die dichte Bevölkerung den hohen
Wald in der Umgegend ausgerodet hatte und die zum Bau eines so
grossen Dorfes erforderliche Menge Bauholz nur aus grösser Entfernung
noch zu beschaffen war. Die Masse des Volkes hatte daher zu
Bambus für den Bau der Fussböden und zu grossen, in Form von
Matten aneinander gereihten Baumblättern für Wände und Dächer
ihre Zuflucht genommen. Nur die Häuptlingshäuser werden ganz aus
Holz gebaut, ferner die Teile des Hauses der gewöhnlichen Kénja,
die bei einem folgenden Bau wieder verwendet werden können, z. B.
der Fussböden der Galerie und die Innenwände. Ersterer bestand oft
aus besonders dicken und grossen Brettern. Es ist möglich, dass die
Häuser deshalb auf so niedriog en Pfählen stehen,' weil ogrössere so schwer
zu erlangen sind; doch wird diese Bauart wohl auch dadurch bedingt
sein, dass die Kénja ihren Feinden auf freiem Felde entgegentreten
und sich nicht von ihren Häusern aus verteidigen. Von den Häuserreihen
gehörten 8 den Uma-Tow, 2 den Urna-Timé, die sich vor nicht
langer Zeit unter Bui Djalongs Schutz gestellt hatten. Auffallend waren
die etwa 1 m hohen Holzstege, die alle Häuser im Dorfe verbanden
; die Kénja berühren mit den blossen Füssen nicht gern den
Erdboden, besonders wenn dieser vom Regen durchnässt ist. Die
Stege bestehen aus breiten Brettern, die auf Gerüsten ruhen; Geländestellen
von ungleicher Höhe werden wohl auch durch Baümtrep-
pen mit einander verbunden. Geländer sind nicht gebräuchlich, doch
sind sie den Könja bekannt, sie brachten sogar selbst welche für uns
Europäer an, weil uns das Gehen mit Schuhen auf den vom Regen
schlüpfrigen Brettern oft unbequem war.
Merkwürdigerweise waren die amin der P'amilien, die bei den Bahau
meist sehr, ordentlich und reinlich gehalten werden, bei den Könja
viel schmutziger als die Galerie, obgleich sie in ihrer Kleidung und
ihrem Hausrat bedeutend sauberer waren als ihre Verwandten am
Mahakam, Vielleicht hängt dies damit zusammen, dass die Könja noch
mehr als die Bahau gemeinsam auf der Galerie leben und in der amin
oft nur essen und schlafen. Die Könja ziehen die Galerie deswegen
der amin vor, weil sie auf ersterer grosse Feuer anmachen können, die
sie morgens und abends vor der bei ihnen herrschenden Kälte schützen
• bisweilen schlafen sie sogar in der Auffallend ist auch die
grosse Menge Brennholz, die man in jeder amin oberhalb des Feuerherdes
aufgestapelt findet, und der Eifer, mit dem die Frauen täglich
neuen Vorrat herbeitragen.
An allen Wegen und Seiteneingängen der Häuser standen 3—4 m
hohe und noch höhere Figuren (hudöt), welche den Zweck hatten, die
krankheitserregenden Geister vom Hause fern zu halten. Meistens
waren es menschliche Gestalten mit Antlitzen von Ungeheuern ; statt
der Haare trugen sie Palmblätter oder lebende und tote Pflanzen und
die Genitalien waren übertrieben gross und mit einem utang versehen.
Auf Tafel 85 ist eine derartige Figur zu sehen; sie ist mit dem
Beil aus einem grossen Holzstück gehauen, nur die hervortretenden
Teile, wie Nase, Ohren und Arme sind gesondert eingesetzt. Die
Schreckgestalt ist mit Speer, Schwert und Schild bewaffnet. Auch
Ziegen und Hunde findet man als Schutzfiguren aufgestellt; die verschiedenen
Häuser besassen auch verschiedene Figuren. Zur Abschrek-
kung der bösen Geister werden auch Pfähle mit queren Einkerbungen
.benutzt. Unter einem derartigen Schreckpfahl steht die Frau auf Tafel 85.
Die Einschnitte im Stamm geben die Zahl der Köpfe an, die von den
Bewohnern dieses Hauses erlegt wurden, und warnen die Geister vor
einem Eintritt in das gefährliche Haus. Zwei Querschnitte nebeneinander
bedeuten die Augen und ein Querschnitt in der Mitte darunter
den Mund, so . dass je drei Einkerbungen einen erbeuteten Schädel
vorstellen.