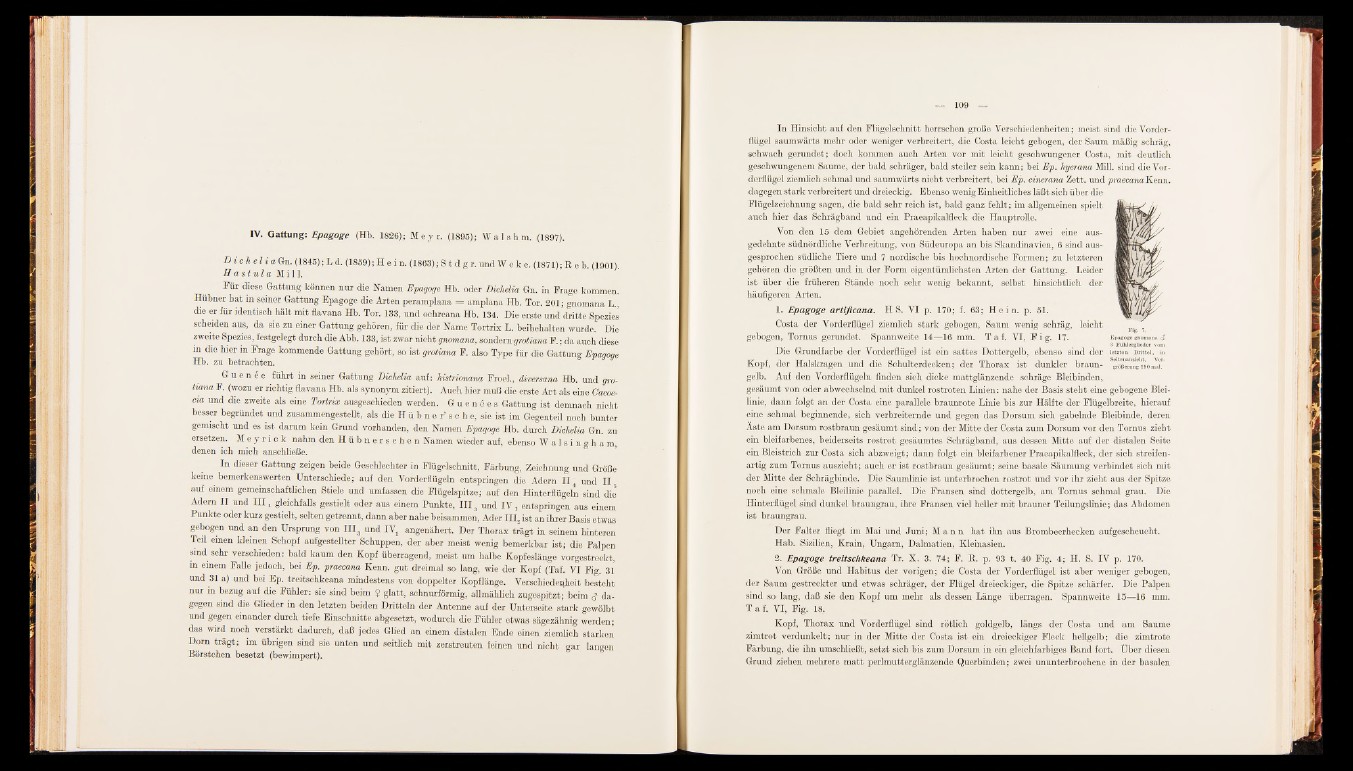
IV. Gattung: Epagoge (Hb. 1826); Me y r. (1895); Wa l s hm. (1897).
Di ch e l i aGn . (1845); Ld. (1859);Hein. (1863); S t d g r. und Wck e . (1871); Re b . (1901).
R a s t u l a Mi l l .
Für diese Gattung können nur die Namen Epagoge Hb. oder DicheKa Gn. in Frage kommen.
Hübner bat in seiner Gattung Epagoge die Arten peramplana = amplana Hb. Tor. 201; gnomana L.,
die er für identisch bält mit flavana Hb. Tor. 188, und ochreana Hb. 134. Die erste und dritte Spezies
scheiden aus, da sie zu einer Gattung gehören, für die der’iName Tortrix L. beibehalten wurde. Die
zweite Spezies, festgelegt durch die Abb. 133, ist zwar nicht gnomana, sondern grotiana F .; dä auch diese
in die hier in Frage kommende Gattung gehört, so ist grotiana F. also Type für die Öhttung Epagoae
Hb. zu betrachten.
G n e n e e führt in seiner Gattung Dichdia auf: histrionana Fröel,, diversana Hb. und gro-
tiana F. (wozu er richtig flavana Hb. als synonym # e r t ) . Auch hier muß die erste Art als eine Oaeoe-
cm und die zweite als eine Tortrix ausgeschieden werden. - G u e n e e s Gattung ist demnach nieljr
besser begründet und zusammengestellt, als die H ü b n e r’ s o b e, sie ist im Gegenteil noch bunter
gemischt und es ist darum kein Grund vorhanden, den Namen Epagoge Hb. durch Dichdia Gn. zu
ersetzen. M e y r i S k nahm den H ü b n e r s e b e n Namen wieder auf, ebenso W a l s i n g h am ,
denen ich mich anschließe.
In dieser Gattung zeigen beide Geschlechter io Flügelschnitt, Färbung, Zeichnung und Größe
keine bemerkenswerten Unterschiede; auf den Vorderflügeln entspringen die Adern II und II
auf einem gemeinschaftlichen Stiele und umfassen die Flügelspitze; auf den Hinterflügeln sind die
Adern I I und I I I , gleichfalls gestielt oder aus einem Punkte, I I I 3 und IV , entspringen aus einem
Punkte oder kurz gestielt, selten getrennt, dann aber nabe beisammen, Ader III, ist an ihrer Basis etwas
gebogen und an den Ursprung von I I I3 und IV, angenähert. Der Thorax trägt in seinem hinteren
Teil einen kleinen Spbopf aufgestellter Schuppen, der aber meist wenig bemerkbar ist; die Palpen
sind sehr verschieden: bald kaum den Kopf überragend, meist um halbe Kopfeslänge vorgestreckt,
in einem Falle jedoch, bei Ep. praecama Kenn, gut dreimal so lang, wie der Kopf (Taf. VI Fig. 31
und 31 a) und bei Ep. treitsebkeana mindestens von doppelter Kopflänge. Verschiedenheit besteht
nur in bezug auf die Fühler: sie sind b e im j| glatt, scbnurförmig, allmählich zugespitzt; beim $ dagegen
sind die Glieder in den letzten beiden Dritteln der Antenne auf der Unterseite stark gewölbt
und gegen einander durch tiefe Einschnitte abgesetzt, wodurch die Fühler etwas sägezähnig werden;
das wird noch verstärkt dadurch, daß jedes Glied an einem distalen Ende einen ziemlich starken
Dorn trägt; im übrigen sind sie unten und seitlich mit zerstreuten feinen und nicht, gar langen
Börstchen besetzt (bewimpert).
In Hinsicht auf den Flügelschnitt herrschen große Verschiedenheiten; meist sind die Vorderflügel
saumwärts mehr oder weniger verbreitert, die Costa leicht gebogen, der Saum mäßig schräg,
schwach gerundet; doch kommen auch Arten vor mit leicht geschwungener Costa, mit deutlich
geschwungenem Saume, der bald schräger, bald steiler sein kann; bei Ep. b/yerana Mill. sind die Vorderflügel
ziemlich schmal und saumwärts nicht verbreitert, bei Ep. cinerana Zett. und praecana Kenn,
dagegen stark verbreitert und dreieckig. Ebenso wenig Einheitlich es läßt sich über die
Flügelzeichnung sagen, die bald sehr reich ist, bald ganz fehlt; im allgemeinen spielt
auch hier das Schrägband und ein Praeapikaifleek die Hauptrolle.
Von den 15 dem Gebiet angehörenden Arten haben nur zwei eine ausgedehnte
südnördliche Verbreitung, von Südeuropa an bis Skandinavien, 6 sind ausgesprochen
südliche Tiere und 7 nordische bis hochnordische Formen; zu letzteren
gehören die größten und in der Form eigentümlichsten Arten der Gattung. Leider
ist über die früheren Stände noch sehr wenig bekannt, selbst hinsichtlich der
häufigeren Arten.
1. Epagoge artificana. HS. VI p. 170; f. 63; He i n . p. 51.
Costa der Vorderflügel ziemlich stark gebogen, Saum wenig schräg, leicht F1 7
gebogen, Tornus gerundet. Spannweite 14— 16 mm. T a f . VI, F i g . 17. e p agoge gnomana tS
, . . . . 3 Fühlerglieder vom Die Grundfarbe der Vorderflügel ist ein sattes Dottergelb, ebenso sind der letzten Drittel, in
Kopf, der Halskragen und die Schulterdecken; der Thorax ist dunkler braun- ^wungwoimi.1
gelb. Auf den Vorderflügeln finden sich dicke mattglänzende schräge Bleibinden,
gesäumt von oder abwechselnd mit dunkel rostroten Linien: nahe der Basis steht eine gebogene Bleilinie,
dann folgt an der Costa eine parallele braunrote Linie bis zur Hälfte der Flügelbreite, hierauf
eine schmal beginnende, sich verbreiternde und gegen das Dorsum sich gabelnde Bleibinde, deren
Äste am Dorsum rostbraun gesäumt sind; von der Mitte der Costa zum Dorsum vor den Tornus zieht
ein bleifarbenes, beiderseits rostrot gesäumtes Schrägband, aus dessen Mitte auf der distalen Seite
ein Bleistrich zur Costa sich abzweigt; dann folgt ein bleifarbener Praeapikaifleek, der sich streifenartig
zum Tornus auszieht; auch er ist rostbraun gesäumt; seine basale Säumung verbindet sich mit
der Mitte der Schrägbinde. Die Saumlinie ist unterbrochen rostrot und vor ihr zieht aus der Spitze
noch eine schmale Bleilinie parallel. Die Fransen sind dottergelb, am Tornus schmal grau. Die
Hinterflügel sind dunkel braungrau, ihre Fransen viel heller mit brauner Teilungslinie; das Abdomen
ist braungrau.
Der Falter fliegt im Mai und Juni; Ma n n hat ihn aus Brombeerhecken aufgescheucht.
Hab. Sizilien, Krain, Ungarn, Dalmatien, Kleinasien.
2. Epagoge treitschkeana Tr. X. 3. 74; F. R. p. 93 t. 40 Fig. 4; H. S. IV p. 170.
Von Größe und Habitus der vorigen; die Costa der Vorderflügel ist aber weniger gebogen,
der Saum gestreckter und etwas schräger, der Flügel dreieckiger, die Spitze schärfer. Die Palpen
sind so lang, daß sie den Kopf um mehr als dessen Länge überragen. Spannweite 15—16 mm.
T a f . VI, Fig. 18.
Kopf, Thorax und Vorderflügel sind rötlich goldgelb, längs der Costa und am Saume
zimtrot verdunkelt; nur in der Mitte der Costa ist ein dreieckiger Fleck hellgelb; die zimtrote
Färbung, die ihn umschließt, setzt sich bis zum Dorsum in ein gleichfarbiges Band fort. Über diesen
Grund ziehen mehrere matt perlmutterglänzende Querbinden; zwei ununterbrochene in der basalen