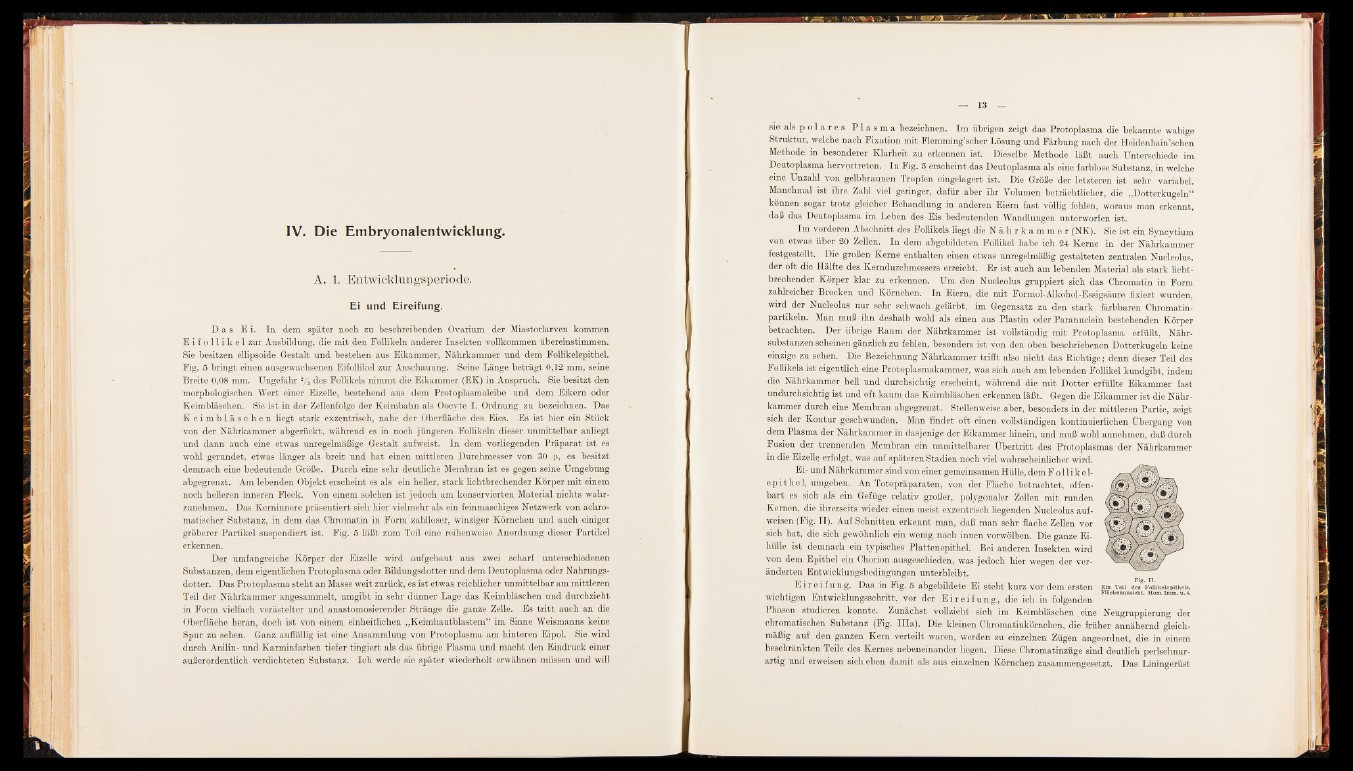
IV. Die Embryonalentwicklung.
A. 1. Entwicklungsperiode.
Ei und Eireifung.
D a s E i. In dem später noch zu beschreibenden Ovarium der Miastorlarven kommen
E i f o l l i k e l zur Ausbildung, die mit den Follikeln anderer Insekten vollkommen übereinstimmen.
Sie besitzen ellipsoide Gestalt und bestehen aus Eikammer, Nährkammer und dem Follikelepithel.
Fig. 5 bringt einen ausgewachsenen Eifollikel zur Anschauung. Seine Länge beträgt 0,12 mm, seine
Breite 0,08 mm. Ungefähr s/s des Follikels nimmt die Eikammer (EK) in Anspruch. Sie besitzt den
morphologischen Wert einer Eizelle, bestehend aus dem Protoplasmaleibe und dem Eikern oder
Keimbläschen. Sie ist in der Zellenfolge der Keimbahn als Oocyte I. Ordnung zu bezeichnen. Das
K e i m b l ä s c h e n liegt stark exzentrisch, nahe der Oberfläche des Eies. Es ist hier ein Stück
von der Nährkammer abgerückt, während es in noch jüngeren Follikeln dieser unmittelbar anliegt
und dann aucb eine etwas unregelmäßige Gestalt aufweist. In dem vorliegenden Präparat ist es
wohl gerundet, etwas länger als breit und hat einen mittleren Durchmesser von 30 |x, es besitzt
demnach eine bedeutende Größe. Durch eine sehr deutliche Membran ist es gegen seine Umgebung
abgegrenzt. Am lebenden Objekt erscheint es als ein heller, stark lichtbrechender Körper mit einem
noch helleren inneren Fleck. Von einem solchen ist jedoch am konservierten Material nichts wahrzunehmen.
Das Kerninnere präsentiert sich hier vielmehr als ein feinmaschiges Netzwerk von achromatischer
Substanz, in dem das Chromatin in Form zahlloser, winziger Körnchen und auch einiger
gröberer Partikel suspendiert ist. Fig. 5 läßt zum Teil eine reihenweise Anordnung dieser Partikel
erkennen.
Der umfangreiche Körper der Eizelle wird aufgebaut ans zwei scharf unterschiedenen
Substanzen, dem eigentlichen Protoplasma oder Bildungsdotter und dem Deutoplasma oder Nahrungsdotter.
Das Protoplasma steht an Masse weit zurück, es ist etwas reichlicher unmittelbar am mittleren
Teil der Nährkammer angesammelt, umgibt in sehr dünner Lage das Keimbläschen und durchzieht
in Form vielfach verästelter und anastomosierender Stränge die ganze Zelle. Es tritt auch an die
Oberfläche heran, doch ist von einem einheitlichen „Keimhautblastem“ im Sinne Weismanns keine
Spur zu sehen. Ganz auffällig ist eine Ansammlung von Protoplasma am hinteren Eipol. Sie wird
durch Anilin- und Karminfarben tiefer tingiert als das übrige Plasma und macht den Eindruck einer
außerordentlich verdichteten Substanz. Ich werde sie später wiederholt erwähnen müssen und will
sie als p o 1 a r e s P l a sm a bezeichnen. Im übrigen zeigt das Protoplasma die bekannte wabige
Struktur, welche nach Fixation mit Flemming’scher Lösung und Färbung nach der Heidenhain’sehen
Methode in besonderer Klarbeit zu erkennen ist. Dieselbe Methode läßt auch Unterschiede im
Deutoplasma hervortreten. In Fig. 5 erscheint das Deutoplasma als eine farblose Substanz, in welche
eine Unzahl von gelbbraunen Tropfen eingelagert ist. Die Größe der letzteren ist sehr variabel.
Manchmal ist ihre Zahl viel geringer, dafür aber ihr Volumen beträchtlicher; die „Dötterkugeln“
können sogar trotz gleicher Behandlung in anderen Eiern fast völlig fehlen, woraus man erkennt,
daß das Deutoplasma im Leben des Eis bedeutenden Wandlungen unterworfen ist.
Im vorderen Abschnitt des Follikels liegt die N ä h r k a m m e r (NK). Sie ist ein Syncytium
von etwas über 20 Zellen. In dem abgebildeten Follikel habe ich 24 Kerne in der Nährkammer
festgestellt. Die großen Kerne enthalten einen etwas unregelmäßig gestalteten zentralen Nucleolus,
der oft die Hälfte des Kerndurchmessers erreicht. Er ist auch am lebenden Material als stark lichtbrechender
Körper klar zu erkennen. Um den Nucleolus gruppiert sich das Chromatin in Form
zahlreicher Brocken und Körnchen. In Eiern, die mit Formol-Alkohol-Essigsäure fixiert wurden,
wird der Nucleolus nur sehr schwach gefärbt, im Gegensatz zu den stark färbbaren Chromatin-
partikeln. Man muß ihn deshalb wohl als einen aus Plastin oder Paranuclein bestehenden Körper
betrachten. Der übrige Raum der Nährkammer ist vollständig mit Protoplasma erfüllt, Nähr-
snbstanzen scheinen gänzlich zu fehlen, besonders ist von den oben beschriebenen Dotterkugeln keine
einzige zu sehen. Die Bezeichnung Nährkammer trifft also nicht das Richtige; denn dieser Teil des
Follikels ist eigentlich eine Protoplasmakammer, was sich auch am lebenden Follikel kundgibt, indem
die Nährkammer hell und durchsichtig erscheint, während die mit Dotter erfüllte Eikammer fast
undurchsichtig ist und oft kaum das Keimbläschen erkennen läßt. Gegen die Eikammer ist die Nährkammer
durch eine Membran abgegrenzt. Stellenweise aber, besonders in der mittleren Partie, zeigt
sich der Kontur geschwunden. Man findet oft einen vollständigen kontinuierlichen Übergang von
dem Plasma der Nährkammer in dasjenige der Eikammer hinein, und muß wohl annehmen, daß durch
Fusion der trennenden Membran ein unmittelbarer Übertritt des Protoplasmas der Nährkammer
in die Eizelle erfolgt, was auf späteren Stadien noch viel wahrscheinlicher wird.
Ei- und Nährkammer sind von einer gemeinsamen Hülle, dem F o llik e lepi
thel , umgeben. An Totopräparaten, von der Fläche betrachtet, offenbart
es sich als ein Gefüge relativ großer, polygonaler Zellen mit runden
Kernen, die ihrerseits wieder einen meist exzentrisch liegenden Nucleolus aufweisen
(Fig. II). Auf Schnitten erkennt man, daß man sehr flache Zellen vor
sich hat, die sich gewöhnlich ein wenig nach innen vorwölben. Die ganze Eihülle
ist demnach ein typisches Plattenepithel. Bei anderen Insekten wird
von dem Epithel ein Chorion ausgeschieden, was jedoch hier wegen der veränderten
Entwicklungsbedingungen unterbleibt.
Ei r ei fung. Das in Fig. 5 abgebildete Ei steht kurz vor dem ersten Ein Teil des Foiiikeiepitheis,
' • i , • -rn > • 1 i * j i i „ Flächenansicht. Hom. Imm. u. 4. wichtigen Entwicklungsschritt, vor der Ei r e i f u n g , die ich in folgenden
Phasen studieren konnte. Zunächst vollzieht sich im Keimbläschen eine Neugruppierung der
chromatischen Substanz (Fig. IHa). Die kleinen Chromatinkörncben, die früher annähernd gleichmäßig
auf den ganzen Kern verteilt waren, werden zu einzelnen Zügen angeordnet, die in einem
beschränkten Teile des Kernes nebeneinander liegen. Diese Chromatinzüge sind deutlich perlschnurartig
und erweisen sich eben damit als aus einzelnen Körnchen zusammengesetzt. Das Liningerüst