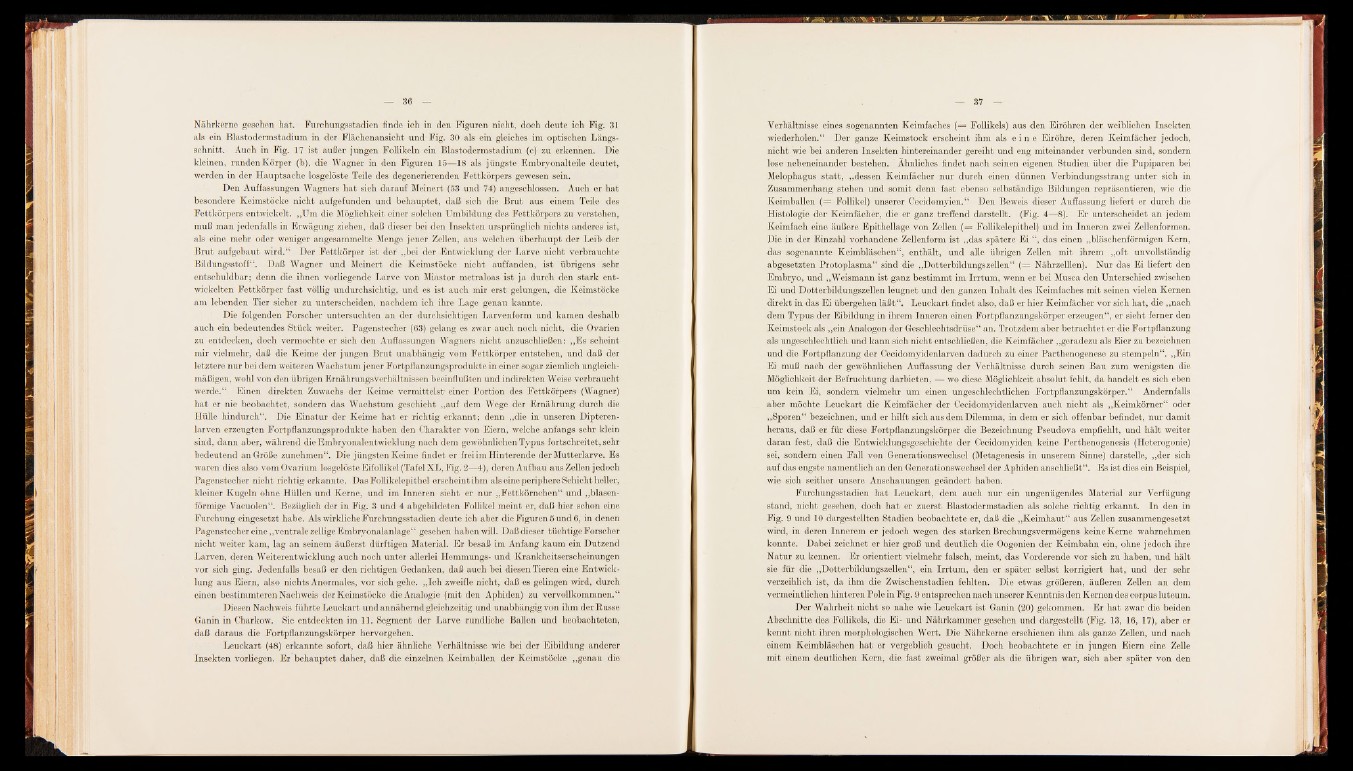
Nährkerne gesehen hat. Furchungsstadien finde ich in den Figuren nicht, doch deute ich Fig. 31
als ein Blastodermstadium in der Flächenansicht und Fig. 30 als ein gleiches im optischen Längsschnitt.
Auch in Fig. 17 ist außer jungen Follikeln ein Blastodermstadium (c) zu erkennen. Die
kleinen, runden Körper (b), die Wagner in den Figuren 15—18 als jüngste. Embryonalteile deutet,
werden in der Hauptsache losgelöste Teile des degenerierenden Fettkörpers gewesen sein.
Den Auffassungen Wagners hat sich darauf Meinert (53 und 74) angeschlossen. Auch er hat
besondere Keimstöcke nicht aufgefunden und behauptet, daß sich die Brut aus einem Teile des
Fettkörpers entwickelt. „Um die Möglichkeit einer solchen Umbildung des Fettkörpers zu verstehen,
muß man jedenfalls in Erwägung ziehen, daß dieser bei den Insekten ursprünglich nichts anderes ist,
als eine mehr oder weniger angesammelte Menge jener Zellen, aus welchen überhaupt der Leib der
Brut aufgebaut wird.“ Der Fettkörper ist der „bei der Entwicklung der Larve nicht verbrauchte
Bildungsstoff“. Daß Wagner und Meinert die Keimstöcke nicht auf fanden, ist übrigens sehr
entschuldbar; denn die ihnen vorliegende Larve von Miastor metraloas ist ja durch den stark entwickelten
Fettkörper fast völlig undurchsichtig, und es ist auch mir erst gelungen, die Keimstöcke
am lebenden Tier sicher zu unterscheiden, nachdem ich ihre Lage genau kannte.
Die folgenden Forscher untersuchten an der durchsichtigen Larvenform und kamen deshalb
auch ein bedeutendes Stück weiter. Pagenstecher (63) gelang es zwar auch noch nicht, die Ovarien
zu entdecken, doch vermochte er sich den Auffassungen Wagners nicht anzuschließen: „Es scheint
mir vielmehr, daß die Keime der jungen Brut unabhängig vom Fettkörper entstehen, und daß der
letztere nur bei dem weiteren Wachstum jener Fortpflanzungsprodukte in einer sogar ziemlich ungleichmäßigen,
wohl von den übrigen Ernährungsverhältnissen beeinflußten und indirekten Weise verbraucht
werde.“ Einen direkten Zuwachs der Keime vermittelst'einer Portion des Fettkörpers (Wagner)
hat er nie beobachtet, sondern das Wachstum geschieht „auf dem Wege der Ernährung durch die
Hülle hindurch“. Die Einatur der Keime hat er richtig erkannt; denn „die in unseren Dipterenlarven
erzeugten Fortpflanzungsprodukte haben den Charakter von Eiern, welche anfangs sehr klein
sind, dann aber, während die Embryonalentwicklung nach dem gewöhnlichen Typus fortschreitet, sehr
bedeutend an Größe zunehmen“. Die jüngsten Keime findet er frei im Hinterende der Mutterlarve. Es
waren dies also vom Ovarium losgelöste Eifollikel (Tafel XL, Fig. 2—4), deren Aufbau aus Zellen jedoch
Pagenstecher nicht richtig erkannte. Das Follikelepithel erscheint ihm als eine periphere Schicht heller,
kleiner Kugeln ohne Hüllen und Kerne, und im Inneren sieht er nur „Fettkörnchen“ und „blasenförmige
Vacuolen“. Bezüglich der in Fig. 3 und 4 abgebildeten Follikel meint er, daß hier schon eine
Furchung eingesetzt habe. Als wirkliche Furchungsstadien deute ich aber die Figuren 5 und 6, in denen
Pagenstecher eine „ventrale zellige Embryonalanlage“ gesehen haben will. Daß dieser tüchtige Forscher
nicht weiter kam, lag an seinem äußerst dürftigen Material. Er besaß im Anfang kaum ein Dutzend
Larven, deren Weiterentwicklung auch noch Unter allerlei Hemmungs- und Krankheitserscheinungen
vor sich ging. Jedenfalls besaß er den richtigen Gedanken, daß auch bei diesen Tieren eine Entwicklung
aus Eiern, also nichts Anormales, vor sich gehe. „Ich zweifle nicht, daß es gelingen wird, durch
einen bestimmteren Nachweis der Keimstöcke die Analogie (mit den Aphiden) zu vervollkommnen.“
Diesen Nachweis führte Leuckart und annähernd gleichzeitig und unabhängig von ihm der Russe
Ganin in Charkow. Sie entdeckten im 11. Segment der Larve rundliche Ballen und beobachteten,
daß daraus die Fortpflanzungskörper hervorgehen.
Leuckart (48) erkannte sofort, daß hier ähnliche Verhältnisse wie bei der Eibildung anderer
Insekten vorliegen. Er behauptet daher, daß die einzelnen Keimballen der Keimstöcke „genau die
Verhältnisse eines sogenannten Keimfaches (= Follikels) aus den Eiröhren der weiblichen Insekten
wiederholen.“ Der ganze Keimstock erscheint ihm als e i n e Eiröhre, deren Keimfächer jedoch,
nicht wie bei anderen Insekten hintereinander gereiht und eng miteinander verbunden sind, sondern
lose nebeneinander bestehen. Ähnliches findet nach seinen eigenen Studien über die Pupiparen bei
Melophagus statt, „dessen Keimfächer nur durch einen dünnen Verbindungsstrang unter sich in
Zusammenhang stehen und somit denn fast ebenso selbständige Bildungen repräsentieren, wie die
Keimballen (= Follikel) unserer Cecidomyien.“ Den Beweis dieser Auffassung liefert er durch die
Histologie der Keimfächer, die er ganz treffend darstellt. (Fig. 4—8). Er unterscheidet an jedem
Keimfach eine äußere Epithellage von Zellen (= Follikelepithel) und im Inneren zwei Zellenformen.
Die in der Einzahl vorhandene Zellenform ist „das spätere Ei “, das einen „bläschenförmigen Kern,
das sogenannte Keimbläschen“, enthält, und alle übrigen Zellen mit ihrem „oft unvollständig
abgesetzten Protoplasma“ sind die „Dotterbildungszellen“ (= Nährzelllen). Nur das Ei liefert den
Embryo, und „Weismann ist ganz bestimmt im Irrtum, wenn er bei Musca den Unterschied zwischen
Ei und Dotterbildungszellen leugnet und den ganzen Inhalt des Keimfaches mit seinen vielen Kernen
direkt in das Ei übergehen läßt“. Leuckart findet also, daß er hier Keimfächer vor sich hat, die „nach
dem Typus der Eibildung in ihrem Inneren einen Fortpflanzungskörper erzeugen“, er sieht ferner den
Keimstock als „ein Analogon der Geschlechtsdrüse“ an. Trotzdem aber betrachtet er die Fortpflanzung
als ungeschlechtlich und kann sich nicht entschließen, die Keimfächer „geradezu als Eier zu bezeichnen
und die Fortpflanzung der Cecidomyidenlarven dadurch zu einer Parthenogenese zu stempeln“. „Ein
Ei muß nach der gewöhnlichen Auffassung der Verhältnisse durch seinen Bau zum wenigsten die
Möglichkeit der Befruchtung darbieten, — wo diese Möglichkeit absolut fehlt, da handelt es sich eben
um kein Ei, sondern vielmehr um einen ungeschlechtlichen Fortpflanzungskörper.“ Andernfalls
aber möchte Leuckart die Keimfächer der Cecidomyidenlarven auch nicht als „Keimkörner“ oder
„Sporen“ bezeichnen, und er hilft sich aus dem Dilemma, in dem er sich offenbar befindet, nur damit
heraus, daß er für diese Fortpflanzungskörper die Bezeichnung Pseudova empfiehlt, und hält weiter
daran fest, daß die Entwicklungsgeschichte der Cecidomyiden keine Perthenogenesis (Heterogonie)
sei, sondern einen Fall von Generationswechsel (Metagenesis in unserem Sinne) darstelle, „der sich
auf das engste namentlich an den Generationswechsel der Aphiden anschließt“. Es ist dies ein Beispiel,
wie sich seither unsere Anschauungen geändert haben.
Furchungsstadien hat Leuckart, dem auch nur ein ungenügendes Material zur Verfügung
stand, nicht gesehen, doch hat er zuerst Blastodermstadien als solche richtig erkannt. In den in
Fig. 9 und 10 dargestellten Stadien beobachtete er, daß die „Keimhaut“ aus Zellen zusammengesetzt
wird, in deren Innerem er jedoch wegen des starken Brechungsvermögens keine Kerne wahrnehmen
konnte. Dabei zeichnet er hier groß und deutlich die Oogonien der Keimbahn ein, ohne jedoch ihre
Natur zu kennen. Er orientiert vielmehr falsch, meint, das Vorderende vor sich zu haben, und hält
sie für die „Dotterbildungszellen“, ein Irrtum, den er später selbst korrigiert hat, und der sehr
verzeihlich ist, da ihm die Zwischenstadien fehlten. Die etwas größeren, äußeren Zellen an dem
vermeintlichen hinteren Pole in Fig. 9 entsprechen nach unserer Kenntnis den Kernen des corpus luteum.
Der Wahrheit nicht so nahe wie Leuckart ist Ganin (20) gekommen. Er hat zwar die beiden
Abschnitte des Follikels, die Ei- und Nährkammer gesehen und dargestellt (Fig. 13, 16, 17), aber er
kennt nicht ihren morphologischen Wert. Die Nährkerne erschienen ihm als ganze Zellen, und nach
einem Keimbläschen hat er vergeblich gesucht. Doch beobachtete er in jungen Eiern eine Zelle
mit einem deutlichen Kern, die fast zweimal größer als die übrigen war, sich aber später von den