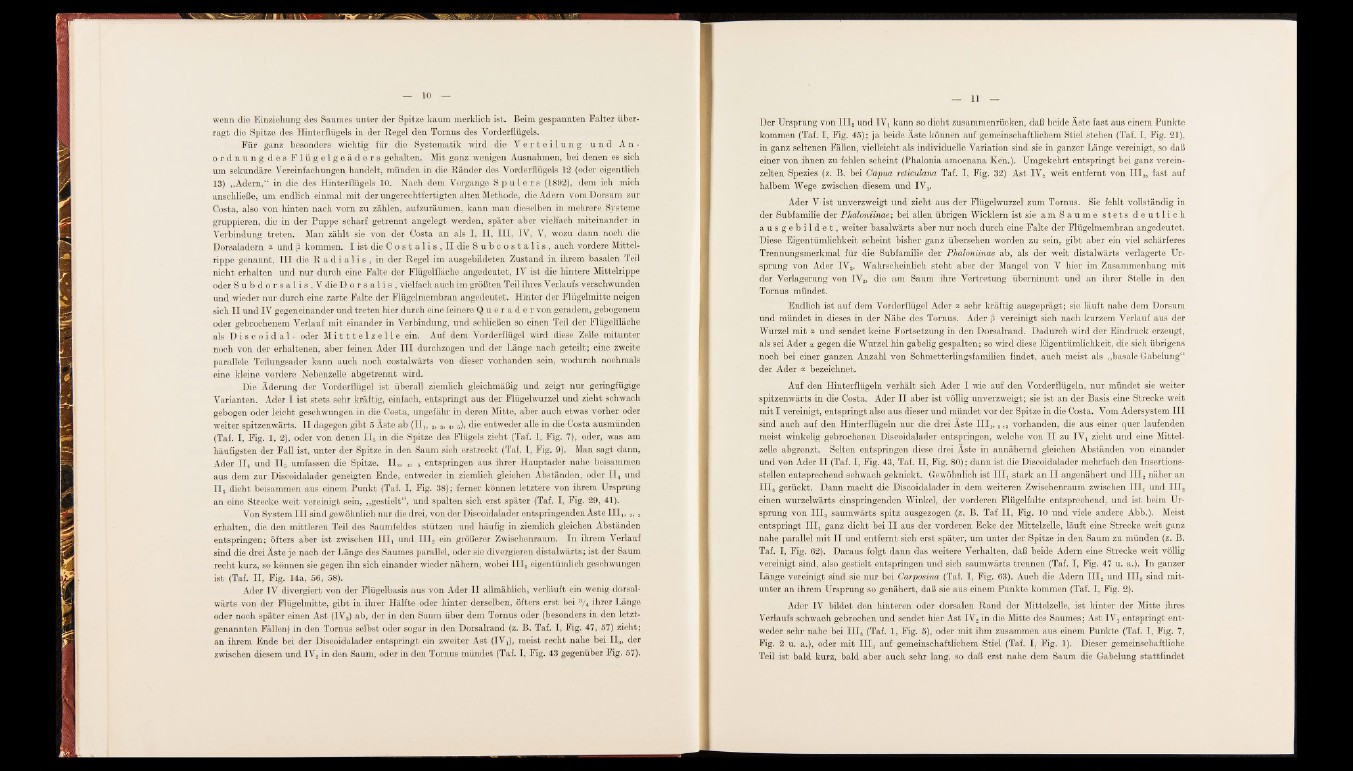
wenn die Einziehung des Saumes unter der Spitze kaum merklich ist. Beim gespannten Falter überragt
die Spitze des Hinterflügels in der Regel den Tornus des Vorderflügels.
Für ganz besonders wichtig für die Systematik wird die V e r t e i l u n g u n d A n o
r d n u n g d e s F l ü g e l g e ä d e r s gehalten. Mit ganz wenigen Ausnahmen, bei denen es sich
um sekundäre Vereinfachungen handelt, münden in die Ränder des Vorderflügels 12 (oder eigentlich
13) „Adern,“ in die des Hinterflügels 10. Nach dem Vorgänge S p u l e r s (1892), dem ich mich
anschließe, um endlich einmal mit der ungerechtfertigten alten Methode, die Adern vom Dorsum zur
Costa, also von hinten nach vorn zu zählen, aufzuräumen, kann man dieselben in mehrere Systeme
gruppieren, die in der Puppe scharf getrennt angelegt werden, später aber vielfach miteinander in
Verbindung treten. Man zählt sie von der Costa an als I, II, III, IV, V, wozu dann noch die
Dorsaladern a und ß kommen. I ist die C o s t a l i s , II die S u b c o s t a l i s , auch vordere Mittelrippe
genannt, III die R a d i a 1 i s , in der Regel im ausgebildeten Zustand in ihrem basalen Teil
nicht erhalten und nur durch eine Falte der Flügelfläche angedeutet, IV ist die hintere Mittelrippe
oder S u b d o r s a l i s , V die D o r s a 1 i s , vielfach auch im größten Teil ihres Verlaufs verschwunden
und wieder nur durch eine zarte Falte der Flügelmembran angedeutet. Hinter der Flügelmitte neigen
sich II und IV gegeneinander und treten hier durch eine feinere Q u e r a d e r von geradem, gebogenem
oder gebrochenem Verlauf mit einander in Verbindung, und schließen so einen Teil der Flügelfläche
als D i s c o i d a l - oder M i 111 e 1 z e 11 e ein. Auf dem Vorderflügel wird diese Zelle mitunter
noch von der erhaltenen, aber feinen Ader I II durchzogen und der Länge nach geteilt; eine zweite
parallele Teilungsader kann auch noch costalwärts von dieser vorhanden sein, wodurch nochmals
eine kleine vordere Nebenzelle abgetrennt wird.
Die Äderung der Vorderflügel ist überall ziemhch gleichmäßig und zeigt nur geringfügige
Varianten. Ader I ist stets sehr kräftig, einfach, entspringt aus der Flügelwurzel und zieht schwach
gebogen oder leicht geschwungen in die Costa, ungefähr in deren Mitte, aber auch etwas vorher oder
weiter spitzenwärts. II dagegen gibt 5 Äste ab (IIX, 2, 3, 4, 5), die entweder alle in die Costa ausmünden
(Taf. I, Fig. 1, 2), oder von denen I I5 in die Spitze des Flügels zieht (Taf. I, Fig. 7), oder, was am
häufigsten der Fall ist, unter der Spitze in den Saum sich erstreckt (Taf. I, Fig. 9). Man sagt dann,
Ader I I4 und I I 5 umfassen die Spitze. I I 3, 4, 6 entspringen aus ihrer Hauptader nahe beisammen
aus dem zur Discoidalader geneigten Ende, entweder in ziemhch gleichen Abständen, oder I I4 und
I I 5 dicht beisammen aus einem Punkt (Taf. I, Fig. 38); ferner können letztere von ihrem Ursprung
an eine Strecke weit vereinigt sein, „gestielt“, und spalten sich erst später (Taf. I, Fig. 29, 41).
Von System III sind gewöhnlich nur die drei, von der Discoidalader entspringenden Äste I II l3 2, 3
erhalten, die den mittleren Teil des Saumfeldes stützen und häufig in ziemhch gleichen Abständen
entspringen; öfters aber ist zwischen IIIj und I I I2 ein größerer Zwischenraum. In ihrem Verlauf
sind die drei Äste je nach der Länge des Saumes parallel, oder sie divergieren distalwärts; ist der Saum
recht kurz, so können sie gegen ihn sich einander wieder nähern, wobei I I I3 eigentümhch geschwungen
ist (Taf. II, Fig. 14a, 56, 58).
Ader IV divergiert von der Flügelbasis aus von Ader II allmählich, verläuft ein wenig dorsal -
wärts von der Flügelmitte, gibt in ihrer Hälfte oder hinter derselben, öfters erst bei 3/4 ihrer Länge
oder noch später einen Ast (IV2) ab, der in den Saum über dem Tornus oder (besonders in den letztgenannten
Fällen) in den Tornus selbst oder sogar in den Dorsalrand (z. B. Taf. I, Fig. 47, 57) zieht;
an ihrem Ende bei der Discoidalader entspringt ein zweiter Ast (IVd, meist recht nahe bei II3, der
zwischen diesem und IV2 in den Saum, oder in den Tornus mündet (Taf. I, Fig. 43 gegenüber Fig. 57).
Der Ursprung von I II3 und IVX kann so dicht zusammenrücken, daß beide Äste fast aus einem Punkte
kommen (Taf. I, Fig. 45); ja beide Äste können auf gemeinschaftlichem Stiel stehen (Taf. I, Fig. 21),
in ganz seltenen Fällen, vielleicht als individuelle Variation sind sie in ganzer Länge vereinigt, so daß
einer von ihnen zu fehlen scheint (Phalonia amoenana Ken.). Umgekehrt entspringt bei ganz vereinzelten
Spezies (z. B. bei Capua reticvlana Taf. I, Fig. 32) Ast IV2 weit entfernt von I II3, fast auf
halbem Wege zwischen diesem und IVX.
Ader V-ist unverzweigt und zieht aus der Flügelwurzel zum Tornus. Sie fehlt vollständig in
der Subfamilie der Phaloniinae; bei allen übrigen Wicklern ist sie am S a ume s t et s d e u t l i c h
a u s g e b i l d e t , weiter basalwärts aber nur noch durch eine Falte der Flügelmembran angedeutet.
Diese Eigentümlichkeit scheint bisher ganz übersehen worden zu sein, gibt aber ein viel schärferes
Trennungsmerkmal für die Subfamilie der Phaloniinae ab, als der weit distalwärts verlagerte Ursprung
von Ader IV2. Wahrscheinlich steht aber der Mangel von V hier im Zusammenhang mit
der Verlagerung von IV2, die am Saum ihre Vertretung übernimmt und an ihrer Stelle in den
Tornus mündet.
Endlich ist auf dem Vorderflügel Ader a sehr kräftig ausgeprägt; sie läuft nahe dem Dorsum
und mündet in dieses in der Nähe des Tornus. Ader ß vereinigt sich nach kurzem Verlauf aus der
Wurzel mit a und sendet keine Fortsetzung in den Dorsalrand. Dadurch wird der Eindruck erzeugt,
als sei Ader a gegen die Wurzel hin gabelig gespalten; so wird diese Eigentümlichkeit, die sich übrigens
noch bei einer ganzen Anzahl von Schmetterlingsfamilien findet, auch meist als „basale Gabelung“
der Ader a bezeichnet.
Auf den Hinterflügeln verhält sich Ader I wie auf den Vorderflügeln, nur-mündet sie weiter
spitzenwärts in die Costa. Ader II aber ist völlig unverzweigt; sie ist an der Basis eine Strecke weit
mit I vereinigt, entspringt also aus dieser und mündet vor der Spitze in die Costa. Vom Adersystem III
sind auch auf den Hinterflügeln nur die drei Äste IIIj, 2,3 vorhanden, die aus einer quer laufenden
meist winkelig gebrochenen Discoidalader entspringen, welche von II zu IV x zieht und eine Mittelzelle
abgrenzt. Selten entspringen diese drei Äste in annähernd gleichen Abständen von einander
und von Ader II (Taf. I, Fig. 43, Taf. II, Fig. 80); dann ist die Discoidalader mehrfach den Insertionsstellen
entsprechend schwach geknickt. Gewöhnlich ist IIIj stark an I I angenähert und I II2 näher an
I II3 gerückt. Dann macht die Discoidalader in dem weiteren Zwischenraum zwischen III * und I II2
einen wurzelwärts einspringenden Winkel, der vorderen Flügelfalte entsprechend, und ist beim Ursprung
von III3 saumwärts spitz ausgezogen (z. B. Taf II, Fig. 10 und viele andere Abb.). Meist
entspringt IIÜ ganz dicht bei II aus der vorderen Ecke der Mittelzelle, läuft eine Strecke weit ganz
nahe parallel mit II und entfernt sich erst später, um unter der Spitze in den Saum zu münden (z. B.
Taf. I, Fig. 62). Daraus folgt dann das weitere Verhalten, daß beide Adern eine Strecke weit völlig
vereinigt sind, also gestielt entspringen und sich saumwärts trennen (Taf. I, Fig. 47 u. a.). In ganzer
Länge vereinigt sind sie nur bei Carposina (Taf. I, Fig. 63). Auch die Adern I II2 und I I I3 sind mitunter
an ihrem Ursprung so genähert, daß sie aus einem Punkte kommen (Taf. I, Fig. 2).
Ader IV bildet den hinteren oder dorsalen Rand der Mittelzelle, ist hinter der Mitte ihres
Verlaufs schwach gebrochen und sendet hier Ast IV2 in die Mitte des Saumes; Ast IV j entspringt entweder
sehr nahe bei I II3 (Taf. 1, Fig. 5), oder mit ihm zusammen aus einem Punkte (Taf. I, Fig. 7,
Fig. 2 u. a.), oder mit I II3 auf gemeinschaftlichem Stiel (Taf. I, Fig. 1). Dieser gemeinschaftliche
Teil ist bald kurz, bald aber auch sehr lang, so daß erst nahe dem Saum die Gabelung stattfindet