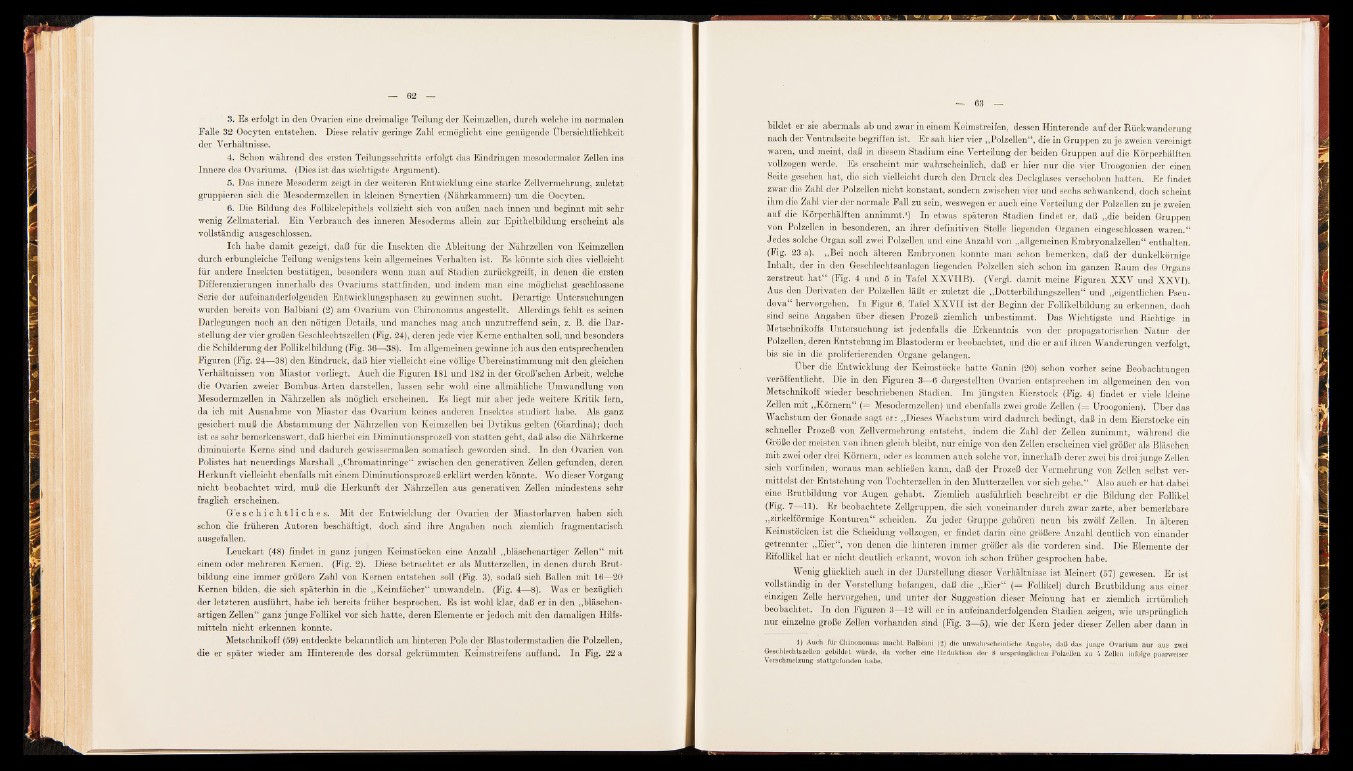
3. Es erfolgt in den Ovarien eine dreimalige Teilung der Keimzellen, durch welche im normalen
Falle 32 Oocyten entstehen. Diese relativ geringe Zahl ermöglicht eine genügende Übersichtlichkeit
der Verhältnisse.
4. Schon während des ersten Teilungsschritts erfolgt das Eindringen mesodermaler Zellen ins
Innere des Ovariums. (Dies ist das wichtigste Argument).
5. Das innere Mesoderm zeigt in der weiteren Entwicklung eine starke Zellvermehrung, zuletzt
gruppieren sich die Mesodermzellen in kleinen Syncytien (Nährkammern) um die Oocyten.
6. Die Bildung des Follikelepithels vollzieht sich von außen nach innen und beginnt mit sehr
wenig Zellmaterial. Ein Verbrauch des inneren Mesoderms allein zur Epithelbildung erscheint als
vollständig ausgeschlossen.
Ich habe damit gezeigt, daß für die Insekten die Ableitung der Nährzellen von Keimzellen
durch erbungleiche Teilung wenigstens kein allgemeines Verhalten ist. Es könnte sich dies vielleicht
für andere Insekten bestätigen, besonders wenn man auf Stadien zurückgreift, in denen die ersten
Differenzierungen innerhalb des Ovariums stattfinden, und indem man eine möglichst geschlossene
Serie der aufeinanderfolgenden Entwicklungsphasen zu gewinnen sucht. Derartige Untersuchungen
wurden bereits von Balkham (2) am Ovarium von Chironomus angestellt. Allerdings fehlt es seinen
Darlegungen noch an den nötigen Details, und manches mag auch unzutreffend sein, z. B. die Darstellung
der vier großen Geschlechtszellen (Fig. 24), deren jede vier Kerne enthalten soll, und besonders
die Schilderung der Follikelbildung (Fig. 36—38). Im allgemeinen gewinne ich aus den entsprechenden
Figuren (Fig. 24—38) den Eindruck, daß hier vielleicht eine völlige Übereinstimmung mit den gleichen
Verhältnissen von Miastor vorliegt. Auch die Figuren 181 und 182 in der Groß’schen Arbeit, welche
die Ovarien zweier Bombus-Arten darstellen, lassen sehr wohl eine allmähliche Umwandlung von
Mesodermzellen in Nährzellen als möglich erscheinen. Es liegt mir aber jede weitere Kritik fern,
da ich mit Ausnahme von Miastor das Ovarium keines anderen Insektes studiert habe. Als ganz
gesichert muß die Abstammung der Nährzellen von Keimzellen bei Dytikus gelten (Giardina); doch
ist es sehr bemerkenswert, daß hierbei ein Diminutiönsprozeß von statten geht, daß also die Nährkerne
diminuierte Kerne sind und dadurch gewissermaßen somatisch geworden sind. In den Ovarien von
Polistes hat neuerdings Marshall „Chromatinringe“ zwischen den generativen Zellen gefunden, deren
Herkunft vielleicht ebenfalls mit einem Diminutionsprozeß erklärt werden könnte. Wo dieser Vorgang
nicht beobachtet wird, muß die Herkunft der Nährzellen aus generativen Zellen mindestens sehr
fraglich erscheinen.
G‘e s c h i c h t l i c h e s . Mit der Entwicklung der Ovarien der Miastorlarven haben sich
schon die früheren Autoren beschäftigt, doch sind ihre Angaben noch ziemlich fragmentarisch
ausgefallen.
Leuckart (48) findet in ganz jungen Keimstöcken eine Anzahl „bläschenartiger Zellen“ mit
einem oder mehreren Kernen. (Fig. 2). Diese betrachtet er als Mutter zellen, in denen durch Brutbildung
eine immer größere Zahl von Kernen entstehen soll (Fig. 3), sodaß sich Ballen mit 16—20
Kernen bilden, die sich späterhin in die „Keimfächer“ um wandeln. (Fig. 4—8). Was er bezüglich
der letzteren ausführt, habe ich bereits früher besprochen. Es ist wohl klar, daß er in den „bläschenartigen
Zellen“ ganz junge Follikel vor sich hatte, deren Elemente er jedoch mit den damaligen Hilfsmitteln
nicht erkennen konnte.
Metschnikoff (59) entdeckte bekanntlich am hinteren Pole der Blastodermstadien die Polzellen,
die er später wieder am Hinterende des dorsal gekrümmten Keimstreifens auffand. In Fig. 22 a
bildet er sie abermals ab und zwar in einem Keimstreifen, dessen Hinterende auf der Rückwanderung
nach der Ventralseite begriffen ist. Er sah hier vier „Polzellen“, die in Gruppen zu je zweien vereinigt
waren, und meint, daß in diesem Stadium eine Verteilung der beiden Gruppen auf die Körperhälften
vollzogen werde. Es erscheint mir wahrscheinlich, daß er hier nur die vier Uroogonien der einen
Seite gesehen hat, die sich vielleicht durch den Druck des Deckglases verschoben hatten. Er findet
zwar die Zahl der Polzellen nicht konstant, sondern zwischen vier und sechs schwankend, doch scheint
ihm die Zahl vier der normale Fall zu sein, weswegen er auch eine Verteilung der Polzellen zu je zweien
auf die Körperhälften annimmt.1) In etwas späteren Stadien findet er, daß „die beiden Gruppen
von Polzellen in besonderen, an ihrer definitiven Stelle liegenden Organen eingeschlossen waren.“
Jedes solche Organ soll zwei Polzellen und eine Anzahl von „allgemeinen Embryonalzellen“ enthalten.
(Fig. 23 a). „Bei noch älteren Embryonen konnte man schon bemerken, daß der dunkelkörnige
Inhalt, der in den Geschlechtsanlagen liegenden Polzellen sich schon im ganzen Raum des Organs
zerstreut hat“ (Fig. 4 und 5 in Tafel XXVIIB). (Vergl. damit meine Figuren XXV und XXVI).
Aus den Derivaten der Polzellen läßt er zuletzt die „Dotterbildungszellen“ und „eigentlichen Pseu-
dova“ hervorgehen. In Figur 6, Tafel XXVII ist der Beginn der Follikelbildung zu erkennen, doch
sind seine Angaben über diesen Prozeß ziemlich unbestimmt. Das Wichtigste und Richtige in
Metschnikoffs Untersuchung ist jedenfalls die Erkenntnis von der propagatorischen Natur der
Polzellen, deren Entstehung im Blastoderm er beobachtet, und die er auf ihren Wanderungen verfolgt,
bis sie in die proliferierenden Organe gelangen.
Über die Entwicklung der Keimstöcke hatte Ganin (20) schon vorher seine Beobachtungen
veröffentlicht. Die in den Figuren 3—6 dargestellten Ovarien entsprechen im allgemeinen den von
Metschnikoff wieder beschriebenen Stadien. Im jüngsten Eierstock (Fig. 4) findet er viele kleine
Zellen mit „Körnern“ (= Mesodermzellen) und ebenfalls zwei große Zellen (= Uroogonien). Über das
Wachstum der Gonade sagt er: „Dieses Wachstum wird dadurch bedingt, daß in dem Eierstocke ein
schneller Prozeß von Zellvermehrung entsteht, indem die Zahl der Zellen zunimmt, während die
Größe der meisten von ihnen gleich bleibt, nur einige von den Zellen erscheinen viel größer als Bläschen
mit zwei oder drei Körnern, oder es kommen auch solche vor,.innerhalb derer zwei bis drei junge Zellen
sich vorfinden, woraus man schließen kann, daß der Prozeß der Vermehrung von Zellen selbst vermittelst
der Entstehung von Tochterzellen in den Mutterzellen vor sich gehe.“ Also auch er hat dabei
eine Brutbildung vor Augen gehabt. Ziemlich ausführlich beschreibt er die Bildung der Follikel
(Fig. 7—11). Er beobachtete Zellgruppen, die sich voneinander durch zwar zarte, aber bemerkbare
„zirkelförmige Konturen“ scheiden. Zu jeder Gruppe gehören neun bis zwölf Zellen. In älteren
Keimstöcken ist die Scheidung vollzogen, er findet darin eine größere Anzahl deutlich von einander
getrennter „Eier“, von denen die hinteren immer größer als die vorderen sind. Die Elemente der
Eifollikel hat er nicht deutlich erkannt, wovon ich schon früher gesprochen habe.
Wenig glücklich auch in der Darstellung dieser Verhältnisse ist Meinert (57) gewesen. Er ist
vollständig in der Vorstellung befangen, daß die „Eier“ (= Follikel) durch Brutbüdung aus einer
einzigen Zelle hervorgehen, und unter der Suggestion dieser Meinung hat er ziemlich irrtümlich
beobachtet. In den Figuren 3—12 will er in aufeinanderfolgenden Stadien zeigen, wie ursprünglich
nur einzelne große Zellen vorhanden sind (Fig. 3—5), wie der Kern jeder dieser Zellen aber dann in
1) Auch für Chinonomus macht Balbiani (2) die unwahrscheinliche Angabe, daß das junge Ovarium nur aus zwei
Geschlechtszellen gebildet würde, da vorher eine Reduktion der 8 ursprünglichen Polzellen zu 4 Zellen infolge paarweiser.
Verschmelzung stattgefunden habe.