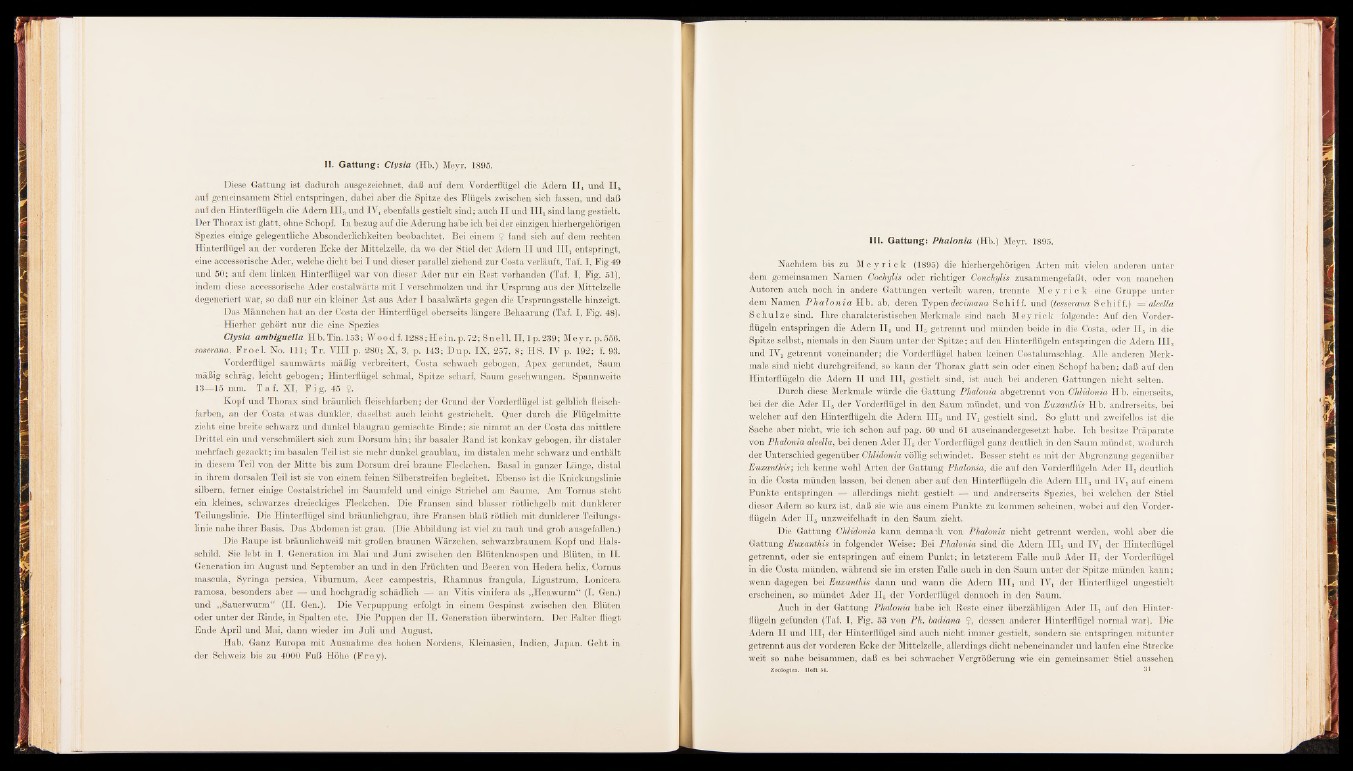
II. Gattung: Clysia (Hb.) Meyr. 1895.
Diese Gattung ist dadurch ausgezeichnet, daß auf dem Vorderflügel die Adern II4 und I I5
auf gemeinsamem Stiel entspringen, dabei aber die Spitze des Flügels zwischen sich fassen, und daß
auf den Hinterflügeln die Adern I II3 und IVX ebenfalls gestielt sind; auch II und IIIj sind lang gestielt.
Der Thorax ist glatt, ohne Schopf. In bezug auf die Äderung habe ich bei der einzigen hierhergehörigen
Spezies einige gelegentliche Absonderlichkeiten beobachtet. Bei einem $ fand sich auf dem rechten
Hinterflügel an der vorderen Ecke der Mittelzelle, da wo der Stiel der Adern II und IIIX entspringt,
eine accessorische Ader, welche dicht bei I und dieser parallel ziehend zur Costa verläuft, Taf. I, Fig 49
und 50; auf dem linken Hinterflügel war von dieser Ader nur ein Rest vorhanden (Taf. I, Fig. 51),
indem diese accessorische Ader costalwärts mit I verschmolzen und ihr Ursprung aus der Mittelzelle
degeneriert war, so daß nur ein kleiner Ast aus Ader I basalwärts gegen die Ursprungsstelle hinzeigt.
Das Männchen hat an der Costa der Hinterflügel oberseits längere Behaarung (Taf. I, Fig. 48).
Hierher gehört nur die eine Spezies
Clysia ambiguella Hb. Tin. 153; W o o d f.l2 8 8 ;H e in .p .7 2 ;Sn e ll. II, lp.239; Meyr. p. 556.
roserana, Froel . No. 111; Tr. VIII p. 280; X, 3, p. 143; Dup. IX, 257, 8; HS. IV p. 192; f. 93.
Vorderflügel saumwärts mäßig verbreitert, Costa schwach gebogen, Apex gerundet, Saum
mäßig schräg, leicht gebogen; Hinterflügel schmal, Spitze scharf, Saum geschwungen. Spannweite
13—15 mm. T a f . XI, Fi g . 45 $.
Kopf und Thorax sind bräunlich fleischfarben; der Grund der Vorderflügel ist gelblich fleischfarben,
an der Costa etwas dunkler, daselbst auch leicht gestrichelt. Quer durch die Flügelmitte
zieht eine breite schwarz und dunkel blaugrau gemischte Binde; sie nimmt an der Costa das mittlere
Drittel ein und verschmälert sich zum Dorsum hin; ihr basaler Rand ist konkav gebogen, ihr distaler
mehrfach gezackt; im basalen Teil ist sie mehr dunkel graublau, im distalen mehr schwarz und enthält
in diesem Teil von der Mitte bis zum Dorsum drei braune Fleckchen. Basal in ganzer Länge, distal
in ihrem dorsalen Teil ist sie von einem feinen Silberstreifen begleitet. Ebenso ist die Knickungslinie
silbern, ferner einige Costalstrichel im Saumfeld und einige Strichei am Saume. Am Tornus steht
ein kleines, schwarzes dreieckiges Fleckchen. Die Fransen sind blasser rötlichgelb mit dunklerer
Teilungslinie. Die Hinterflügel sind bräunlichgrau, ihre Fransen blaß rötlich mit dunklerer Teilungslinie
nahe ihrer Basis. Das Abdomen ist grau. (Die Abbildung ist viel zu rauh und grob ausgefallen.)
Die Raupe ist bräunlichweiß mit großen braunen Wärzchen, schwarzbraunem Kopf und Halsschild.
Sie lebt in I. Generation im Mai und Juni zwischen den Blütenknospen und Blüten, in II.
Generation im August und September an und in den Früchten und Beeren von Hedera helix, Cornus
mascula, Syringa persica, Viburnum, Acer campestris, Rhamnus frangula, Ligustrum, Lonicera
ramosa, besonders aber — und hochgradig schädlich — an Vitis vinifera als „Heuwurm“ (I. Gen.)
und „Sauerwurm“ (II. Gen.). Die Verpuppung erfolgt in einem Gespinst zwischen den Blüten
oder unter der Rinde, in Spalten etc. Die Puppen der II. Generation überwintern. Der Falter fliegt
Ende April und Mai, dann wieder im Juli und August.
Hab. Ganz Europa mit Ausnahme des hohen Nordens, Kleinasien, Indien, Japan. Geht in
der Schweiz bis zu 4000 Fuß Höhe (Frey).
III. Gattung: Phalonia (Hb.) Meyr. 1895.
Nachdem bis zu M e y r i c k (1895) die hierhergehörigen Arten mit vielen anderen unter
dem gemeinsamen Namen Cochylis oder richtiger Conchylis zusammengefaßt, oder von manchen
Autoren auch noch in andere Gattungen verteilt waren, trennte M e y r i c k eine Gruppe unter
dem Namen P h a lo n ia Hb. ab, deren Typendecimana Schiff, und (tesserana Schiff.) P f aleella
Schu l ze sind. Ihre charakteristischen Merkmale sind nach Meyri ck folgende: Auf den Vorderflügeln
entspringen die Adern I I4 und I I5 getrennt und münden beide in die Costa, oder I IS in die
Spitze selbst, niemals in den Saum unter der Spitze; auf den Hinterflügeln entspringen die Adern I I I3
und IVX getrennt voneinander; die Vorderflügel haben keinen Costalumschlag. Alle anderen Merkmale
sind nicht durchgreifend, so kann der Thorax glatt sein oder einen Schopf haben; daß auf den
Hinterflügeln die Adern I I und IIIX gestielt sind, ist auch bei anderen Gattungen nicht selten.
Durch diese Merkmale würde die Gattung Phalonia abgetrennt von Chlidonia Hb. einerseits,
bei der die Ader I I5 der Vorderflügel in den Saum mündet, und von Euxanthis Hb. andrerseits, bei
welcher auf den Hinterflügeln die Adern I I I3 und IVX gestielt sind. So glatt und zweifellos.ist die
Sache aber nicht, wie ich schon auf pag. 60 und 61 auseinandergesetzt habe. Ich besitze Präparate
von Phalonia aleella, bei denen Ader I I 5 der Vorderflügel ganz deutlich in den Saum mündet, wodurch
der Unterschied gegenüber Chlidonia völlig schwindet. Besser steht es mit der Abgrenzung gegenüber
Euxanthis; ich kenne wohl Arten der Gattung Phalonia, die auf den Vorderflügeln Ader I I 5 deutlich
in die Costa münden lassen, bei denen aber auf den Hinterflügeln die Adern I II3 und IVX auf einem
Punkte entspringen — allerdings nicht gestielt — und andrerseits Spezies, bei welchen der Stiel
dieser Adern so kurz ist, daß sie wie aus einem Punkte zu kommen scheinen, wobei auf den Vorderflügeln
Ader I I5 unzweifelhaft in den Saum zieht.
Die Gattung Chlidonia kann demnach von Phalonia nicht getrennt werden, wohl aber die
Gattung Euxanthis in folgender Weise: Bei Phalonia sind die Adern I II3 und IVX der Hinterflügel
getrennt, oder sie entspringen auf einem Punkt; in letzterem Falle muß Ader I I 5 der Vorderflügel
in die Costa münden, während sie im ersten Falle auch in den Saum unter der Spitze münden kann;
wenn dagegen bei Euxanthis dann und wann die Adern I II3 und IVX der Hinterflügel ungestielt
erscheinen, so mündet Ader I I 5 der Vorderflügel dennoch in den Saum.
Auch in der Gattung Phalonia habe ich Reste einer überzähligen Ader I IX auf den Hinterflügeln
gefunden (Taf. I, Fig. 53 von Ph. badiana % dessen anderer Hinterflügel normal war). Die
Adern II und III], der Hinterflügel sind auch nicht immer gestielt, sondern sie entspringen mitunter
getrennt aus der vorderen Ecke der Mittelzelle, allerdings dicht nebeneinander und laufen eine.Strecke
weit so nahe beisammen, daß es bei schwacher Vergrößerung wie ein gemeinsamer Stiel aussehen
Zoologica. lie f t 64. 31