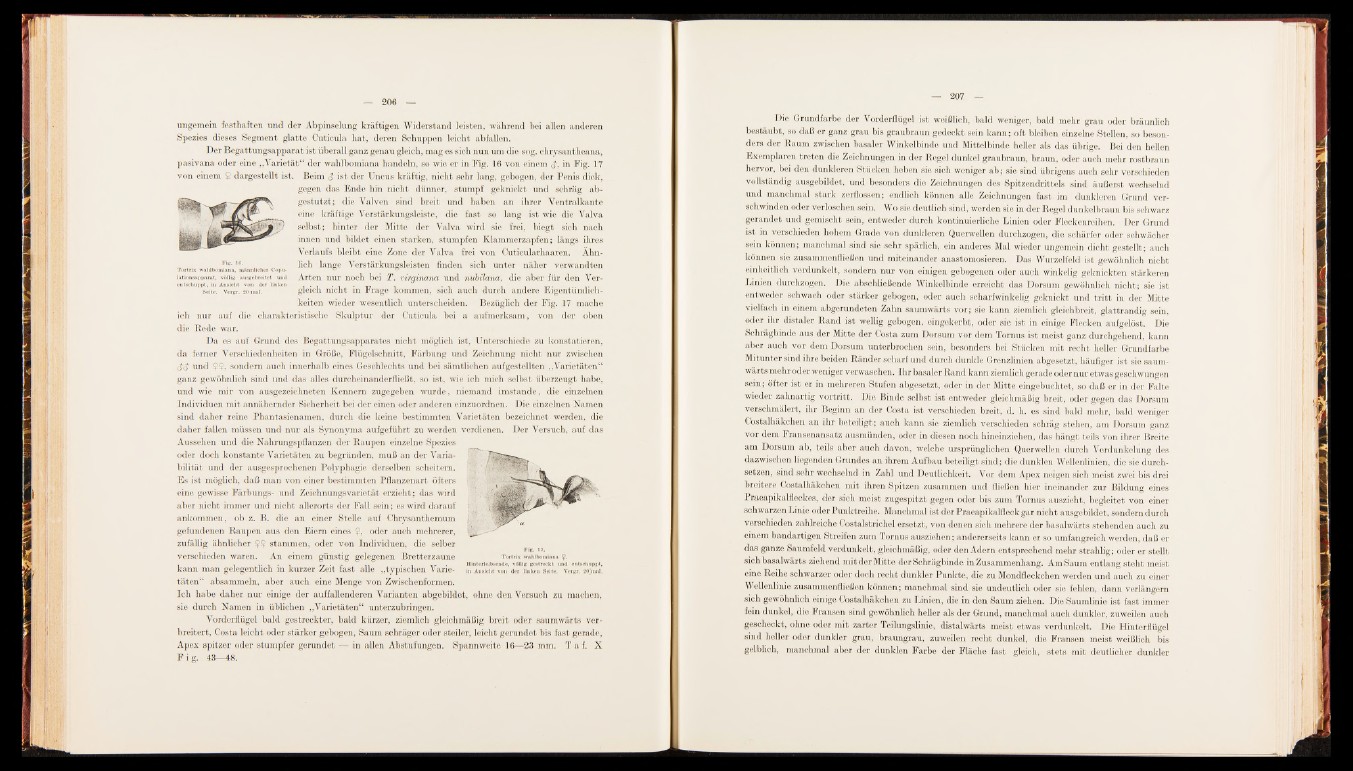
ungemein festhaften und der Abpinselung kräftigen Widerstand leisten, während bei allen anderen
Spezies dieses Segment glatte Cuticula hat, deren Schuppen leicht abfallen.
Der Begattungsapparat ist überall ganz genau gleich, mag es sich nun um die sog. chrysantheana,
pasivana oder eine „Varietät“ der wahlbomiana handeln, so wie er in Fig. 16 von einem <$, in Fig. 17
von einem $ dargestellt ist. Beim ist der Uncus kräftig, nicht sehr lang, gebogen, der Penis dick,
gegen das Ende hin nicht dünner, stumpf geknickt und schräg abgestutzt;
die Valven sind breit und haben an ihrer Ventralkante
eine kräftige Verstärkungsleiste, die fast so lang ist wie die Valva
selbst; hinter der Mitte der Valva wird sie frei, biegt sich nach
innen und bildet einen starken, stumpfen Klammerzapfen; längs ihres
Verlaufs bleibt eine Zone der Valva frei von Cuticularhaaren. Ähnlich
lange Verstärkungsleisten finden sich unter näher verwandten
Arten nur noch bei T. virginana und nubüana, die aber für den Vergleich
nicht in Frage kommen, sich auch durch andere Eigentümlichkeiten
wieder wesentlich unterscheiden. Bezüglich der Fig. 17 mache
lgj||
M i t
Seite. Vorgr. 20 11
ich nur auf die charakteristische Skulptur der Cuticula bei a aufmerksam, von der oben
die Rede war.
Da es auf Grund des Begattungsapparates nicht möglich ist, Unterschiede zu konstatieren,
da ferner Verschiedenheiten in Größe, Flügelschnitt, Färbung und Zeichnung nicht nur zwischen
cJ<? und $$, sondern auch innerhalb eines Geschlechts und bei sämtlichen au fgestellten „Varietäten“
ganz gewöhnlich sind und das alles durcheinanderfließt, so ist, wie ich mich selbst überzeugt habe,
und wie mir von ausgezeichneten Kennern zugegeben wurde, niemand imstande, die einzelnen
Individuen mit annähernder Sicherheit bei der einen oder anderen einzuordnen. Die einzelnen Namen
sind daher reine Phantasienamen, durch die keine bestimmten Varietäten bezeichnet werden, die
daher fallen müssen und nur als Synonyma auf geführt zu werden verdienen. Der Versuch, auf das
Aussehen und die Nahrungspflanzen der Raupen einzelne Spezies
oder doch konstante Varietäten zu begründen, muß an der Variabilität
und der ausgesprochenen Polyphagie derselben scheitern.
Es ist möglich, daß man von einer bestimmten Pflanzenart öfters
eine gewisse Färbungs- und Zeichnungsvarietät erzieht; das wird
aber nicht immer und nicht allerorts der Fall sein; es wird darauf
ankommen, ob z. B. die an einer Stelle auf Chrysanthemum
gefundenen Raupen aus den Eiern eines $, oder auch mehrerer,
zufällig ähnlicher $$ stammen, oder von Individuen, die selber
verschieden waren. An einem günstig gelegenen Bretterzäune Tortrix wahlbomiana $.
kann man gelegentlich in kurzer Zeit fast alle „typischen Varie- in Andct«^^der wM*n,
täten“ absammeln, aber auch eine Menge von Zwischenformen.
Ich habe daher nur einige der auffallenderen Varianten abgebildet, ohne den Versuch zu machen,
sie durch Namen in üblichen „Varietäten“ unterzubringen.
Vorderflügel bald gestreckter, bald kürzer, ziemlich gleichmäßig breit oder saumwärts verbreitert,
Costa leicht oder stärker gebogen, Saum schräger oder steiler, leicht gerundet bis fast gerade,
Apex spitzer oder stumpfer gerundet — in allen Abstufungen. Spannweite 16—23 mm. Taf. X
Fi g . 43—48.
Die Grundfarbe der Vorderflügel ist weißlich, bald weniger, bald mehr grau oder bräunlich
bestäubt, so daß er ganz grau bis graubraun gedeckt sein kann; oft bleiben einzelne Stellen, so besonders
der Raum zwisohen basaler Winkelbinde und Mittelbinde heller als das übrige. Bei den hellen
Exemplaren treten die Zeichnungen in der Regel dunkel graubraun, braun, oder auch mehr rostbraun
hervor, bei den dunkleren Stücken heben sie sich weniger ab; sie sind übrigens auch sehr verschieden
vollständig ausgebildet, und besonders die Zeichnungen des Spitzendrittels sind äußerst wechselnd
und manchmal stark zerflossen; endlich können alle Zeichnungen fast im dunkleren Grund verschwinden
oder verloschen sein. Wo sie deutlich sind, werden sie in der Regel dunkelbraun bis schwarz
gerandet und gemischt sein, entweder durch kontinuierliche Linien oder Flecken reihen. Der Grund
ist in verschieden hohem Grade von dunkleren Querwellen durchzogen, die schärfer oder schwächer
sein können; manchmal sind sie sehr spärlich, ein anderes Mal wieder ungemein dicht gestellt; auch
können sie zusammenfließen und miteinander anastomosieren. Das Wurzelfeld ist gewöhnlich nicht
einheitlich verdunkelt, sondern nur von einigen gebogenen oder auch winkelig geknickten stärkeren
Linien durchzogen. Die abschließende Winkelbinde erreicht das Dorsum gewöhnlich nicht; sie ist
entweder schwach oder stärker gebogen, oder auch scharfwinkelig geknickt und tritt in der Mitte
vielfach in einem abgerundeten Zahn saumwärts vor; sie kann ziemlich gleichbreit, glattrandig sein,
oder ihr distaler Rand ist wellig gebogen, eingekerbt, oder sie ist in einige Flecken aufgelöst. Die
Schrägbinde aus der Mitte der Costa zum Dorsum vor dem Tomus ist meist ganz durchgehend, kann
aber auch vor dem Dorsum unterbrochen sein, besonders bei Stücken mit recht heller Grundfarbe
Mitunter sind ihre beiden Ränder scharf und durch dunkle Grenzlinien abgesetzt, häufiger ist sie saumwärts
mehr oder weniger verwaschen. Ihr basaler Rand kann ziemlich gerade oder nur etwas geschwungen
sein; öfter ist er in mehreren Stufen abgesetzt, oder in der Mitte eingebuchtet, so daß er in der Falte
wieder zahnartig vortritt. Die Binde selbst ist entweder gleichmäßig breit, oder gegen das Dorsum
verschmälert, ihr Beginn an der Costa ist verschieden breit, d. h. es sind bald mehr, bald weniger
Costalhäkchen an ihr beteiligt; auch kann sie ziemlich verschieden schräg stehen, am Dorsum ganz
vor dem Fransenansatz ausmünden, oder in diesen noch hineinziehen, das hängt teils von ihrer Breite
am Dorsum ab, teils aber auch davon, welche ursprünglichen Querwellen durch Verdunkelung des
dazwischen hegenden Grundes an ihrem Aufbau beteiligt sind; die dunklen Wellenlinien, die sie durchsetzen,
sind sehr wechselnd in Zahl und Deutlichkeit. Vor dem Apex neigen sich meist zwei bis drei
breitere Costalhäkchen mit ihren Spitzen zusammen und fließen hier ineinander zur Bildung eines
Praeapikalfleckes, der sich meist zugespitzt gegen oder bis zum Tornus auszieht, begleitet von einer
schwarzen Linie oder Punktreihe. Manchmal istderPraeapikalfleckgar nicht ausgebildet, sondern durch
verschieden zahlreiche Costalstrichel ersetzt, von denen sich mehrere der basalwärts stehenden auch zu
einem bandartigen Streifen zum Tornus ausziehen; andererseits kann er so umfangreich werden, daß er
das ganze Saumfeld verdunkelt, gleichmäßig, oder den Adern entsprechend mehr strahlig; oder er stellt
sich basalwärts ziehend mit der Mitte der Schrägbinde in Zusammenhang. Am Saum entlang steht meist
eine Reihe schwarzer oder doch recht dunkler Punkte, die zu Mondfleckchen werden und auch zu einer
Wellenlinie zusammenfließen können; manchmal sind sie undeutlich oder sie fehlen, dann verlängern
sich gewöhnlich einige Costalhäkchen zu Linien, die in den Saum ziehen. Die Saumlinie ist fast immer
fein dunkel, die Fransen sind gewöhnlich heller als der Grund, manchmal auch dunkler, zuweilen auch
gescheckt, ohne oder mit zarter Teilungslinie, distalwärts meist etwas verdunkelt. Die Hinterflügel
sind heller oder dunkler grau, braungrau, zuweilen recht dunkel, die Fransen meist weißlich bis
gelblich, manchmal aber der dunklen Farbe der Fläche fast gleich, stets mit deutlicher dunkler