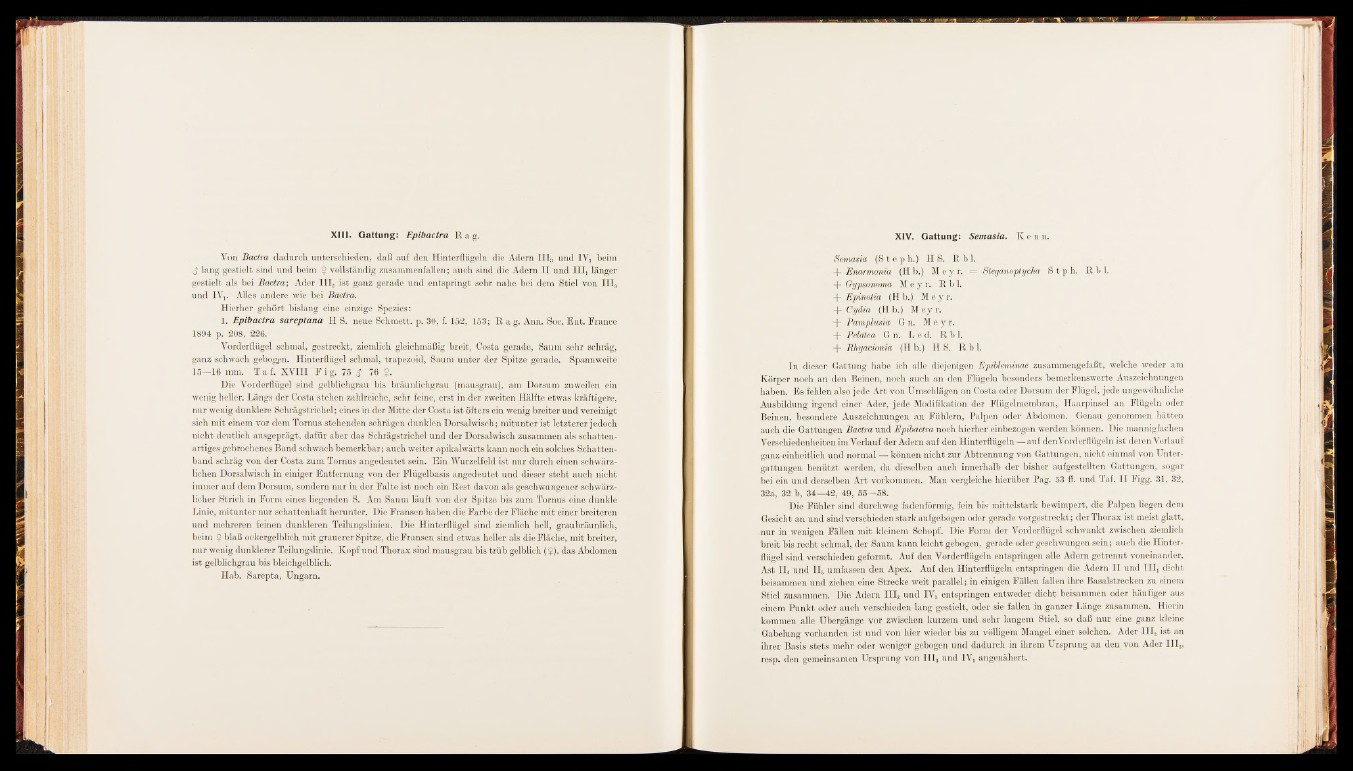
XIII. Gattung: Epibactra Rag.
Von Bactra dadurch unterschieden, daß auf den Hinterflügeln die Adern III3 und IVX beim
<$ lang gestielt sind und beim $ vollständig zusammenfallen; auch sind die Adern II und IIIx länger
gestielt als bei Bactra', Ader III2 ist ganz gerade und entspringt sehr nahe bei dem Stiel von III3
und IVX. Alles andere wie bei Bactra.
Hierher gehört bislang eine einzige Spezies:
1. Epibactra sareptana H S. neue Schmett. p. 30, f. 152, 153; Rag . Ann. Soc. Ent. France
1894 p. 208, 226.
Vorderflügel schmal, gestreckt, ziemlich gleichmäßig breit, Costa gerade, Saum sehr schräg,
ganz schwach gebogen. Hinterflügel schmal, trapezoid, Saum unter der Spitze gerade. Spannweite
15—16 mm. T a f . XVIII F i g. 75 $ 76 Jp.
Die Vorderflügel sind gelblichgrau bis bräunlichgrau (mausgrau), am Dorsum zuweilen ein
wenig heller. Längs der Costa stehen zahlreiche, sehr feine, erst in der zweiten Hälfte etwas kräftigere,
nur wenig dunklere Schrägstrichel; eines in der Mitte der Costa ist öfters ein wenig breiter und vereinigt
sich mit einem vor dem Tornus stehenden schrägen dunklen Dorsalwisch; mitunter ist letzterer jedoch
nicht deutlich ausgeprägt, dafür aber das Schrägstrichel und der Dorsalwisch zusammen als schattenartiges
gebrochenes Band schwach bemerkbar; auch weiter apikalwärts kann noch ein solches Schattenband
schräg von der Costa zum Tornus angedeutet sein. Ein Wurzelfeld ist nur durch einen schwärzlichen
Dorsal wisch in einiger Entfernung Von der Flügelbasis angedeutet und dieser steht auch nicht
immer auf dem Dorsum, sondern nur in der Falte ist noch ein Rest davon als geschwungener schwärzlicher
Strich in Form eines liegenden S. Am Saum läuft von der Spitze bis zum Tornus eine dunkle
Linie, mitunter nur schattenhaft herunter. Die Fransen haben die Farbe der Fläche mit einer breiteren
und mehreren feinen dunkleren Teilungslinien. Die Hinterflügel sind ziemlich hell, graubräunlich,
beim $ blaß ockergelblich mit grauerer Spitze, die Fransen sind etwas heller als die Fläche, mit breiter,
nur wenig dunklerer Teilungslinie. Kopf und Thorax sind mausgrau bis trüb gelblich ($), das Abdomen
ist gelblichgrau bis bleichgelblich.
Hab. Sarepta, Ungarn.
XIV. Ga ttung: Semasia. Ke n n .
Semasia ( S t e p h.) HS. R b l .
Enarmonia (Hb.) Me y r . = Sieganoptycha S t p h . R b 1.
+ Gypsonoina Me y r . Rbl .
+ Epinotia (Hb.) Meyr .
+ Cydia (Hb.) Meyr .
+ Pamplusia Gn. Meyr .
+ Pelatea G n. L e d. Rbl .
+ Rhyacionia (Hb.) HS. Rbl .
In dieser Gattung habe ich alle diejenigen Epibleminae zusammengefaßt, welche weder am
Körper noch an den Beinen, noch auch an den Flügeln besonders bemerkenswerte Auszeichnungen
haben. Es fehlen also jede Art von Umschlägen an Costa oder Dorsum der Flügel, jede ungewöhnliche
Ausbildung irgend einer Ader, jede Modifikation der Flügelmembran, Haarpinsel an Flügeln oder
Beinen, besondere Auszeichnungen an Fühlern, Palpen oder Abdomen. Genau genommen hätten
auch die Gattungen Bactra und Epibactra noch hierher einbezogen werden können. Die mannigfachen
Verschiedenheiten im Verlauf der Adern auf den Hinterflügeln—auf denVorderflügeln ist deren Verlauf
ganz einheitlich und normal — können nicht zur Abtrennung von Gattungen, nicht einmal von Untergattungen
benützt werden, da dieselben auch innerhalb der bisher aufgestellten Gattungen, sogar
bei ein und derselben Art Vorkommen. Man vergleiche hierüber Pag. 53 ff. und Taf. I I Figg. 31, 32,
32a, 32 b, 34—42, 49, 55—58.
Die Fühler sind durchweg fadenförmig, fein bis mittelstark bewimpert, die Palpen liegen dem
Gesicht an und sind verschieden stark aufgebogen oder gerade vorgestreckt; der Thorax ist meist glatt,
nur in wenigen Fällen mit kleinem Schopf. Die Form der Vorderflügel schwankt zwischen ziemlich
breit bis recht schmal, der Saum kann leicht gebogen, gerade oder geschwungen sein; auch die Hinterflügel
sind verschieden geformt. Auf den Vorderflügeln entspringen alle Adern getrennt voneinander,
Ast II4 und II5 umfassen den Apex. Auf den Hinterflügeln entspringen die Adern I I und IIIx dicht
beisammen und ziehen eine Strecke weit parallel; in einigen Fällen fallen ihre Basalstrecken zu einem
Stiel zusammen. Die Adern III3 und IVx entspringen entweder dicht beisammen oder häufiger aus
einem Punkt oder auch verschieden lang gestielt, oder sie fallen in ganzer Länge zusammen. Hierin
kommen alle Übergänge vor zwischen kurzem und sehr langem Stiel,, so daß nur eine ganz kleine
Gabelung vorhanden ist und von hier wieder bis zu völligem Mangel einer solchen. Ader III2 ist an
ihrer Basis stets mehr oder weniger gebogen und dadurch in ihrem Ursprung an den von Ader III3,
resp. den gemeinsamen Ursprung von III3 und IVX angenähert.