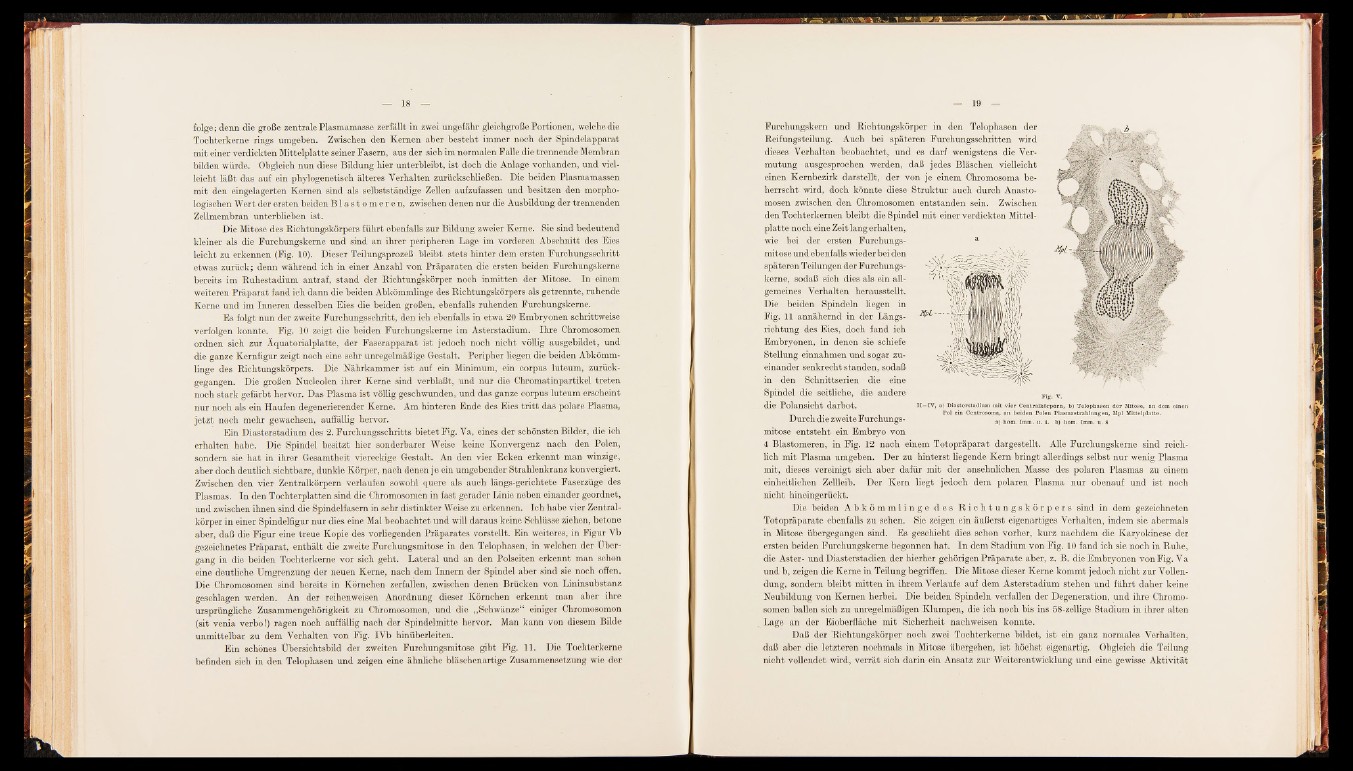
folge; denn die große zentrale Plasmamasse zerfällt in zwei ungefähr gleichgroße Portionen, welche die
Tochterkerne rings umgeben. Zwischen den Kernen aber besteht immer noch der Spindelapparat
mit einer verdickten Mittelplatte seiner Fasern, aus der sich im normalen Falle die trennende Membran
bilden würde. Obgleich nun diese Bildung hier unterbleibt, ist doch die Anlage vorhanden, und vielleicht
läßt das auf ein phylogenetisch älteres Verhalten zurückschließen. Die beiden Plasmamassen
mit den eingelagerten Kernen sind als selbstständige Zellen aufzufassen und besitzen den morphologischen
Wert der ersten beiden Bl a s t ome r e n , zwischen denen nur die Ausbildung der trennenden
Zellmembran unterblieben ist.
Die Mitose des Richtungskörpers führt ebenfalls zur Bildung zweier Kerne. Sie sind bedeutend
kleiner als die Furchungskerne und sind an ihrer peripheren Lage im vorderen Abschnitt des Eies
leicht zu erkennen (Fig. 10). Dieser Teilungsprozeß bleibt stets hinter dem ersten Furchungsschritt
etwas zurück; denn während ich in einer Anzahl von Präparaten die ersten beiden Furchungskerne
bereits im Ruhestadium antraf, stand der Richtungskörper noch inmitten der Mitose. In einem
weiteren Präparat fand ich dann die beiden Abkömmlinge des Richtungskörpers als getrennte, ruhende
Kerne und im Inneren desselben Eies die beiden großen, ebenfalls ruhenden Furchungskerne.
Es folgt nun der zweite Furchungsschritt, den ich ebenfalls in etwa 20 Embryonen schrittweise
verfolgen konnte. Fig. 10 zeigt die beiden Furchungskerne im Asterstadium. Ihre Chromosomen
ordnen sich zur Äquatorialplatte, der Faserapparat ist jedoch noch nicht völlig ausgebildet, und
die ganze Kernfigur zeigt noch eine sehr unregelmäßige Gestalt. Peripher liegen die beiden Abkömmlinge
des Richtungskörpers. Die Nährkammer ist auf ein Minimum, ein corpus luteum, zurückgegangen.
Die großen Nucleolen ihrer Kerne sind verblaßt, und nur die Chromatinpartikel treten
noch stark gefärbt hervor. Das Plasma ist völlig geschwunden, und das ganze corpus luteum erscheint
nur noch als ein Haufen degenerierender Kerne. Am hinteren Ende des Eies tritt das polare Plasma,
jetzt noch mehr gewachsen, auffällig hervor.
Ein Diasterstadium des 2. Furchungsschritts bietet Fig. Va, eines der schönsten Bilder, die ich
erhalten habe. Die Spindel besitzt hier sonderbarer Weise keine Konvergenz nach den Polen,
sondern sie hat in ihrer Gesamtheit viereckige Gestalt. An den vier Ecken erkennt man winzige,
aber doch deutlich sichtbare, dunkle Körper, nach denen je ein umgebender Strahlenkranz konvergiert.
Zwischen den vier Zentralkörpern verlaufen sowohl quere als auch längs-gerichtete Faserzüge des
Plasmas. In den Tochterplatten sind die Chromosomen in fast gerader Linie neben einander geordnet,
und zwischen ihnen sind die Spindelfasern in sehr distinkter Weise zu erkennen. Ich habe vier Zentralkörper
in einer Spindelfigur nur dies eine Mal beobachtet und will daraus keine Schlüsse ziehen, betone
aber, daß die Figur eine treue Kopie des vorliegenden Präparates vorstellt. Ein weiteres, in Figur Vb
gezeichnetes Präparat, enthält die zweite Furchungsmitose in den Telophasen, in welchen der Übergang
in die beiden Tochterkeme vor sich geht. Lateral und an den Polseiten erkennt man schon
eine deutliche Umgrenzung der neuen Kerne, nach dem Innern der Spindel aber sind sie noch offen.
Die Chromosomen sind bereits in Körnchen zerfallen, zwischen denen Brücken von Lininsubstanz
geschlagen werden. An der reihenweisen Anordnung dieser Körnchen erkennt man aber ihre
ursprüngliche Zusammengehörigkeit zu Chromosomen, und die „Schwänze“ einiger Chromosomon
(sit venia verbo!) ragen noch auffällig nach der Spindelmitte hervor. Man kann von diesem Bilde
unmittelbar zu dem Verhalten von Fig. IVb hinüberleiten.
Ein schönes Ubersichtsbild der zweiten Furchungsmitose gibt Fig. 11. Die Tochterkerne
befinden sich in den Telophasen und zeigen eine ähnliche bläschenartige Zusammensetzung wie der
p l l
Furchungskern und Richtungskörper in den Telophasen der
Reifungsteilung. Auch bei späteren Furchungsschritten wird
dieses Verhalten beobachtet, und es darf wenigstens die Vermutung
ausgesprochen werden, daß jedes Bläschen vielleicht
einen Kernbezirk darstellt, der von je einem Chromosoma beherrscht
wird, doch könnte diese Struktur auch durch Anasto-
mosen zwischen den Chromosomen entstanden sein. Zwischen
den Tochterkernen bleibt die Spindel mit einer verdickten Mittelplatte
b l
noch eine Zeit lang erhalten,
wie bei der ersten Furchungs- a
mitose und ebenfalls wieder bei den
späteren Teilungen der Furchungskerne,
sodaß sich dies als ein allgemeines
Verhalten herausstellt.
Die beiden Spindeln liegen in
Fig. 11 annähernd in der Längsrichtung
des Eies, doch fand ich
Embryonen, in denen sie schiefe
Stellung einnahmen und sogar zueinander
senkrecht standen, sodaß
in den Schnittserien die eine
Spindel die seitliche, die andere
die Polansicht darbot.
Durch die zweite Furchungsmitose
entsteht ein Embryo von
Fig. v.
ier Centralkörpern, b) Telophas
l der Mitose,
l beiden Polen Plasmastrahlungen, Mpl Mittelplatte,
a) ho m. Imin. u. 4. b) liom. Imm. u. 8
4 Blastomeren, in Fig. 12 nach einem Totopräparat dargestellt. Alle Furchungskerne sind reichlich
mit Plasma umgeben. Der zu hinterst liegende Kern bringt allerdings selbst nur wenig Plasma
mit, dieses vereinigt sich aber dafür mit der ansehnlichen Masse des polaren Plasmas zu einem
einheitlichen Zellleib. Der Kern liegt jedoch dem polaren Plasma nur obenauf und ist noch
nicht hineingerückt.
Die beiden A b k ö m m l i n g e d e s R i c h t u n g s k ö r p e r s sind in dem gezeichneten
Totopräparate ebenfalls zu sehen. Sie zeigen ein äußerst eigenartiges Verhalten, indem sie abermals
in Mitose übergegangen sind. Es geschieht dies schon vorher, kurz nachdem die Karyokinese der
ersten beiden Furchungskerne begonnen hat. In dem Stadium von Fig. 10 fand ich sie noch in Ruhe,
die Aster- und Diasterstadien der hierher gehörigen Präparate aber, z. B. die Embryonen von Fig. Va
und b, zeigen die Kerne in Teilung begriffen. Die Mitose dieser Kerne kommt jedoch nicht zur Vollendung,
sondern bleibt mitten in ihrem Verlaufe auf dem Asterstadium stehen und führt daher keine
Neubildung von Kernen herbei. Die beiden Spindeln verfallen der Degeneration, und ihre Chromosomen
ballen sich zu unregelmäßigen Klumpen, die ich noch bis ins 58-zellige Stadium in ihrer alten
Lage an der Eioberfläche mit Sicherheit nachweisen konnte.
Daß der Richtungskörper noch zwei Tochterkerne bildet, ist ein ganz normales Verhalten,
daß aber die letzteren nochmals in Mitose übergehen, ist höchst eigenartig. Obgleich die Teilung
nicht vollendet wird, verrät sich darin ein Ansatz zur Weiterentwicklung und eine gewisse Aktivität