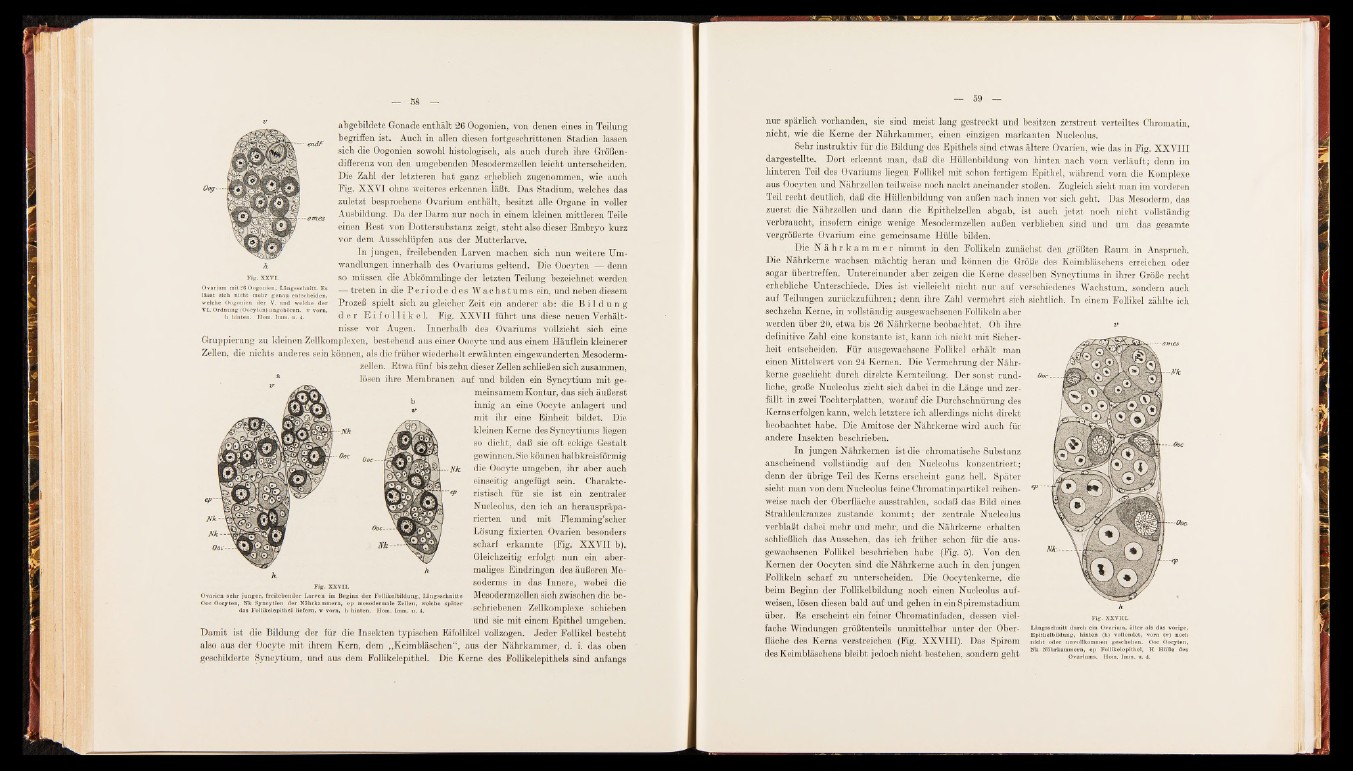
h
Fig. XXVI.
Ovarium mit ?6 Oogonien, Längsschnitt. Es
lä sst sich nicht mehr genau entscheiden,
welche Oogonien der V. und welche dei
VI. Ordnung (Oocyten) angehören, v vorn,
h hinten. Hom. Imm. u. 4.
abgebildete Gonade enthält 26 Oogonien, von denen eines in Teilung
begriffen ist. Auch in allen diesen fortgeschrittenen Stadien lassen
[¡sich die Oogonien sowohl histologisch, als auch durch ihre Größendifferenz
von den umgebenden Mesodermzellen leicht unterscheiden.
Die Zahl der letzteren hat ganz erheblich zugenommen, wie auch
Fig. XXVI ohne weiteres erkennen läßt. Das Stadium, welches das
zuletzt besprochene Ovarium enthält, besitzt alle Organe in voller
Ausbildung. Da der Darm nur noch in einem kleinen mittleren Teile
einen Rest von Dottersubstanz zeigt, steht also dieser Embryo kurz
vor dem Ausschlüpfen aus der Mutterlarve.
In jungen, freilebenden Larven machen sich nun weitere Umwandlungen
innerhalb des Ovariums geltend. Die Oocyten — denn
so müssen die Abkömmlinge der letzten Teilung bezeichnet werden
k— treten in die Per iode des Wachs t ums ein, und neben diesem
Prozeß spielt sich zu gleicher Zeit ein anderer ab: die B i l d u n g
d e r E i f o l l i k e l . Fig. XXVII führt uns diese neuen Verhältnisse
vor Augen. Innerhalb des Ovariums vollzieht sich eine
Gruppierung zu kleinen Zellkomplexen, bestehend aus einer Oocyte und aus einem Häuflein kleinerer
Zellen, die nichts anderes sein können, als die früher wiederholt erwähnten eingewanderten Mesodermzellen.
Etwa fünf bis zehn dieser Zellen schließen sich zusammen,
lösen ihre Membranen auf und bilden ein Syncytium mit gemeinsamem
Kontur, das sich äußerst
^ innig an eine Oocyte anlagert und
mit ihr eine Einheit bildet. Die
kleinen Kerne des Syncytiums liegen
so dicht, daß sie oft eckige Gestalt
gewinnen. Sie können halbkreisförmig
die Oocyte umgeben, ihr aber auch
einseitig angefügt sein. Charakteristisch
für sie ist ein zentraler
Nucleolus, den ich an herauspräparierten
und mit Flemming'scher
Lösung fixierten Ovarien besonders
scharf erkannte (Fig. XXVII bj.
Gleichzeitig erfolgt nun ein aber-
k h maliges Eindringen des äußeren Mesoderms
in das Innere, wobei die
Mesodermzellen sich zwischen die beschriebenen
Zellkomplexe schieben
und sie mit einem Epithel umgeben.
F ig . XXVII.
Ovarien sehr jun g er , freilebender Larven im Beginn de r Follikelbildung, Längsschnitte
Ooc Oocyten, Nk Syncytien der Kährkammern, ep mesodermale Zellen, welche später
das Follikelepithel liefern, v vorn, h hinten. Hom. Imm. u. 4.
Damit ist die Bildung der für die Insekten typischen Eifollikel vollzogen. Jeder Follikel besteht
also aus der Oocyte mit ihrem Kern, dem „Keimbläschen“, aus der Nährkammer, d. i. das oben
geschilderte Syncytium, und aus dem Follikelepithel. Die Kerne des Follikelepithels sind anfangs
nur spärlich vorhanden, sie sind meist lang gestreckt und besitzen zerstreut verteiltes Chromatin,
nicht, wie die Kerne der Nährkammer, einen einzigen markanten Nucleolus.
Sehr instruktiv für die Bildung des Epithels sind etwas ältere Ovarien, wie das in Fig. XXVIII
dargestellte. Dort erkennt man, daß die Hüllenbildung von hinten nach vorn verläuft; denn im
hinteren Teil des Ovariums liegen Follikel mit schon fertigem Epithel, während vorn die Komplexe
aus Oocyten und Nährzellen teilweise noch nackt aneinander stoßen. Zugleich sieht man im vorderen
Teil recht deutlich, daß die Hüllenbildung von außen nach innen vor sich geht. Das Mesoderm, das
zuerst die Nährzellen und dann die Epithelzellen abgab, ist auch jetzt noch nicht vollständig
verbraucht, insofern einige wenige Mesodermzellen außen verblieben sind und um das gesamte
vergrößerte Ovarium eine gemeinsame Hülle bilden.
, Die N ä h r k a m m e r nimmt in den Follikeln zunächst den größten Raum in Anspruch.
Die Nährkerne wachsen mächtig heran und können die Größe des Keimbläschens erreichen oder
sogar übertreffen. Untereinander aber zeigen die Kerne desselben Syncytiums in ihrer Größe recht
erhebliche Unterschiede. Dies ist vielleicht nicht nur auf verschiedenes Wachstum, sondern auch
auf Teilungen zurückzuführen; denn ihre Zahl vermehrt sich sichtlich. In einem Follikel zählte ich
sechzehn Kerne, in vollständig ausgewachsenen Follikeln aber
werden über 20, etwa bis 26 Nährkerne beobachtet. Ob ihre
definitive Zahl eine konstante ist, kann ich nicht mit Sicherheit
entscheiden. Für ausgewachsene Follikel erhält man
einen Mittelwert von 24 Kernen. Die Vermehrung der Nährkerne
geschieht durch direkte Kernteilung. Der sonst rundliche,
große Nucleolus zieht sich dabei in die Länge und zerfällt
in zwei Tochterplatten, worauf die Durchschnürung des
Kerns erfolgen kann, welch letztere ich allerdings nicht direkt
beobachtet habe. Die Amitose der Nährkerne wird auch für
andere Insekten beschrieben.
In jungen Nährkernen ist die chromatische Substanz
anscheinend vollständig auf den Nucleolus konzentriert;
denn der übrige Teil des Kerns erscheint ganz hell. Später
sieht man von dem Nucleolus feine Chromatinpartikel reihenweise
nach der Oberfläche ausstrahlen, sodaß das Bild eines
Strahlenkranzes zustande kommt; der zentrale Nucleolus
verblaßt dabei mehr und mehr, und die Nährkerne erhalten
schließlich das Aussehen, das ich früher schon für die ausgewachsenen
Follikel beschrieben habe (Fig. 5). Von den
Kernen der Oocyten sind die Nährkerne auch in den jungen
Follikeln scharf zu unterscheiden. Die Oocytenkerne, die
beim Beginn der Follikelbildung noch einen Nucleolus aufweisen,
lösen diesen bald auf und gehen in ein Spiremstadium
über. Es erscheint ein feiner Chromatinfaden, dessen vielfache
Windungen größtenteils unmittelbar unter der Oberfläche
des Kerns verstreichen (Fig. XXVIII). Das Spirem
des Keimbläschens bleibt jedoch nicht bestehen, sondern geht
v
h
Fig. XXVIII.
Längsschnitt durch ein Ovarium, älter als das vorige,
Epithelbildung, hinten (h) vollendet, vorn (v) noch
nicht oder unvollkommen g eschehen. Ooc Oocyten,
Nk Näkrkammern, ep Follikelepithel, H Hölle de s
Ovariums. Hom. Imm. u. 4.