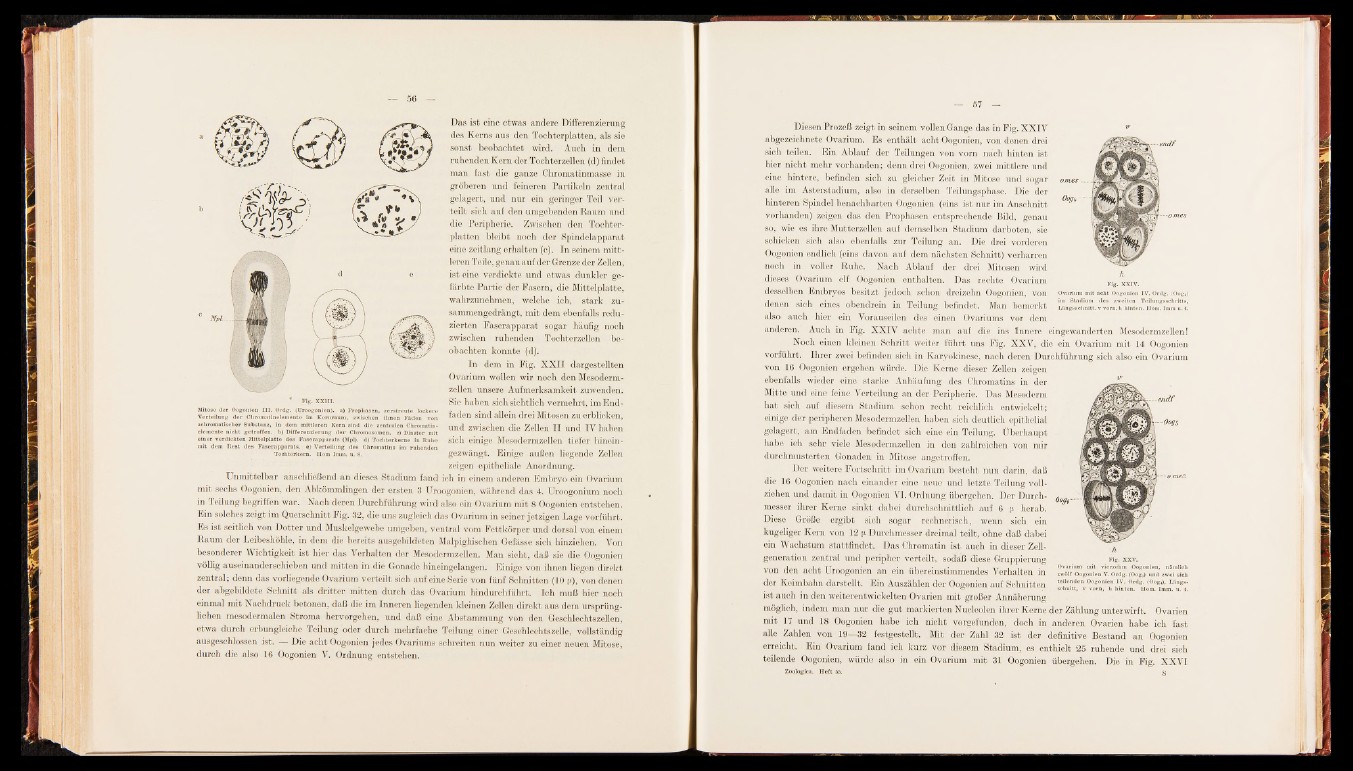
HpLDas
ist eine etwas andere Differenzierung
des Kerns aus den Tochterplatten, als sie
sonst beobachtet wird. Auch in dem
ruhenden Kern der Tochterzellen (d) findet
man fast die ganze Chromatinmasse in
gröberen und feineren Partikeln zentral
gelagert, und nur ein geringer Teil verteilt
sich auf den umgebenden Raum und
die Peripherie. Zwischen den Tochterplatten
bleibt noch der Spindelapparat
eine zeitlang erhalten (c). In seinem mittleren
Teile, genau auf der Grenze der Zellen,
ist eine verdickte und etwas dunkler gefärbte
Partie der Fasern, die Mittelplatte,
wahrzunehmen, welche ich, stark zusammengedrängt,
mit dem ebenfalls reduzierten
Faserapparat sogar häufig noch
zwischen ruhenden Tochterzellen beobachten
konnte (d).
In dem in Fig. XXII dargestellten
Ovarium wollen wir noch den Mesodermzellen
unsere Aufmerksamkeit zuwenden.
Sie haben sich sichtlich vermehrt, im Endfaden
sind allein drei Mitosen zu erblicken,
und zwischen die Zellen II und IV haben
sich einige Mesodermzellen tiefer hineingezwängt.
Einige außen liegende Zellen
zeigen epitheliale Anordnung.
Mitose der Oogonien III. Ordg. (Uroogonien).
a) Propha
Verteilung der Chromatinelemente im Kernraum, zwischen il
achromatischer Substanz, in dem mittleren Kern sind die zen
elemente nicht g etroffen., b) Differenzierung der Chromosomci
Fig. XXIII.
nen Fäden von
cailen Chromatin-
c) Diaster mit
erdichten Mittelplatte des Faserapparats (Mpl). d) Tochterkerne in Ruhe
n R est des Faserapparats, e) Verteilung de s Chromatins im ruhenden
Tochterkern. Hom Imm. u. 8.
Unmittelbar anschließend an dieses Stadium fand ich in einem anderen Embryo ein Ovarium
mit sechs Oogonien, den Abkömmlingen der ersten 3 Uroogonien, während das 4. Uroogonium noch
in Teilung begriffen war. Nach deren Durchführung wird also ein Ovarium mit 8 Oogonien entstehen.
Ein solches zeigt im Querschnitt Fig. 32, die uns zugleich das Ovarium in seiner jetzigen Lage vorführt.
Es ist seitlich von Dotter und Muskelgewebe umgeben, ventral vom Fettkörper und dorsal von einem
Raum der Leibeshöhle, in dem die bereits ausgebildeten Malpighischen Gefässe sich hinziehen. Von
besonderer Wichtigkeit ist hier das Verhalten der Mesodermzellen. Man sieht, daß sie die Oogonien
völlig auseinanderschieben und mitten in die Gonade hineingelangen. Einige von ihnen liegen direkt
zentral; denn das vorliegende Ovarium verteilt sich auf eine Serie von fünf Schnitten (10 |x), von denen
der abgebildete Schnitt als dritter mitten durch das Ovarium hindurchführt. Ich muß hier noch
einmal mit Nachdruck betonen, daß die im Inneren liegenden kleinen Zellen direkt aus dem ursprünglichen
mesodermalen Stroma hervorgehen, und daß eine Abstammung von den Geschlechtszellen,
etwa durch erbungleiche Teilung oder durch mehrfache Teilung einer Geschlechtszelle, vollständig
ausgeschlossen ist. — Die acht Oogonien jedes Ovariums schreiten nun weiter zu einer neuen Mitose,
durch die also 16 Oogonien V. Ordnung entstehen.
ÜOffk ~
Diesen Prozeß zeigt in seinem vollen Gange das in Fig. XXIV
abgezeichnete Ovarium. Es enthält acht Oogonien, von denen drei
sich teilen. Ein Ablauf der Teilungen von vorn nach hinten ist
hier nicht mehr vorhanden; denn drei Oogonien, zwei mittlere und
eine hintere, befinden sich zu gleicher Zeit in Mitose und sogar
alle im Asterstadium, also in derselben Teilungsphase. Die der
hinteren Spindel benachbarten Oogonien (eins ist nur im Anschnitt
vorhanden) zeigen das den Prophasen entsprechende Bild, genau
so, wie es ihre Mutterzellen auf demselben Stadium darboten, sie
schicken sich also ebenfalls zur Teilung an. Die drei vorderen
Oogonien endlich (eins davon auf dem nächsten Schnitt) verharren
noch in voller Ruhe. Nach Ablauf der drei Mitosen wird
dieses Ovarium elf Oogonien enthalten. Das rechte Ovarium
desselben Embryos besitzt jedoch schon dreizehn Oogonien, von
denen sich eines obendrein in Teilung befindet. Man bemerkt Mngsschnitt. v^orn.I^ntemHo^imm"11^
also auch hier ein Vorauseilen des einen Ovariums vor dem
anderen. Auch in Fig. XXIV achte man auf die ins Innere eingewanderten Mesodermzellen!
Noch einen kleinen Schritt weiter führt uns Fig. XXV, die ein Ovarium mit 14 Oogonien
vorführt. Ihrer zwei befinden sich in Karyokinese, nach deren Durchführung sich also ein Ovarium
von 16 Oogonien ergeben würde. Die Kerne dieser Zellen zeigen
ebenfalls wieder eine starke Anhäufung des Chromatins in der
Mitte und eine feine Verteilung an der Peripherie. Das Mesoderm
hat sich auf diesem Stadium schön recht reichlich entwickelt;
einige der peripheren Mesodermzellen haben sich deutlich epithelial
gelagert, am Endfaden befindet sich eine ein Teilung. Überhaupt
habe ich sehr viele Mesodermzellen in defi zahlreichen von mir
durchmusterten Gonaden in Mitose angetroffen.
Der weitere Fortschritt im Ovarium besteht nun darin, daß
die 16 Oogonien nach einander eine neue und letzte Teilung vollziehen
und damit in Oogonien VI. Ordnung übergehen. Der Durchmesser
ihrer Kerne sinkt dabei durchschnittlich, auf 6 |x herab.
Diese Größe ergibt sich sogar rechnerisch, wenn sich ein
kugeliger Kern von 12 p Durchmesser dreimal teilt, ohne daß dabei
ein Wachstum stattfindet. Das Chromatin ist. auch in dieser Zellgeneration
zentral und peripher verteilt, sodäß diese Gruppierung
en d f
-Oogs
von den acht Uroogonien an ein übereinstimmendes Verhalten in
der Keimbahn darstellt. Ein Auszählen der Oogonien auf Schnitten
ist auch in den weiterentwickelten Ovarien mit großer Annäherung
möglich, indem man nur die gut markierten Nucleolen ihrer Kerne der Zählung unterwirft. Ovarien
mit 17 und 18 Oogonien habe ich nicht vorgefunden, doch in anderen Ovarien habe ich fast
alle Zahlen von 19—32 festgestellt. Mit der Zähl 32 ist der definitive Bestand an Oogonien
erreicht. Ein Ovarium fand ich kurz vor diesem Stadium, es enthielt 25 ruhende und drei sich
teilende Oogonien, würde also in ein Ovarium mit 31 Oogonien übergehen. Die in Fig. XXVI
Zoologica. H e ft 55. g
0 m e s
Fig. xxv.
Ovarium mit vierzehm Oogonien, nämlicl
zwölf Oogonien V. Ordg. (Oogs) und zwei siel
teilenden Oogonien IV. Ordg. (OogJ, Länge
schuitt, v vorn, h hinten. Hora. Imm. u. <