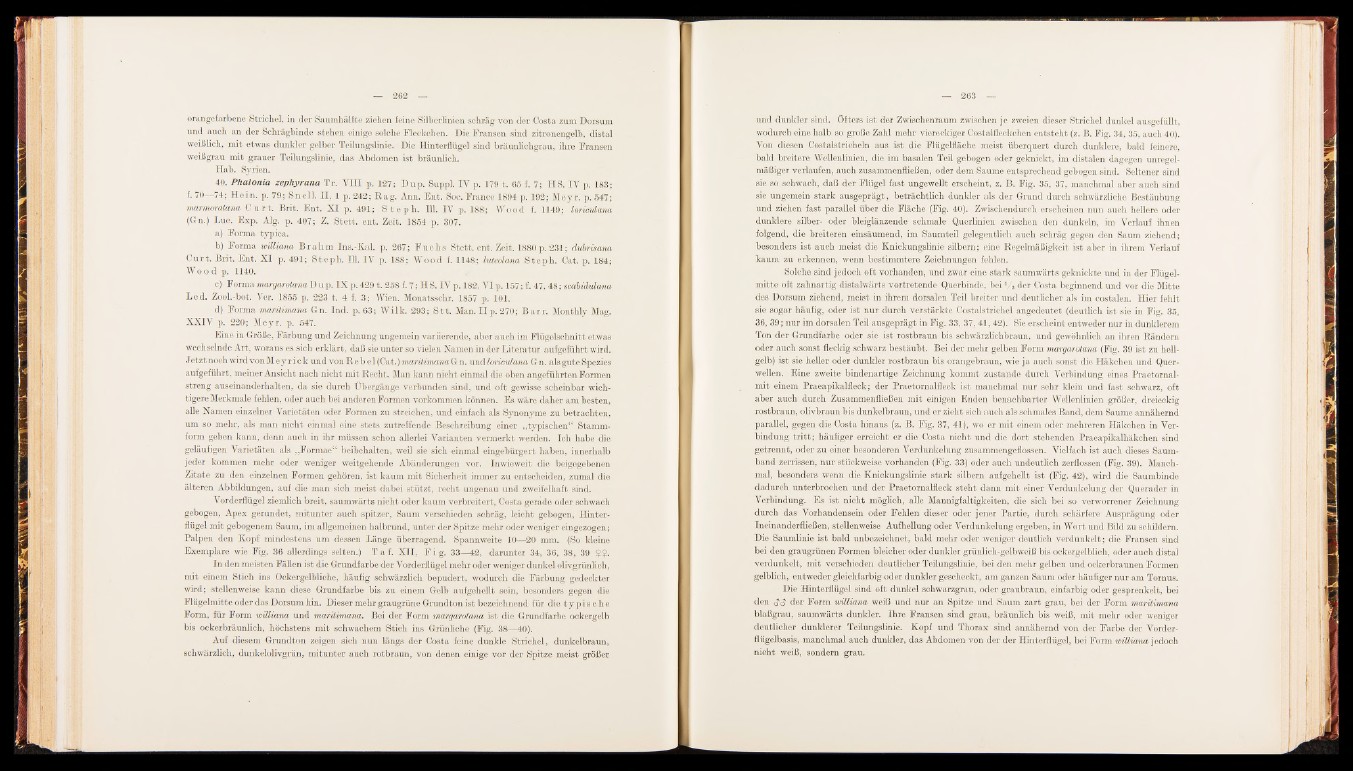
orangefarbene Strichel, in der Saumhälfte ziehen feine Silberlinien schräg" von der Costa zum Dorsum
und auch an der Schrägbinde stehen einige solche Fleckchen. Die Fransen sind zitronengelb, distal
weißlich, mit etwas dunkler gelber Teilungslinie. Die Hinterflügel sind bräunlichgrau, ihre Fransen
weißgrau mit grauer Teilungslinie, das Abdomen ist bräunlich.
Hab. Syrien.
40. Phalonia zephyrana Tr. VIII p. 127; Dup. Suppl. IV p. 179 t. 65 f. 7; HS. IV p. 183;
f. 70—74; Hein. p. 79; Snell. II, 1 p. 242; Rag. Ann. Ent. Sog.France 1894 p. 192; Meyr. p. 547;
marmoratana Cu r t . Brit. Ent. XI p. 491; S t e p h. 111. IV p. 188; Wood f. 1149; loriculana
(Gn.) Luc. Exp. Alg, p. 407; Z. Stett. ent. Zeit. 1854 p. 307.
a) Forma typica.
b) Forma wüliana B r ahm Ins.-Kal. p. 267; Fuch s Stett. ent. Zeit. 1880 p. 231; dubrisana
Curt . Brit. Ent. XI p. 491; Steph. 111. IV p. 188; Wood f. 1148; luteolana St eph. Cat. p. 184;
Wo o d p. 1140.
c) Forma margarotana D u p. IX p. 4291. 258 f. 7; H S. IV p. 182, VI p. 157; f. 47, 48; scabidulana
Led. Zool.-bot. Ver. 1855 p. 223 t. 4 f. 3; Wien. Monatsschr. 1857 p. 101.
d) Forma maritimana Gn. Ind. p. 63; Wilk. 293; S tt. Man. IIp . 270; Barr . Monthly Mag.
XXIV p. 220; Meyr. p. 547.
Eine in Größe, Färbung und Zeichnung ungemein variierende, aber auch im Flügelschnitt etwas
wechselnde Art, woraus es sich erklärt, daß sie unter so vielen Namen in der Literatur aufgeführt wird.
Jetzt noch wird von M e y r i c k und von R e b e 1 (Cat.) maritimana G n. und loriculana G n. als gute Spezies
aufgeführt, meiner Ansicht nach nicht mit Recht. Man kann nicht einmal die oben angeführten Formen
streng auseinanderhalten, da sie durch Übergänge verbunden sind, und oft gewisse scheinbar wichtigere
Merkmale fehlen, oder auch bei anderen Formen Vorkommen können. Es wäre daher am besten,
alle Namen einzelner Varietäten oder Formen zu streichen, und einfach als Synonyme zu betrachten,
um so mehr, als man nicht einmal eine stets zutreffende Beschreibung einer „typischen“ Stammform
geben kann, denn auch in ihr müssen schon allerlei Varianten vermerkt werden. Ich habe die
geläufigen Varietäten als „Formae“ beibehalten, weil sie sich einmal eingebürgert haben, innerhalb
jeder kommen mehr oder weniger weitgehende Abänderungen vor. Inwieweit die beigegebenen
Zitate zu den einzelnen Formen gehören, ist kaum mit Sicherheit immer zu entscheiden, zumal die
älteren Abbildungen, auf die man sich meist dabei stützt, recht ungenau und zweifelhaft sind.
Vorderflügel ziemlich breit, saumwärts nicht oder kaum verbreitert, Costa gerade oder schwach
gebogen, Apex gerundet, mitunter auch spitzer, Saum verschieden schräg, leicht gebogen, Hinterflügel
mit gebogenem Saum, im allgemeinen halbrund, unter der Spitze mehr oder weniger eingezogen;
Palpen den Kopf mindestens um dessen Länge überragend. Spannweite 10— 20 mm. (So kleine
Exemplare wie Fig. 36 allerdings selten.) Taf . XII, F i g . 33—42, darunter 34, 36, 38, 39
In den meisten Fällen ist die Grundfarbe der Vorderflügel mehr oder weniger dunkel olivgrünlich,
mit einem Stich ins Ockergelbliche, häufig schwärzlich bepudert, wodurch die Färbung gedeckter
wird; stellenweise kann diese Grundfarbe bis zu einem Gelb aufgehellt sein, besonders gegen die
Flügelmitte oder das Dorsum hin. Dieser mehr graugrüne Grundton ist bezeichnend für die ty p i s c h e
Form, für Form williana und maritimana. Bei der Form ma/rgarota/na ist die Grundfarbe ockergelb
bis ockerbräunlich, höchstens mit schwachem Stich ins Grünliche (Fig. 38—40).
Auf diesem Grundton zeigen sich nun längs der Costa feine dunkle Strichel, dunkelbraun,
schwärzlich, dunkelolivgrün, mitunter auch rotbraun, von denen einige vor der Spitze meist größer
und dunkler sind, öfters ist der Zwischenraum zwischen je zweien dieser Strichel dunkel ausgefüllt,
wodurch eine halb so große Zahl mehr viereckiger Costalfleckchen entsteht (z. B. Fig. 34, 35, auch 40).
Von diesen Costalstricheln aus ist die Flügelfläche meist überquert durch dunklere, bald feinere,
bald breitere Wellenlinien, die im basalen Teil gebogen oder geknickt, im distalen dagegen unregelmäßiger
verlaufen, auch zusammenfließen, oder dem Saume entsprechend gebogen sind. Seltener sind
sie so schwach, daß der Flügel fast ungewellt erscheint, z. B. Fig. 35, 37, manchmal aber auch sind
sie ungemein stark ausgeprägt, beträchtlich dunkler als der Grund durch schwärzliche Bestäubung
und ziehen fast parallel über die Fläche (Fig. 40). Zwischendurch erscheinen nun auch hellere oder
dunklere silber- oder bleiglänzende schmale Querlinien zwischen den dunkeln, im Verlauf ihnen
folgend, die breiteren einsäumend, im Saumteil gelegentlich auch schräg gegen den Saum ziehend;
besonders ist auch meist die Knickungslinie silbern; eine Regelmäßigkeit ist aber in ihrem Verlauf
kaum zu erkennen, wenn bestimmtere Zeichnungen fehlen.
Solche sind jedoch oft vorhanden, und zwar eine stark saumwärts geknickte und in der Flügelmitte
oft zahnartig distalwärts vortretende Querbinde, bei V3 der Costa beginnend und vor die Mitte
des Dorsum ziehend, meist in ihrem dorsalen Teil breiter und deutlicher als im costalen. Hier fehlt
sie sogar häufig, oder ist nur durch verstärkte Costalstrichel angedeutet (deutlich ist sie in Fig. 35,
36, 39; nur im dorsalen Teil ausgeprägt in Fig. 33, 37, 41, 42). Sie erscheint entweder nur in dunklerem
Ton der Grundfarbe oder sie ist rostbraun bis schwärzlichbraun, und gewöhnlich an ihren Rändern
oder auch sonst fleckig schwarz bestäubt. Bei der mehr gelben Form margarotana (Fig. 39 ist zu hellgelb)
ist sie heller oder dunkler rostbraun bis orangebraun, wie ja auch sonst die Häkchen und Querwellen.
Eine zweite bindenartige Zeichnung kommt zustande durch Verbindung eines Praetornal-
mit einem Praeapikalfleck; der Praetornalfleck ist manchmal nur sehr klein und fast schwarz, oft
aber auch durch Zusammenfließen mit einigen Enden benachbarter Wellenlinien größer, dreieckig
rostbraun, olivbraun bis dunkelbraun, und er zieht sich auch als schmales Band, dem Saume annähernd
parallel, gegen die Costa hinaus (z. B. Fig. 37, 41), wo er mit einem oder mehreren Häkchen in Verbindung
tritt; häufiger erreicht er die Costa nicht und die dort stehenden Praeapikalhäkchen sind
getrennt, oder zu einer besonderen Verdunkelung zusammengeflossen. Vielfach ist auch dieses Saumband
zerrissen, nur stückweise vorhanden (Fig. 33) oder auch undeutlich zerflossen (Fig. 39). Manchmal,
besonders wenn die Knickungslinie stark silbern aufgeheüt ist (Fig. 42), wird die Saumbinde
dadurch unterbrochen und der Praetornalfleck steht dann mit einer Verdunkelung der Querader in
Verbindung. Es ist nicht möglich, alle Mannigfaltigkeiten, die sich bei so verworrener Zeichnung
durch das Vorhandensein oder Fehlen dieser oder jener Partie, durch schärfere Ausprägung oder
Ineinanderfließen, stellenweise Aufhellung oder Verdunkelung ergeben, in Wort und Bild zu schildern.
Die Saumlinie ist bald unbezeichnet, bald mehr oder weniger deutlich verdunkelt; die Fransen sind
bei den graugrünen Formen bleicher oder dunkler grünlich-gelbweiß bis ockergelblich, oder auch distal
verdunkelt, mit verschieden deutlicher Teilungslinie, bei den mehr gelben und ockerbraunen Formen
gelblich, entweder gleichfarbig oder dunkler gescheckt, am ganzen Saum oder häufiger nur am Tornus.
Die Hinterflügel sind oft dunkel schwarzgrau, oder graubraun, einfarbig oder gesprenkelt, bei
den (?<J der Form williana weiß und nur an Spitze und Saum zart grau, bei der Form maritimana
blaßgrau, saumwärts dunkler. Ihre Fransen sind grau, bräunlich bis weiß, mit mehr oder weniger
deutlicher dunklerer Teilungslinie. Kopf und Thorax sind annähernd von der Farbe der Vorderflügelbasis,
manchmal auch dunkler, das Abdomen von der der Hinterflügel, bei Form wüliana jedoch
nicht weiß, sondern grau.