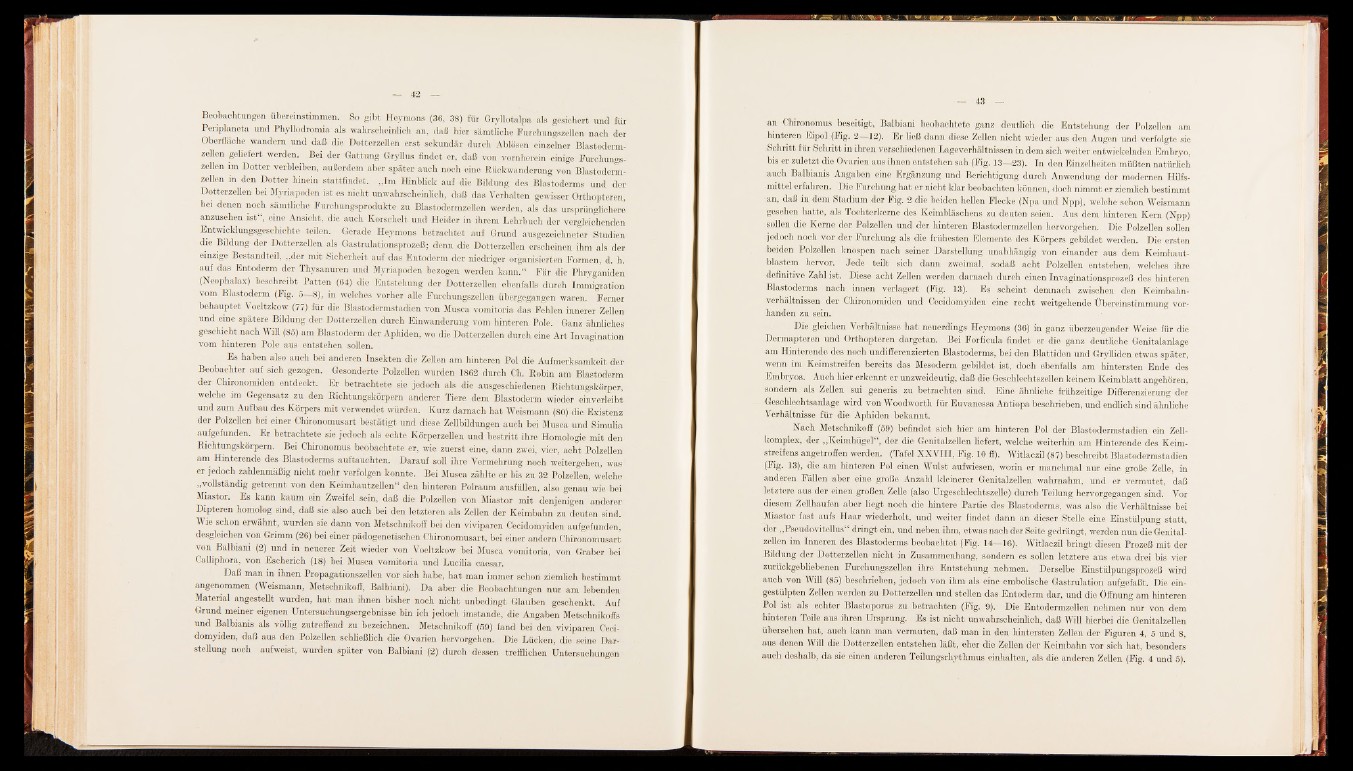
Beobachtungen übereinstimmen. So gibt Heymons (36, 38) für Gryllotalpa als gesichert und für
Penplaneta und Phyllodromia als wahrscheinlich an, daß hier sämtliche Furchungszellen nach der
Oberfläche wandern und daß die Dotterzellen erst sekundär durch Ablösen einzelner Blastoderm-
zellen geliefert werden. Bei der Gattung Gryllus findet er, daß von vornherein einige Furchungszellen
im Dotter verbleiben, außerdem aber später auch noch eine Rückwanderung von Blastoderm-
zellen in den Dotter hinein stattfindet. „Im Hinblick auf die Bildung des Blastoderms und der
Dotterzellen bei Myriapoden ist es nicht unwahrscheinlich, daß das Verhalten gewisser Orthopteren,
bei denen noch sämtliche Furchungsprodukte zu Blastodermzellen werden, ab das ursprünglichere
anzusehen ist“, eine Ansicht, die auch Korschelt und Heider in ihrem Lehrbuch der vergleichenden
Entwicklungsgeschichte teilen. Gerade Heymons betrachtet auf Grund ausgezeichneter Studien
die Bildung der Dotterzellen, ab Gastrulationsprozeß; denn die Dotterzellen erscheinen ihm als der
einzige Bestandteil, „der mit Sicherheit auf das Entoderm der niedriger organisierten Formen, d. h.
auf das Entoderm der Thysanuren und Myriapoden bezogen werden kann.“ Für die Phryganiden
(Neophalax) beschreibt Patten (64) die Entstehung der Dotterzellen ebenfalb durch Immigration
vom Blastoderm (Fig. 5—8), in welches vorher alle Furchungszellen übergegangen waren.. Ferner
behauptet Voeltzkow (77) für die Blastodermstadien von Musca vomitoria das Fehlen innerer Zellen
und eine spätere Bildung der Dotterzellen durch Einwanderung vom hinteren Pole. Ganz ähnliches
geschieht nach Will (85) am Blastoderm der Aphiden, wo die Dotterzellen durch eine Art Invagination
vom hinteren Pole aus entstehen sollen.
Es haben abo auch bei anderen Insekten die Zellen am hinteren Pol die Aufmerksamkeit der
Beobachter auf sich gezogen. Gesonderte Polzellen wurden 1862 durch Ch. Robin am Blastoderm
der Chironomiden entdeckt. Er betrachtete sie jedoch als die ausgeschiedenen Richtungskörper,
welche im Gegensatz zu den Richtungskörpern anderer Tiere dem Blastoderm wieder einverleibt
und zum Aufbau des Körpers mit verwendet würden. Kurz darnach hat Weismann :(ßü) die Existenz
der Polzellen bei einer Chironomusart bestätigt und diese Zellbildungen auch bei Musca und Simulia
aufgefunden. Er betrachtete sie jedoch ab echte Körperzellen und bestritt ihre Homologie mit den'
Richtungskörpern. Bei Chironomus beobachtete er, wie zuerst eine, dann zwei, vier, acht Polzellen
am Hinterende des Blastoderms auftauchten. Darauf soll ihre Vermehrung noch weitergehen, was'
er jedoch zahlenmäßig nicht mehr verfolgen konnte- Bei Musca zählte er bis zu 32 Polzellen, welche
„vollständig getrennt von den Keimhautzellen“ den hinteren Polraum ausfüllen, abo genau’wie-bei
Miastor. Es kann kaum ein Zweifel sein, daß die Polzellen von Miastor mit denjenigen anderer
Dipteren homolog, sind, daß sie abo auch bei den letzteren als Zellen der Keimbahn zu deuten sind.
Wie schon erwähnt, wurden sie dann von Metschnikoff bei den viviparen Cecidomyiden aufgefunden,
desgleichen von Grimm (26) bei einer pädogenetischen Chironomusart, bei einer ändern Chironomusart
von Balbiani (2) und in neuerer Zeit wieder von Voeltzkow bei Musca vomitoria, von Gräber bei
Calliphora, von Escherich (18) bei Musca vomitoria und Lucilia caesar.
Daß man in ihnen Propagationszellen vor sich habe, hat man immer schon ziemlich bestimmt
angenommen (Webmann, Metschnikoff, Balbiani). Da aber die Beobachtungen nur am lebenden
Material angestellt wurden, hat man ihnen bisher noch nicht unbedingt Glauben geschenkt. Auf
Grund meiner eigenen Untersuchungsergebnisse bin ich jedoch imstande, die Angaben Metsehnikoffs
und Balbianb ab völlig zutreffend zu bezeichnen. Metschnikofi (59) fand bei den viviparen Cecidomyiden,
daß aus den Polzellen schließlich die Ovarien hervorgehen. Die Lücken, die seine Darstellung
noch auf weist, wurden später von Balbiani (2) durch dessen trefflichen Untersuchungen
an Chironomus beseitigt, Balbiani beobachtete ganz deutlich die Entstehung der Polzellen am
.hinteren Eipol (Fig. S^^I2^pEr ließ dann diese Zellen nicht wieder aus den Augen und verfolgte sie
Schritt für Schritt in ihren verschiedenen Lageverhältnissen in dem sich weiter entwickelnden Embryo,
bis er zuletzt die Ovarien aus ihnen entstehen sah (Fig. 13—23). In den Einzelheiten müßten natürlich
-auch Balbianis Angaben eine Ergänzung und Berichtigung durch Anwendung der modernen Hilfsmittel
erfahren. Die Furchung hat er nicht klar beobachten können, doch nimmt er ziemlich bestimmt
■an, daß in dem Stadium der Fig. 2 die beiden hellen Flecke (Npa und Npp), welche schon Weismann
gesehen hatte, als Tochterkeme des Keimbläschens zu deuten seien. Aus dem hinteren Kern (Npp)
sollen die Kerne der Polzellen und der hinteren Blastodermzellen hervorgehen. Die Polzellen sollen
jedoch noch vor der Furchung ab die frühesten Elemente des Körpers gebildet werden. Die ersten
beiden Polzellen knospen nach seiner Darstellung unabhängig von einander aus dem Keimhaut-
blastem hervor. Jede teilt sich dann zweimal, sodaß sacht Polzellen entstehen, welches ihre
definitive Zahl ist. Diese acht Zellen werden darnach durch einen Invaginationsprozeß des hinteren
Blastoderms nach innen verlagert (Fig. 13). Es scheint demnach zwischen den Keimbahnverhältnissen
der Chironomiden und Cecidomyiden eine recht weitgehende Übereinstimmung vorhanden
zu sein.
Die gleichen Verhältnisse hat neuerdings Heymons (36) in ganz überzeugender Weise für die
Defmapteren lind Orthopteren dargetan. Bei Forfícula findet er die ganz deutliche Genitalanlage
am Hinterende des noch undifferenzierten Blastoderms, bei den Blattiden und Grylliden etwas später,
wenn im Keimstreifen bereits das Mesoderm gebildet ist, doch ebenfalls am hintersten Ende des
Embryos. Auch hier erkennt er unzweideutig, daß die Geschlechtszellen keinem Keimblatt angehören,
sondern ab Zellen sui generis zu betrachten sind. Eine ähnliche frühzeitige Differenzierung der
Geschlechtsanlage wird von Woodworth für EuvaneSsa Antiopa beschrieben, und endlich sind ähnliche
Verhältnisse für die Aphiden bekannt.
Nach Metschnikoff (59) befindet: sich hier am hinteren Pol der Blastodermstadien ein Zell-
komplex, der „Keimhügel“, der. die Genitalzellen liefert, welche weiterhin am Hinterende des Keimstreifens
angetroffen werden. (Tafel XXVIII, Fig. 10 ff). Witlaczä (87) beschreibt Blastodermstadien
(Fig. 13), die am hinteren Pol einen Wubt aufwreseh, worin er manchmal nur eine große Zelle, in
anderen Fällen aber eine große Anzahl kleinerer Genitalzellen wahmahm, und er vermutet, daß
letztere aus der einen großen Zelle (also UrgeschlechtsZelle) durch Teilung hervorgegangen sind. Vor
diesem Zellhaufen aber liegt noch die hintere Partie des Blastoderms, was abo die Verhältnbse bei
Miastor fast aufs Haar wiederholt, und weiter findet dann an dieser Stelle eine Einstülpung statt,
der „Pseudovitcllus“ dringt ein, und neben ihm, etwas nach der Seite gedrängt, werden nun die Genitalzellen
im Inneren des Blastoderms beobachtet (Fig. 14—16), Witlaczil bringt diesen Prozeß mit der
Bildung der Dotterzellen nicht in Zusammenhang, sondern es sollen letztere aus etwa drei bis vier
zurückgebliebenen Furchungszellen ihre Entstehung nehmen. Derselbe Einstülpungsprozeß wird
auch von Will (85) beschrieben, jedoch von ihm ab eine embolbche Gastrulation aufgefaßt. Die eingestülpten
Zellen werden zu Dotterzellen und stellen das Entoderm dar, und die Öffnung am hinteren
Pol ist ais echter Blastoporus zu betrachten (Fig. 9). Die Entodermzellen nehmen nur von dem
hinteren Teile aus ihren Ursprung. Es ist nicht unwahrscheinlich; daß Will hierbei die Genitalzellen
übersehen hat, auch kann man vermuten, daß man in den hintersten Zellen der Figuren 4, 5 und 8,
aus denen Will die Dotterzellen entstehen läßt, eher die Zellen der Keimbahn vor sich hat, besonders
auch deshalb, da sie. einen anderen Teilungsrhythmus einhalten, ab die anderen Zellen (Fig. 4 und 5).