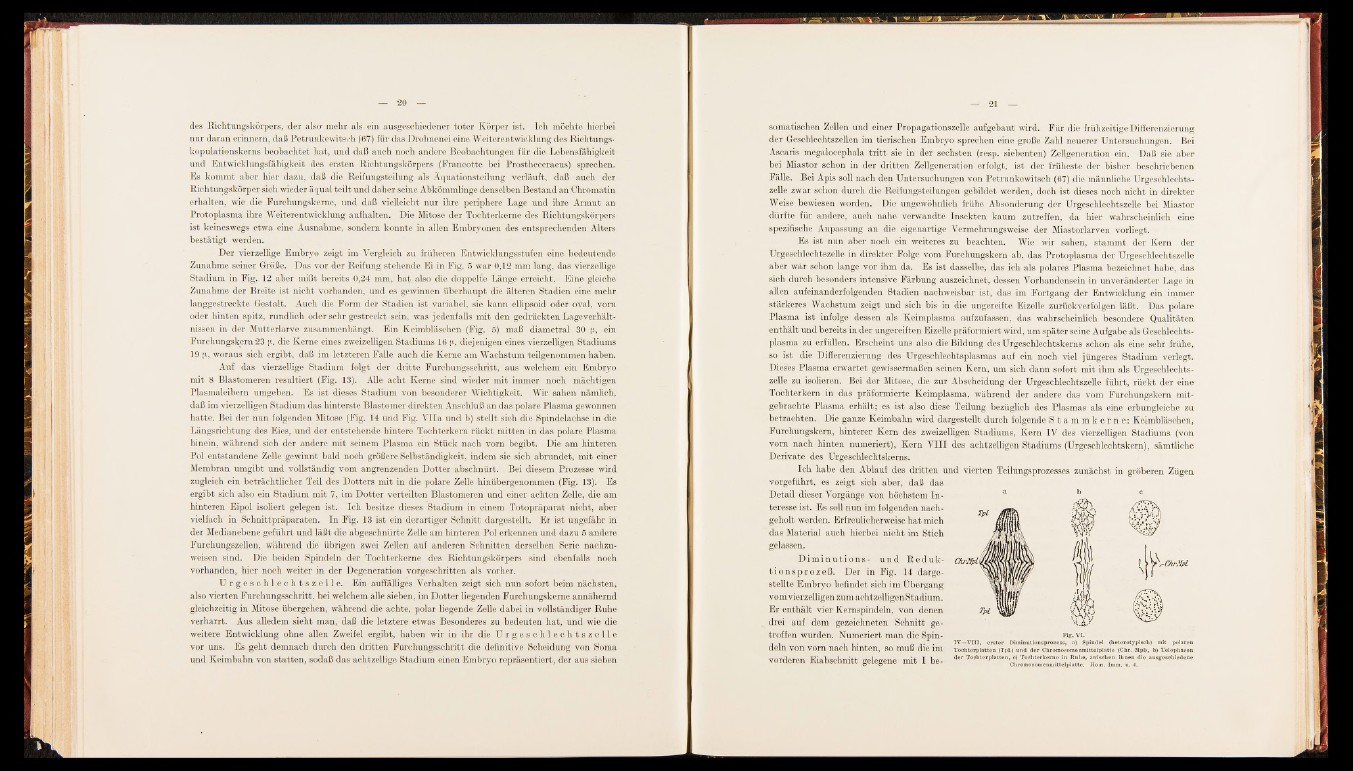
des Richtungskörpers, der alscr mehr als ein ausgeschiedener toter Körper ist. . Ich möchte hierbei
nur daran erinnern, daß Petrunkewitseh (67) für das Drohnenei eine Weiterentwicklung des Richtungskopulationskerns
beobachtet hat, und daß auch noch andere Beobachtungen für die Lebensfähigkeit
und Entwicklungsfähigkeit des ersten Richtungskörpers (Francotte bei Prostheceraeus) sprechen.
Es kommt aber hier dazu, daß die Reifungsteilung als Äquationsteilung verläuft, daß auch der
Richtungskörper sich wieder äqual teilt und daher seine Abkömmlinge denselben Bestand an Chromatin
erhalten, wie die Furchungskerne, und daß vielleicht nur ihre periphere Lage und ihre Armut an
Protoplasma ihre Weiterentwicklung aufhalten. Die Mitose der Tochterkerne des Richtungskörpers
ist keineswegs etwa eine Ausnahme, sondern konnte in allen Embryonen des entsprechenden Alters
bestätigt werden.
Der vierzeilige Embryo zeigt im Vergleich zu früheren Entwicklungsstufen eine bedeutende
Zunahme seiner Größe. Das vor der Reifung stehende Ei in Fig. 5 war 0,12 mm lang, das vierzeilige
Stadium in Fig. 12 aber mißt bereits 0,24 mm, hat also die doppelte Länge erreicht. Eine gleiche
Zunahme der Breite ist nicht vorhanden, und es gewinnen überhaupt die älteren Stadien eine mehr
langgestreckte Gestalt. Auch die Form der Stadien ist variabel, sie kann elhpsoid oder oval, vorn
oder hinten spitz, rundlich oder sehr gestreckt sein, was jedenfalls mit den gedrückten Lage Verhältnissen
in der Mutterlarve zusammenhängt. Ein Keimbläschen (Fig. 5) maß diametral 30 p-, ein
Furchungskern 23 p-, die Kerne eines zweizeiligen Stadiums 16 |i, diejenigen eines vierzelligen Stadiums
19 ¡a, woraus sich ergibt, daß im letzteren Falle auch die Kerne am Wachstum teilgenommen haben.
Auf das vierzellige Stadium folgt der dritte Furchungsschritt, aus welchem ein Embryo
mit 8 Blastomeren resultiert (Fig. 13). Alle acht Kerne sind wieder mit immer noch mächtigen
Plasmaleibern umgeben. Es ist dieses Stadium von besonderer Wichtigkeit. Wir sahen nämlich,
daß im vierzelligen Stadium das hinterste Blastomer direkten Anschluß an das polare Plasma gewonnen
hatte. Bei der nun folgenden Mitose (Fig. 14 und Fig. VHa und b) stellt sich die Spindelachse in die
Längsrichtung des Eies, und der entstehende hintere Tochterkern rückt mitten in das polare Plasma
hinein, während sich der andere mit seinem Plasma ein Stück nach vorn begibt. Die am hinteren
Pol entstandene Zelle gewinnt bald noch größere Selbständigkeit, indem sie sich abrundet, mit einer
Membran umgibt und vollständig vom angrenzenden Dotter abschnürt. Bei diesem Prozesse wird
zugleich ein beträchtlicher Teil des Dotters mit in die polare Zelle hinübergenommen (Fig. 13). Es
ergibt sich also ein Stadium mit 7, im Dotter verteilten Blastomeren und einer achten Zelle, die am
hinteren Eipol isoliert gelegen ist. Ich besitze dieses Stadium in einem Totopräparat nicht, aber
vielfach in Schnittpräparaten. In Fig. 13 ist ein derartiger Schnitt dargestellt. Er ist ungefähr in
der Medianebene geführt und läßt die abgeschnürte Zelle am hinteren Pol erkennen und dazu 5 andere
Furchungszellen, während die übrigen zwei Zellen auf anderen Schnitten derselben Serie nachzuweisen
sind. Die beiden Spindeln der Tochterkerne des Richtungskörpers sind ebenfalls noch
vorhanden, hier noch weiter in der Degeneration vorgeschritten als vorher.
U r g e s c h l e c h t s z e l l e . Ein auffälliges Verhalten zeigt sich nun sofort beim nächsten,
also vierten Furchungsschritt, bei welchem alle sieben, im Dotter liegenden Furchungskerne annähernd
gleichzeitig in Mitose übergehen, während die achte, polar liegende Zelle dabei in vollständiger Ruhe
verharrt. Aus alledem sieht man, daß die letztere etwas Besonderes zu bedeuten hat, und wie die
weitere Entwicklung ohne allen Zweifel ergibt, haben wir in ihr die U r g e s c h l e c h t s z e l l e
vor uns. Es geht demnach durch den dritten Furchungsschritt die definitive Scheidung von Soma
und Keimbahn von statten, sodaß das achtzeilige Stadium einen Embryo repräsentiert, der aus sieben
somatischen Zellen und einer Propagationszelle aufgebaut wird. Für die frühzeitige Differenzierung
der Geschlechtszellen im tierischen Embryo sprechen eine große Zahl neuerer Untersuchungen. Bei
Ascaris megalocephala tritt sie in der sechsten (resp. siebenten) Zellgeneration ein. Daß sie aber
bei Miastor schon in der dritten Zellgeneration erfolgt, ist der früheste der bisher beschriebenen
Fälle. Bei Apis soll nach den Untersuchungen von Petrunkewitseh (67) die männliche Urgeschlechtszelle
zwar schon durch die Reifungsteilungen gebildet werden, doch ist dieses noch nicht in direkter
Weise bewiesen worden. Die ungewöhnlich frühe Absonderung der Urgeschlechtszelle bei Miastor
dürfte für andere, auch nahe verwandte Insekten kaum zutreffen, da hier wahrscheinlich eine
spezifische Anpassung an die eigenartige Vermehrungsweise der Miastorlarven vorliegt. -
Es ist nun aber noch ein weiteres zu beachten. Wie wir sahen, stammt der Kern der
Urgeschlechtszelle in direkter Folge vom Furchungskern ab, das Protoplasma der Urgeschlechtszelle
aber war schon lange vor ihm da. Es ist dasselbe, das ich als polares Plasma bezeichnet habe, das
sich durch besonders intensive Färbung auszeichnet, dessen Vorhandensein in unveränderter Lage in
allen aufeinanderfolgenden Stadien nachweisbar ist, das im Fortgang der Entwicklung ein immer
stärkeres Wachstum zeigt und sich bis in die ungereifte Eizelle zurückverfolgen läßt. Das polare
Plasma ist infolge dessen als Keimplasma aufzufassen, das wahrscheinlich besondere Qualitäten
enthält und bereits in der ungereiften Eizelle präformiert wird, um später seine Aufgabe als Geschleqhts-
plasma zu erfüllen. Erscheint uns also die Bildung des Urgeschlechtskerns schon als eine sehr frühe,
so ist die Differenzierung des Urgeschlechtsplasmas auf ein noch viel jüngeres Stadium verlegt.
Dieses Plasma erwartet gewissermaßen seinen Kern, um sich dann sofort mit ihm als Urgeschlechtszelle
zu isolieren. Bei der Mitose, die zur Abscheidung der Urgeschlechtszelle führt, rückt der eine
Tochterkern in das präformierte Keimplasma, während der andere das vom Furchungskern mitgebrachte
Plasma erhält; es ist also diese Teilung bezüglich des Plasmas als eine erbungleiche zu
betrachten. Die ganze Keimbahn wird dargestellt durch folgende S t a m m k e r n e : Keimbläschen,
Furchungskern, hinterer Kern des zweizeiligen Stadiüms, Kern IV des vierzelligen Stadiums (von
vorn nach hinten numeriert), Kern VIII des achtzelligen Stadiums (Urgeschlechtskern), sämtliche
Derivate des Urgeschlechtskerns.
Ich habe den Ablauf des dritten und vierten Teilungsprozesses zunächst in gröberen Zügen
vörgeführt, es zeigt sich aber, daß das
Detail dieser Vorgänge von höchstem Interesse
ist. Es soll nun im folgenden nachgeholt
werden. Erfreulicherweise hat mich
das Material auch hierbei nicht im Stich
gelassen.
Dimi nut i ons - und Re duk t
ionsprozeß. Der in Fig. 14 dargestellte
Embryo befindet sich im Übergang
vom vierzelligen zum achtzeiligen Stadium.
Er enthält vier Kernspindeln, von denen
drei auf dem gezeichneten Schnitt getroffen
wurden. Numeriert man die Spindeln
von vorn nach hinten, so muß die im
vorderen Eiabschnitt gelegene mit I beFig.
VI.
IV—VIII, erster Diminutionsprozess, a) Spindel (heterotypisch) mit polaren
Tochterplatten (Tpl.) lind der Chromosomenmittelplatte (Chr. Mpl), b) Telophasen
der Tochterplatten, c) Tochterkerne in Ruhe, zwischen ihnen die ausgeschiedene
Chromosomenmittelplatte, Horn. Imin. u. 4.