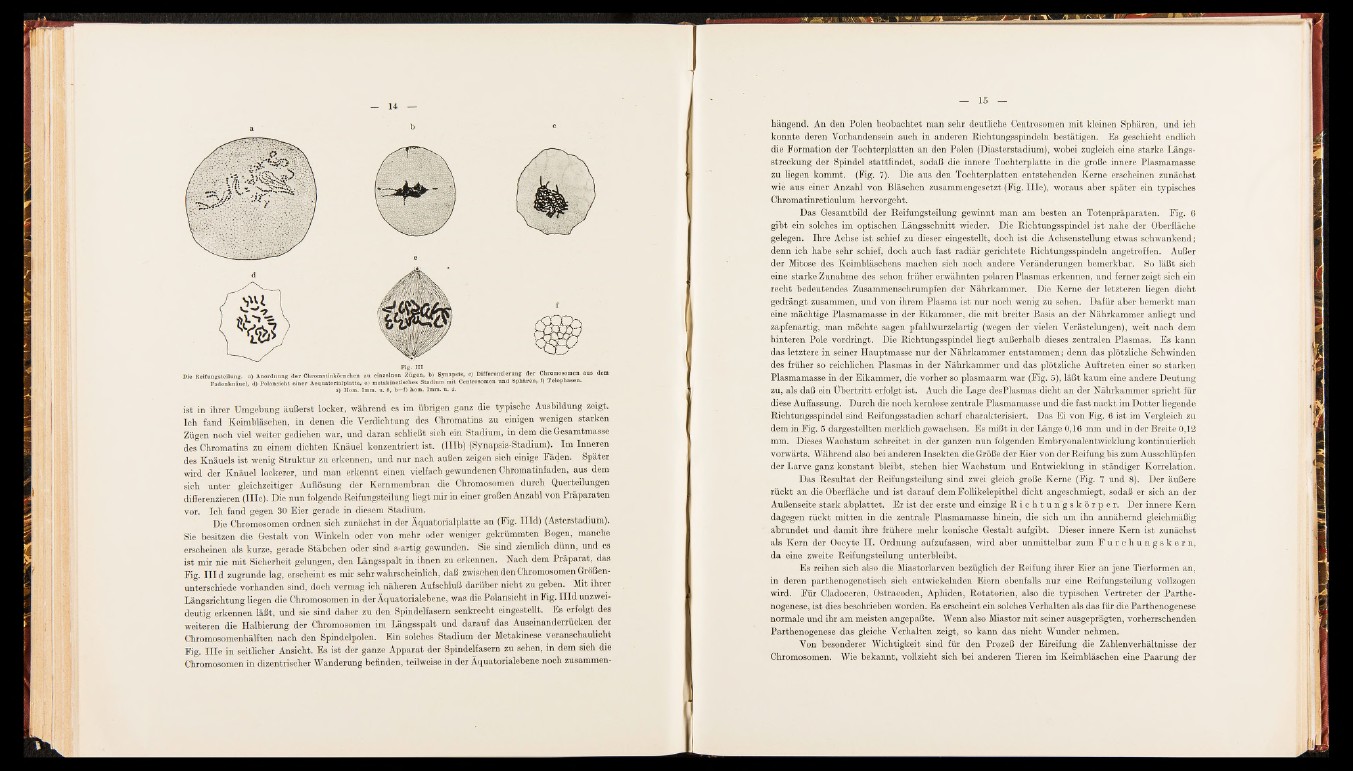
Fig. I l l
Die Reifungsteilung, a) Anordnung der Chromatinkörnchen zu einzelnen Zügen, b) Synapsis, c) Differenzierung der Chromosomen <
Fadenknäuel, d) Polansicht einer Aequatorialplattev e) metakinetisches Stadium mit Centrosomen und Sphären, f) Telophasen.
a) Hom. Imm. u. 8, b—f) hom. Imm. u. 4.
ist in ihrer Umgebung äußerst locker, während es im übrigen ganz die typische Ausbildung zeigt,
leb fand Keimbläschen, in denen die Verdichtung des Chromatins zu einigen wenigen starken
Zügen noch viel weiter gediehen war, und daran schließt sich ein Stadium, in dem die Gesamtmasse
des Chromatins zu einem dichten Knäuel konzentriert ist. (IUb) (Synapsis-Stadium). Im Inneren
des Knäuels ist wenig Struktur zu erkennen, und nur nach außen zeigen sich einige Fäden. Später
wird der Knäuel lockerer, und man erkennt einen vielfach gewundenen Chromatinfaden, aus dem
sich unter gleichzeitiger Auflösung der Kernmembran die Chromosomen durch Querteilungen
differenzieren (IIIc). Die nun folgende Reifungsteilung liegt mir in einer großen Anzahl von Präparaten
vor. Ich fand gegen 30 Eier gerade in diesem Stadium.
Die Chromosomen ordnen sich zunächst in der Äquatorialplatte an (Fig. IUd) (Asterstadium).
Sie besitzen die Gestalt von Winkeln oder von mehr oder weniger gekrümmten Bogen, manche
erscheinen als kurze, gerade Stäbchen oder sind s-artig gewunden. Sie sind ziemlich dünn, und es
ist ttiit nie mit Sicherheit gelungen, den Längsspalt in ihnen zu erkennen. Nach dem Präparat, das
Fig. I II d zugrunde lag, erscheint es mir sehr wahrscheinlich, daß z w i s c h e n den Chromosomen Größenunterschiede
vorhanden sind, doch vermag ich näheren Aufschluß darüber nicht zu geben. Mit ihrer
Längsrichtung liegen die Chromosomen in der Äquatorialebene, was die Polansicht in Fig. IUd unzweideutig
erkennen läßt, und sie sind daher zu den Spindelfasern senkrecht eingestellt. Es erfolgt des
weiteren die Halbierung der Chromosomen im Längsspalt und darauf das Auseinanderrücken der
Chromosomenhälften nach den Spindelpolen. Ein solches Stadium der Metakinese veranschaulicht
Fig. I lle in seitlicher Ansicht. Es ist der ganze Apparat der Spindelfasem zu sehen, in dem sich die
Chromosomen in dizentrischer Wanderung befinden, teilweise in der Äquatorialebene noch zusammenhängend.
An den Polen beobachtet man sehr deutliche Centrosomen mit kleinen Sphären, und ich
konnte deren Vorhandensein auch in anderen Richtungsspindeln bestätigen. Es geschieht endlich
die Formation der Tochterplatten an den Polen (Diasterstadium), wobei zugleich eine starke Längsstreckung
der Spindel stattfindet, sodaß die innere Tochterplatte in die große innere Plasmamasse
zu liegen kommt. (Fig. 7). Die aus den Tochterplatten entstehenden Kerne erscheinen zunächst
wie aus einer Anzahl von Bläschen zusammengesetzt (Fig. Ille), woraus aber später ein typisches
Chromatinreticulum hervorgeht.
Das Gesamtbild der Reifungsteilung gewinnt man am besten an Totenpräparaten. Fig. 6
gibt ein solches im optischen Längsschnitt wieder. Die Richtungsspindel ist nahe der Oberfläche
gelegen. Ihre Achse ist schief zu dieser eingestellt, doch ist die Achsenstellung etwas schwankend;
denn ich habe sehr schief, doch auch fast radiär gerichtete Richtungsspindeln angetroffen. Außer
der Mitose des Keimbläschens machen sich noch andere Veränderungen bemerkbar. So läßt sich
eine starke Zunahme des schon früher erwähnten polaren Plasmas erkennen, und ferner zeigt sich ein
recht bedeutendes Zusammenschrumpfen der Nährkammer. Die Kerne der letzteren liegen dicht
gedrängt zusammen, und von ihrem Plasma ist nur noch wenig zu sehen. Dafür aber bemerkt man
eine mächtige Plasmamasse in der Eikammer, die mit breiter Basis an der Nährkammer anliegt und
zapfenartig, man möchte sagen pfahlwurzelartig (wegen der vielen Verästelungen), weit nach dem
hinteren Pole vordringt. Die Richtungsspindel liegt außerhalb dieses zentralen Plasmas. Es kann
das letztere in seiner Hauptmasse nur der Nährkammer entstammen; denn das plötzliche Schwinden
des früher so reichlichen Plasmas in der Nährkammer und das plötzliche Auftreten einer so starken
Plasmamasse in der Eikammer, die vorher so plasmaarm war (Fig. 5), läßt kaum eine andere Deutung
zu, als daß ein Übertritt erfolgt ist. Auch die Lage desPlasmas dicht an der Nährkammer spricht für
diese Auffassung. Durch die noch kernlose zentrale Plasmamasse und die fast nackt im Dotter liegende
Richtungsspindel sind Reifungsstadien scharf charakterisiert. Das Ei von Fig. 6 ist im Vergleich zu
dem in Eig. 5 dargestellten merklich gewachsen. Es mißt in der Länge 0,16 mm und in der Breite 0,12
mm. Dieses Wachstum schreitet in der ganzen nun folgenden Embryonalentwicklung kontinuierlich
vorwärts. Während also bei anderen Insekten die Größe der Eier von der Reifung bis zum Ausschlüpfen
der Larve ganz konstant bleibt, stehen hier Wachstum und Entwicklung in ständiger Korrelation.
Das Resultat der Reifungsteilung sind zwei gleich große Kerne (Fig. 7 und 8). Der äußere
rückt an die Oberfläche und ist darauf dem Follikelepithel dicht angeschmiegt, sodaß er sich an der
Außenseite stark abplattet. Er ist der erste und einzige R i c h t u n g s k ö r p e r . Der innere Kern
dagegen rückt mitten in die zentrale Plasmamasse hinein, die sieb um ihn annähernd gleichmäßig
äbrundet und damit ihre frühere mehr konische Gestalt aufgibt. Dieser innere Kern ist zunächst
als Kern der Oocyte II. Ordnung aufzufassen, wird aber unmittelbar zum F u r c h u n g s k e r n ,
da eine zweite Reifungsteilung unterbleibt.
Es reihen sich also die Miastorlarven bezüglich der Reifung ihrer Eier an jene Tierformen an,
in deren parthenogenetisch sich entwickelnden Eiern ebenfalls nur eine Reifungsteilung vollzogen
wird. Für Cladoceren, Ostracoden, Aphiden, Rotatorien, also die typischen Vertreter der Parthenogenese,
ist dies beschrieben worden. Es erscheint ein solches Verhalten als das für die Parthenogenese
normale und ihr am meisten angepaßte. Wenn also Miastor mit seiner ausgeprägten, vorherrschenden
Parthenogenese das gleiche Verhalten zeigt, so kann das nicht Wunder nehmen.
Von besonderer Wichtigkeit sind für den Prozeß der Eireifung die Zahlenverhältnisse der
Chromosomen. Wie bekannt, vollzieht sich bei anderen Tieren im Keimbläschen eine Paarung der