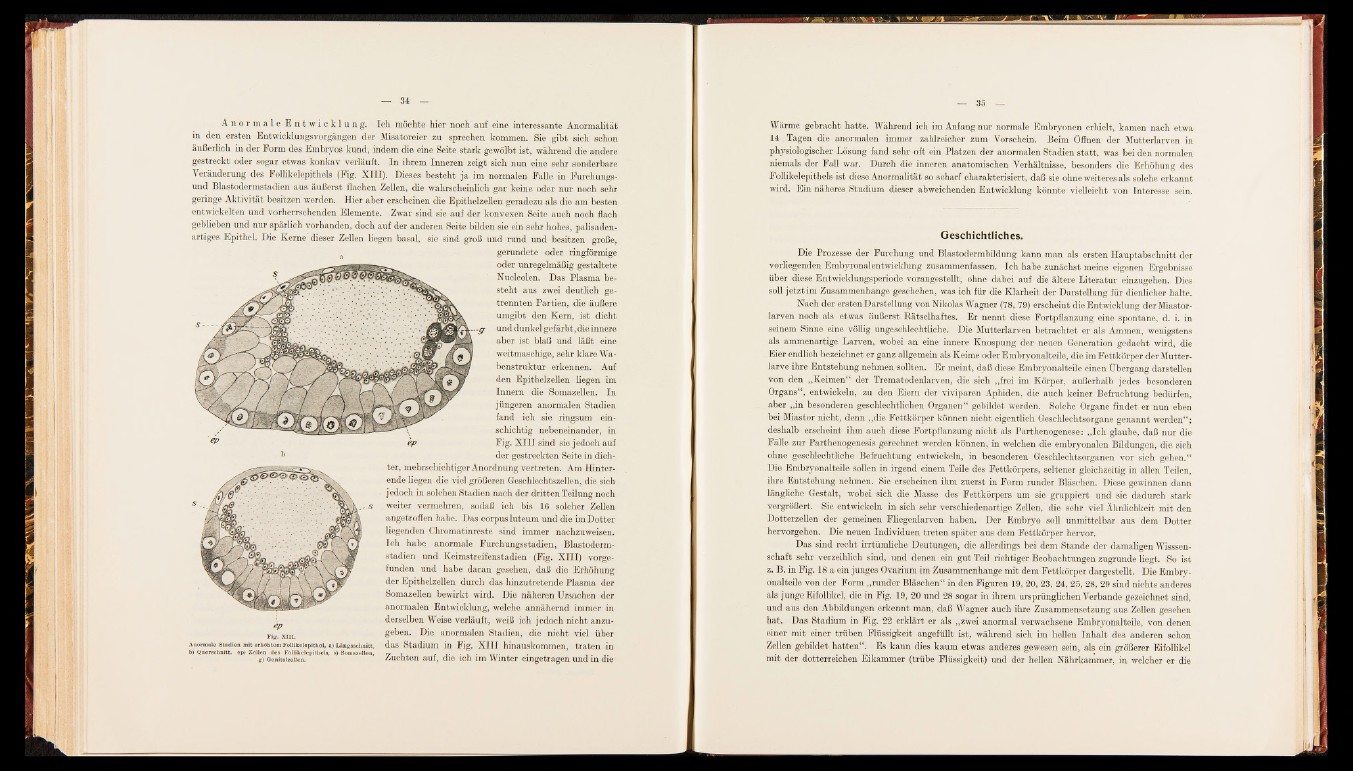
A n o rm a l e E n tw i c k l u n g . Ich. möchte hier noch auf eine interessante Anormalität
in den ersten Entwicklungsvorgängen der Misatoreier zu sprechen kommen. Sie gibt sich schon
äußerlich in der Form des Embryos kund, indem die eine Seite stark gewölbt ist, während die andere
gestreckt oder sogar etwas konkav verläuft. In ihrem Inneren zeigt sich nun eine sehr sonderbare
Veränderung des Follikelepithels (Fig. XIII). Dieses besteht ja im normalen Falle in Furchungsund
Blastodermstadien aus äußerst flachen Zellen, die wahrscheinlich gar keine oder nur noch sehr
geringe Aktivität besitzen werden. Hier aber erscheinen die Epithelzellen geradezu als die am besten
entwickelten und vorherrschenden Elemente. Zwar sind sie auf der konvexen Seite auch noch flach
geblieben und nur spärlich vorhanden, doch auf der anderen Seite bilden sie ein sehr hohes, palisadenartiges
Epithel. Die Kerne dieser Zellen liegen basal, sie sind groß und rund und besitzen große,
gerundete oder ringförmige
oder unregelmäßig gestaltete
Nucleolen. Das Plasma besteht
aus zwei deutlich getrennten
Partien, die äußere
umgibt den Kern, ist dicht
und dunkel gefärbt, die innere
aber ist blaß und läßt eine
weitmaschige, sehr klare Wabenstruktur
erkennen. Auf
den Epithelzellen liegen im
Innern die Somazellen. In
jüngeren anormalen Stadien
fand ich sie ringsum einschichtig
nebeneinander, in
Fig. XIII sind sie jedoch auf
der gestreckten Seite in dichter,
mehrschichtiger Anordnung vertreten. Am Hinterende
liegen die viel größeren Geschlechtszellen, die sich
jedoch in solchen Stadien nach der dritten Teilung noch
weiter vermehren, sodaß ich bis 16 solcher Zellen
angetroffen habe. Das corpus luteum und die im Dotter
liegenden Chromatinreste sind immer nachzuweisen.
Ich habe anormale Furchungsstadien, Blastodermstadien
und Keimstreifenstadien (Fig. XIII) vorgefunden
und habe daran gesehen, daß die Erhöhung
der Epithelzellen durch das hinzutretende Plasma der
Somazellen bewirkt wird. Die näheren Ursachen der
anormalen Entwicklung, welche annähernd immer in
derselben Weise verläuft, weiß ich jedoch nicht anzugeben.
Die anormalen Stadien, die nicht viel über
das Stadium in Fig. XIII hinauskommen, traten in
Zuchten auf, die ich im Winter eingetragen und in die
ep
F ig . X III.
Anorm ale S tad ie n m it e rh ö h tem F o llik e lep ith el, a) Län g s sch n itt,
b) Q u ersch n itt, ep) Zellen d e s Fo llik e lep ith els, s) Somazellen,
’ g) Genitalzellen.
Wärme gebracht hatte. Während ieh im Anfang nur normale Embryonen erhielt, kamen nach etwa
14 Tagen die anormalen immer zahlreicher zum Vorschein. Beim Öffnen der Mutterlarven in
physiologischer Lösung fand sehr oft ein Platzen der anormalen Stadien statt, was hei den normalen
niemals der Fall war. Durch die inneren anatomischen Verhältnisse, besonders die Erhöhung des
Eollikelepithels ist diese Anormalität so scharf charakterisiert, daß sie ohne weiteres als solche erkannt
wird. Ein näheres Studium dieser abweichenden Entwicklung könnte vielleicht von Interesse sein.
Geschichtliches.
Die Prozesse der Furchung und Blastodermbildung kann man als ersten Hauptabschnitt der
vorliegenden Bmbyronalentwicklung zusammenfassen. Ich habe zunächst meine eigenen Ergebnisse
über diese Entwicklungsperiode vorangesteÄi Ohne dabei auf die'ältere Literatur einzugehen. Dies
soll jetztim Zusammenhänge geschehen, was ich für die Klarheit der Darstellung für dienlicher halte.
Nach der ersten Darstellung von Nikolas Wagner (78, 79) erscheint die Entwicklung der Miastor-
larven noch als etwas äußerst Rätselhaftes. Er nennt diese Fortpflanzung eine spontane, d. i. in
seinem Sinne eine völlig ungeschlechtliche. Die Mutteiiarveü betrachtet er als Ammen, wenigstens
als ammenartige Larven, w»Seii an eine innere Knospung der neuen Generation' gedacht wird, die
Eierendlich bezeichnet er ganz allgemein als Keimender Embryonalteile, die im Fettkörper der Mutterlarve
ihre Entstehung nehmen sollten. Er meint, daß diese Embryonalteile einen Übergang darstellen
von den „Keimen“ der Trematodenlarven, die sich „frei im Körper, außerhalb jedes besonderen
Organs“, entwickeln, zu den Eiern der Viviparen Aphiden, rdfi äüchBkeiner Befruchtung bedürfen,
aber „in besonderen geschlechtlichen Organen“ gebildet werden. ||>löhe Organe findet er nun eben
bei Miastor nicht, denn „die Fettkörper können nicht eigentlich Geschlech|§|rgane genannt werden“ ;
deshalb erscheint ihm auch diese Fortpflanzung nicht als Parthenogenese: „Ich glaube, daß nur die
Fälle zur Parthenogenesis gerechnet werden können, in welchen die embryonalen Bildungen, die sich
ohne geschlechtliche Befruchtung entwickeln, in besonderen Geschlechtsorganen vor sich gehen.“
Die Embryonalteile sollen in irgend einem Teile des Fettkörpers, seltener gleichzeitig in allen Teilen,
ihre Entstehung nehmen. Sie erscheinen ihm zuerst in Form runder Bläschen. Diese gewinnen dann
längliche Gestalt, wobei sich die Masse des Fettkörpers um sie gruppiert und sie dadurch stark
vergrößert. Sie entwickeln in sich sehr verschiedenartige Zellen, .'sdie Sehr viel Ähnlichkeit mit den
Dotterzellen der gemeinen Fliegeidarven haben. Der Embryo'soll unmittelbar aus dem Dotter
hervorgehen. Die neuen Individuen treten später aus dem Fettkörper hervor.
Das sind recht irrtümliche Deutungen, die allerdings bei dem Stande der damaligen Wisssen-
schaft sehr verzeihlich sind, und denen ein gut Teil richtiger Beobachtungen zugrunde liegt. So ist
z. B. in Fig. 18 a ein junges Ovarium im Zusammenhänge mit dem Fettkörper dargestellt. Die Embryonalteile
von der Form „runder Bläschen“ in den Figuren 19, 20, 23, 24, 25, 28) 29 sind nichts anderes
als junge Eifollikel, die in Fig. 19, 20 und 28 sogar in ihrem ursprünglichen Verbände gezeichnet sind,
und aus den Abbildungen erkennt man, daß Wagner anch ihre Zusammensetzung aus Zellen gesehen
hat. Das Stadium in Fig. 22 erklärt er als „zwei anormal verwachsene Embryonalteile, von denen
einer mit einer trüben Flüssigkeit angefüllt ist, während sich im hellen Inhalt des anderen schon
Zellen gebildet hatten“. Es kann dies kaum etwas anderes gewesen sein, als ein größerer Eifollikel
mit der dotterreichen Eikammer (trübe Flüssigkeit) und der hellen Nährkammer, in welcher er die