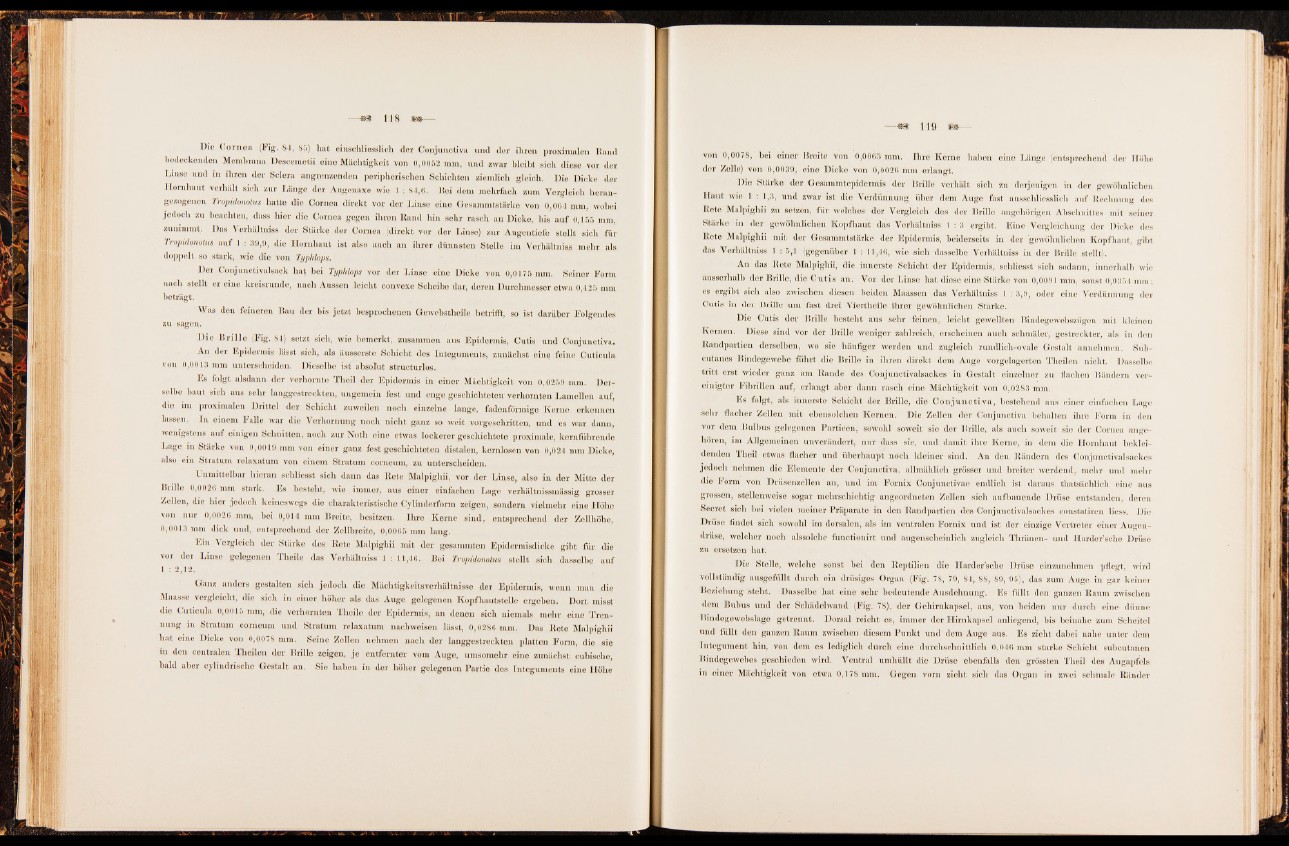
-«9 118 8»
Die C o rn e a (Fig. 84, 85) hat einschliesslich der Conjunctiva und der ihren proximalen Ktuid
bedeckenden Membrana Descemetii eine Mächtigkeit von 0,0052 mm, und zwar bloibt sich diese vor der
Linse und in ihren der Sclera angrenzenden peripherischen Schichten ziemlich gleich. Die Dicke der
Hornhaut verhält sich zur Länge der Augenaxe wie 1 ; 84,0. Hei dem mehrfach zum Vergleich horan-
gozogenen Tropidonolus hatte die Cornea direkt vor der Linse eine Gesammtstärke von 0,004 mm, wohei
jedoch zu beachten, dass hier die Cornea gegen ihren Band hin sehr rasch au Dicke, bis a u f 0,155 mm,
zunimmt. Das Verhültniss der Stärke der Cornea (direkt vor dev Linse) zur Augentiefo stellt sich fiir
Tropidonolus auf 1 : 00,0, die Hornhaut ist also auch an ihrer dünnsten Stelle im Verhältniss mehr als
doppelt so stark, wie die von Typhlops.
Der Conjunctivalsack hat bei Typhlops vor der Linse oine Dicke von 0,0175 mm. Seiner Form
nach stellt er oino kreisrunde, nach Aussen leicht convexe Scheibe dar, deren Durchmesser etwa 0,425 mm
beträgt.
Was den feineren Bau der bis jetzt besprochenen Gewebstheile betrifft, so ist darüber Folgendes
zu sagen.
D ie B r ille (Fig. 84) setzt sich, wie bemerkt, zusammen aus Epidermis, Cutis und Conjunctiva.
An der Epidermis lässt sich, als äusserste Schicht des Integuments, zunächst eine feine Cuticula
von 0,0013 mm unterscheiden. Dieselbe ist absolut structurlos.
Es folgt alsdann der verhornte Thcil der Epidermis in einer Mächtigkeit von 0,0250 mm. Derselbe
baut sich aus Belir langgestreckten, ungemeiu fest und enge geschichteten verhornten Lamellen auf,
die im proximalen Drittel der Schicht zuweilen noch einzelne lange, fadenförmige Kerne erkennen
lassen. In einem Falle war die Verhornung noch nicht ganz so weit vorgeschritten, und es war dann,
wenigstens auf einigen Schnitten, noch zur Notli eine etwas lockerer geschichtete proximale, kornführende
Lage m Stärke von 0,0010 mm von einer ganz fest geschichteten distalen, kernlosen von 0,024 mm Dicke,
also ein Stratum relaxatum von einem Stratum corneum, zu unterscheiden.
Unmittelbar hieran schliesst sich dann das Bete Malpighii, vor der Linse, also in der Mitte der
Brille 0,0020 mm stark. Es besteht, wie immer, aus einer einfachen Lage verliältnissmässig grösser
Zollen, die hier jedoch keineswegs die charakteristische Cylinderform zeigen, sondern vielmehr eine Höhe
von nur 0,0026 mm, bei 0,014 mm Breite, besitzen. Ihre Kerne sind, entsprechend der Zellhöhe,
0,0013 mm dick und, entsprechend der Zellbreite, 0,0065 mm lang.
Ein Vergleich der Stärke des Kete Malpighii mit der gesammten Epidermisdicke gibt für die
vor der Linse gelegenen Theile das Verhältniss 1 : 11,40. Bei Tropidonolus stellt sich dasselbe auf
1 : 2,12.
Ganz anders gestalten sich jedoch die Mächtigkeitsverhältnisse der Epidermis, wenn man die
Maasse vergleicht, die sich in einer höher als das Auge gelegenen Kopfhautstelle ergeben. Dort misst
die Cuticula 0,0015 mm, die verhornten Theile der Epidermis, an denen sich niemals mehr eine Trennung
in Stratum corneum und Stratum relaxatum nachweisen lässt, 0,0280 mm. Das Bete Malpighii
h a t eine Dicke von 0,0078 mm. Seine Zellen nehmen nach der langgestreckten platten Form, die sie
m den centralen Theilen der Brille zeigen, jo entfernter vom Auge, umsomehr eine zunächst cubische,
bald aber cylindrische Gestalt an. Sie haben in der höher gelegenen Partie des Integuments eine Höhe
von 0,0078, hei einer Breite von 0,0065 mm. Ihre Kerne halien eine Länge (entsprechend der Höhe
der Zolle) von 0,0039, eine Dicke von 0,0026 mm erlangt.
Die Stärke der Gesammtepidermis der Brille verhält sich zu derjenigen in der gewöhnlichen
H au t wie 1 : 1,3, und zwar ist die Verdünnung über dem Auge fast ausschliesslich auf Rechnung des
Rete Malpighii zu setzen, für welches der Vergleich des der Brille ungehörigen Abschnittes mit seiner
Stärke in der gewöhnlichen Kopfhaut das Verhältniss t : 3 ergibt. Eine Vergleichung der Dicke des
Rete Malpighii mit der Gesammtstärke der Epidermis, beiderseits in der gewöhnlichen Kopfhaut, gibt
das Verhältniss 1 : 5,1 (gegenüber 1 : 11,46, wie sich dasselbe Verhältniss in der Brille stellt).
An das Rete Malpighii, die innerste Schicht der Epidermis, schliesst sich sodann, innerhalb wie
ausserhalb der Brille, die C u tis an. Vor der Linse hat diese eine Stärke von 0,0091 mm, sonst 0,0354 mm;
es ergibt sich also zwischen diesen beiden Maassen das Verhältniss 1 : 3,9, oder eine Verdünnung der
Cutis in der Brille um fast drei Viertheile ihrer gewöhnlichen Stärke.
Die Cutis der Brille besteht aus sehr feinen, leicht gewellten Bindegewebsziigen mit kleinen
Kernen. Diese sind vor der Brille weniger zahlreich, erscheinen auch schmäler, gestreckter, als in den
Randpartien derselben, wo sie häufiger werden und zugleich rundlich-ovale Gestalt annehmon. Sub-
cutanes Bindegewebe führt die Brille in ihren direkt dem Auge vorgelagerten Theilen nicht. Dasselbe
tritt erst wieder ganz am Rande des Conjunctivalsackes in Gestalt einzelner zu flachen Bändern vereinigter
Mbrillen auf, erlangt aber dann rasch eine Mächtigkeit von 0,0283 mm.
Es folgt, als innerste Schicht der Brille, die C o n ju n c tiv a , bestehend aus einer einfachen Lage
sehr flacher Zellen mit ebensolchen Kernen. Die Zellen der Conjunctiva behalten ihre I?onn in den
vor dem Bulbus gelegenen Partieen, sowohl soweit sie der Brille, als auch soweit sie der Cornea angeboren,
im Allgemeinen unverändert, nur dass sie, und damit ihre Kerne, in dem die Hornhaut bekleidenden
Theil etwas flacher und überhaupt noch kleiner sind. An den Rändern des Conjunctivalsackes
jedoch nehmen die Elemente der Conjunctiva, allmählich grösser und breiter werdend, mehr und mehr
die Form von Drüsenzellen an, und im Fornix Conjunctivae endlich ist daraus thatsächlich eine aus
grossen, stellenweise sogar mehrschichtig angeordneten Zellen sich aufbauende Drüse entstanden, deren
Secrel sich bei vielen meiner Präparate in den Randpartien des Conjunctivalsackes constatiren liess. Die
Drüse findet sich sowohl im dorsalen, als im ventralen Fornix und ist der einzige Vertreter einer Augendrüse,
welcher noch alssolche functionirt und augenscheinlich zugleich Thränen- und Harder’sche Drüse
zu ersetzen hat.
Die Stelle, welche sonst bei den Reptilien die Harder’sche Drüse einzunehmen pflegt, wird
vollständig ausgefüllt durch ein drüsiges Organ (Fig. 78, 79, 84, 88, 89, 95), das zum Auge in gar keiner
Beziehung steht. Dasselbe hat eine sehr bedeutende Ausdehnung. Es füllt den ganzen Raum zwischen
dem Bübus und der Schädelwand (Fig. 78), der Gehirnkapsel, aus, von beiden nur durch eine dünne
Bindegewebslage getrennt. Dorsal reicht es, immer der Hirnkapsel anliegend, bis beinahe zum Scheitel
und füllt den ganzen Raum zwischen diesem P u n k t und dem Auge aus. Es zieht dabei nahe unter dem
Integument hin, von dem es lediglich durch eine durchschnittlich 0,046 mm starke Schicht subcutanen
Bindegewebes geschieden wird. Ventral umhüllt die Drüse ebenfalls den grössten Theil des Augapfels
in einer Mächtigkeit von etwa 0,178 inm. Gegen vorn zieht sich das Organ in zwei schmale Ränder