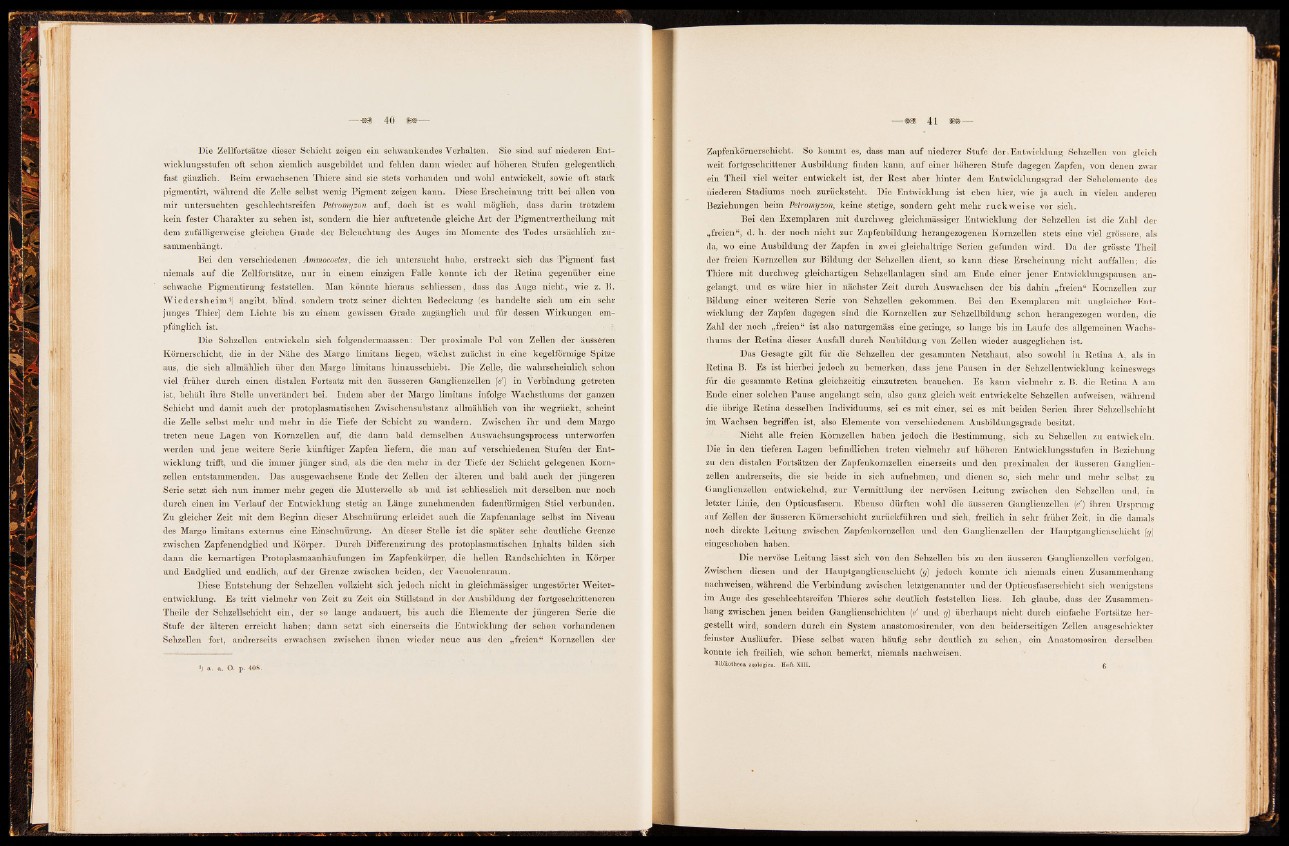
Die Zellfortsätze dieser Schicht zeigen ein schwankendes Verhalten. Sie sind au f niederen Ent-r
wicklungsstufen oft schon ziemlich ausgebildet und fehlen dann wieder auf höheren Stufen gelegentlich,
fast gänzlich. Keim erwachsenen Thiere sind sie stets vorhanden und wohl entwickelt, sowie oft stark
pigmentirt, während die Zelle seihst wenig Pigment zeigen kann. Diese Erscheinung tritt bei allen von
mir untersuchten geschlechtsreifen Petromyzon auf, doch ist es wohl möglich, dass darin trotzdem
kein fester Charakter zu sehen ist, sondern die hier auftretende gleiche Art der Pigmentvertheilung mit
dem zufälligerweise gleichen Grade der Beleuchtung des Auges im Momente des Todes ursächlich zusammenhängt.
Bei den verschiedenen Ammocoetes, die ich untersucht habe, erstreckt sich das Pigment fast
niemals auf die Zellfortsätze, nur in einem einzigen Falle konnte ich der Retina gegenüber eine
schwache Pigmentirung feststellen. Man könnte hieraus schliessen, dass das Auge nicht , wie z. B.
W i e d e r s h e im 1) angibt, blind, sondern trotz seiner dichten Bedeckung (es handelte sich um ein sehr
junges Thier) dem Lichte bis zu einem gewissen Grade zugänglich und für dessen Wirkungen empfänglich
ist.
Die Sehzellen entwickeln sich folgendermaassen: Der proximale Pol von Zellen der äusseien
Körnerschicht, die in der Nähe des Margo limitans liegen, wächst zuächst in eine kegelförmige Spitze
aus, die sich allmählich über den Margo limitans hinausschiebt. Die Zelle, die wahrscheinlich schon
viel [früher durch einen distalen Fortsatz mit den äusseren Ganglienzellen (e') in Verbindung getreten
ist, behält ihre Stelle unverändert hei. Indem aber der Margo limitans infolge Wachsthums der ganzen
Schicht und damit auch der protoplasmatischen Zwischensubstanz allmählich von ih r wegrückt, scheint
die Zelle seihst mehr und mehr in die Tiefe der Schicht zu wandern. Zwischen ihr und dem Margo
treten neue Lagen von Kornzellen auf, die dann bald demselben Auswachsungsprocess unterworfen
werden und jene weitere Serie künftiger Zapfen liefern, die man auf verschiedenen Stufen der E n twicklung
trifft, und die immer jünger sind, als die den mehr in der Tiefe der Schicht gelegenen Kornzellen
entstammenden. Das ausgewachsene Ende der Zellen der älteren und bald auch der jüngeren
Serie setzt sich nu n immer mehr gegen die Mutterzelle ah und is t schliesslich mit derselben nur noch
durch einen im Verlauf der Entwicklung stetig an Länge zunehmenden fadenförmigen Stiel verbunden.
Zu gleicher Zeit mit dem Beginn dieser Abschnürung erleidet auch die Zapfenanlage selbst im Niveau
des Margo limitans externus eine Einschnürung. An dieser Stelle ist die später sehr deutliche Grenze
zwischen Zapfenendglied un d Körper. Durch Differenzirung des protoplasmatischen Inhalts bilden sich
dann die kernartigen Protoplasmaanhäufungen im Zapfenkörper, die hellen Randschichten in Körper
und Endglied und endlich, auf der Grenze zwischen beiden, der Vacuolenraum.
Diese Entstehung der Sehzellen vollzieht sich jedoch nicht in gleichmässiger ungestörter Weiterentwicklung.
Es tritt vielmehr von Zeit zu Zeit ein Stillstand in der Ausbildung der fortgeschritteneren
Theile der Sehzellschicht e in, der so lange andauert, bis auch die Elemente der jüngeren Serie die
Stufe der älteren erreicht haben; dann setzt sich einerseits die Entwicklung der schon vorhandenen
Sehzellen fort, andrerseits erwachsen zwischen ihnen wieder neue aus den „freien“ Kornzellen der
Zapfenkörnerschicht.' So kommt es, dass man au f niederer Stufe der .Entwicklung Sehzellen von gleich
weit fortgeschrittener Ausbildung finden kann, au f einer höheren Stufe dagegen Zapfen, von denen zwar
ein Theil viel weiter entwickelt ist, der Rest aber hinter dem Entwicklungsgrad der Sehelemente des
niederen Stadiums noch zurücksteht. Die Entwicklung ist eben hier, wie ja auch in vielen anderen
Beziehungen beim Petromyzon, keine stetige, sondern geht mehr r u c k w e is e vor sich.
Bei den Exemplaren mit durchweg gleichmässiger Entwicklung der Sehzellen ist die Zahl der
„freien“, d. h. der noch nicht zur Zapfenbildung herangezogenen Kornzellen stets eine viel grössere, als
da, wo eine Ausbildung der Zapfen in zwei gleichaltrige Serien gefunden wird. Da der grösste Theil
der freien Kornzellen zur Bildung der Sehzellen dient, so kann diese Erscheinung nicht auffallen; die
Thiere mit durchweg gleichartigen Sehzellanlagen sind am Ende einer jener Entwicklungspausen angelangt.
und es wäre h ie r in nächster Zeit durch Auswachsen der bis dahin „freien“ Kornzellen zur
Bildung einer weiteren Serie von Sehzellen gekommen. Bei den Exemplaren mit ungleicher En twicklung
der Zapfen dagegen sind die Kornzellen zur Sehzellbildung schon herangezogen worden, die
Zahl der noch „freien“ ist also naturgemäss eine geringe, so lange bis im Laufe des allgemeinen Wachsthums
der Retina dieser Ausfall durch Neubildung von Zellen wieder ausgeglichen ist..
Das Gesagte gilt für die Sehzellen der gesammten Netzhaut, also sowohl in Retina A, als in
Retina B. Es ist hierbei jedoch zu bemerken, dass jene Pausen in der Sehzellentwicklung keineswegs
für die gesammte Retina gleichzeitig einzutreten brauchen. Es kann vielmehr z. B. die Retina A am
Ende einer solchen Pause angelangt sein, also ganz gleich weit entwickelte Sehzellen aufweisen, wahrend
die übrige Retina desselben Individuums, sei es mit einer, sei es mit beiden Serien ihrer Sehzellschicht
im Wachsen begriffen ist, also Elemente von verschiedenem Ausbildungsgrade besitzt.
Nicht alle freien Körnzellen haben jedoch die Bestimmung, sich zu Sehzellen zu entwickeln.
Die in den tieferen Lagen befindlichen treten vielmehr auf höheren Entwicklungsstufen in Beziehung
zu den distalen Fortsätzen der Zapfenkornzellen einerseits und den proximalen der äusseren Ganglienzellen
andrerseits, die sie beide in sich aufnehmen, und dienen so, sich mehr und mehr seihst zu
Ganglienzellen entwickelnd, zur Vermittlung der nervösen Leitung zwischen den Sehzellen und, in
letzter Linie, den Opticusfasern. Ebenso dürften wohl die äusseren Ganglienzellen [e') ihren Ursprung
auf Zellen der äusseren Körnerschicht zurückführen und sich, freilich in sehr früher Zeit, in die damals
noch direkte Leitung zwischen Zapfenkornzellen und den Ganglienzellen der Hauptganglienschicht (g)
eingeschoben haben.
Die nervöse Leitung lässt sich von den Sehzellen bis zu den äusseren Ganglienzellen verfolgen.
Zwischen diesen und der Hauptganglienschicht (g) jedoch konnte ich niemals einen Zusammenhang
nachweisen, während die Verbindung zwischen letztgenannter und der Opticusfaserschicht sich wenigstens
im Auge des geschlechtsreifen Thieres sehr deutlich feststellen liess. Ich glaube, dass der Zusammenhang
zwischen jenen beiden Ganglienschichten (e1 und g) überhaupt nicht durch einfache Fortsätze hergestellt
wird, sondern durch ein System anastomosirender, von den beiderseitigen Zellen ausgeschickter
feinster Ausläufer. Diese selbst waren häufig sehr deutlich zu sehen, ein Anastomosiren derselben
konnte ich freilich, wie schon bemerkt, niemals nachweisen.
Bibliotheca zqologica. Heft XIU. g