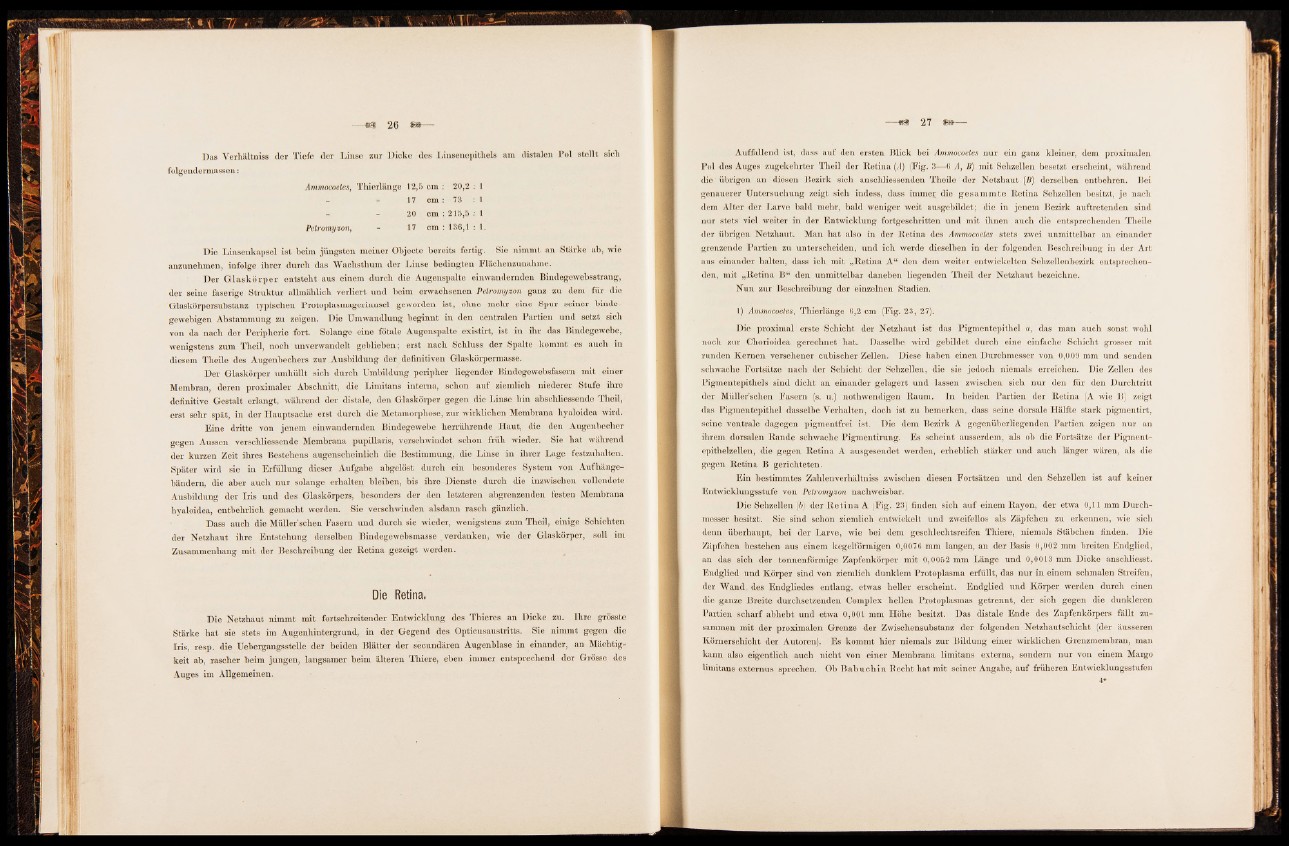
Das Verhältniss der Tiefe der Linse zur Dicke des Linsenepitliels am distalen Pol stellt sich
folgendermassen:
Ammocoetes, Thierlänge 12,5 cm : 20,2 : 1
17 c m : 73 : 1
20 cm : 215,5 : 1
Petromyzon, - 17 cm : 136,1 : 1.
Die Linsenkapsel ist beim jüngsten meiner Objecte bereits fertig. Sie nimmt an Stärke ab, wie
anzunehmen, infolge ihre r durch das Wachsthum der Linse bedingten Flächenzunahme.
Der G la s k ö r p e r entsteht aus einem durch die Augenspalte einwandernden Bindegewebsstrang,
der seine faserige Struktur allmählich verliert und beim erwachsenen Petromyzon ganz zu dem für die
Glaskörpersubstanz typischen Protoplasmagerinnsel geworden ist, ohne mehr eine Spur seiner bindegewebigen
Abstammung zu zeigen. Die Umwandlung beginnt in den centralen Partien und setzt sich
von da nach der Peripherie fort. Solange eine fötale Augenspalte existirt, ist in ih r das Bindegewebe,
wenigstens zum Theil, noch unverwandelt geblieben; erst nach Schluss der Spalte kommt es auch in
diesem Theile des Augenbechers zur .Ausbildung der definitiven Glaskörpermasse.
Der Glaskörper umhüllt sich durch Umbildung peripher liegender Bindegewebsfasern mit einer
Membran, deren proximaler Abschnitt, die Limitans interna, schon auf ziemlich niederer Stufe ihre
definitive Gestalt erlangt, während der distale, den Glaskörper gegen die Linse hin abschliessende Theil,
erst sehr spät, in der Hauptsache erst durch die Metamorphose, zur wirklichen Membrana hyaloidea wird.
Eine dritte von jenem einwandernden Bindegewebe herrührende Haut, die den Augenbecher
o-egen Aussen verschliessende Membrana pupillaris, verschwindet schon früh wieder. Sie h a t während
der kurzen Zeit ihres Bestehens augenscheinlich die Bestimmung, die Linse in ihrer Lage festzuhalten.
Später wird sie in Erfüllung dieser Aufgabe abgelöst durch ein besonderes System von Aufhängebändern,
die aber auch nur solange erhalten bleiben, bis ihre Dienste durch die inzwischen vollendete
Ausbildung der Iris und des Glaskörpers, besonders der den letzteren abgrenzenden festen Membrana
hyaloidea, entbehrlich gemacht werden. Sie verschwinden alsdann rasch gänzlich.
Dass auch die Müller’sehen Fasern und durch sie wieder, wenigstens zum Theil, einige Schichten
der Netzhaut ihre Entstehung derselben Bindegewebsmasse verdanken, wie der Glaskörper, soll im
Zusammenhang mit der Beschreibung der Retina gezeigt werden.
Die Retina.
Die Netzhaut nimmt mit fortschreitender Entwicklung des Thieres an Dicke zu. Ih re grösste
Stärke h a t sie stets im Augenhintergrund, in der Gegend des Opticusaustritts. Sie nimmt gegen die
Iris, resp. die Uebergangsstelle der beiden Blätter der secundären Augenblase in einander, an Mächtigkeit
ab, rascher beim jungen, langsamer beim älteren Thiere, eben immer entsprechend der Grösse des
Auges im Allgemeinen.
Auffallend ist, dass auf den ersten Blick bei Ammocoetes nur ein ganz kleiner, dem proximalen
Pol des Auges zugekehrter Theil der Retina [A) (Fig. 3—6 A, B) mit Sehzellen besetzt erscheint, während
die übrigen an diesen Bezirk sich anschliessenden Theile der Netzhaut [B) derselben entbehren. Bei
genauerer Untersuchung zeigt sich indess, dass immer die ge s am m te Retina Sehzellen besitzt, je nach
dem Alter der Larve bald mehr, bald weniger weit ausgebildet; die in jenem Bezirk auftretenden sind
nur stets viel weiter in der Entwicklung fortgeschritten und mit ihnen auch die entsprechenden Theile
der übrigen Netzhaut. Man hat also in der Retina des Ammocoetes stets zwei unmittelbar an einander
grenzende Partien zu unterscheiden, und ich werde dieselben in der folgenden Beschreibung in der Art
aus einander halten, dass ich mit „Retina A“ den dem weiter entwickelten Sehzellenbezirk entsprechenden,
mit „Retina B “ den unmittelbar daneben liegenden Theil der Netzhaut bezeichne.
Nun zur Beschreibung der einzelnen Stadien.
1) Ammocoetes, Thierlänge 6,2 cm (Fig. 23, 27).
Die proximal erste Schicht der Netzhaut ist das Pigmentepithel a, das man auch sonst wohl
noch zur Chorioidea gerechnet hat. Dasselbe wird gebildet durch eine einfache Schicht grösser mit
runden Kernen versehener cubischer Zellen. Diese haben einen Durchmesser von 0,009 mm und senden
schwache Fortsätze nach der Schicht der Sehzellen, die sie jedoch niemals erreichen. Die Zellen des
Pigmentepithels sind dicht an einander gelagert und lassen zwischen sich nur den für den Durchtritt
der Müller’schen Fasern (s. u.) nothwendigen Raum. In beiden Partien der Retina (A wie B) zeigt
das Pigmentepithel dasselbe Verhalten, doch ist zu bemerken, dass seine dorsale Hälfte stark pigmentirt,
seine ventrale dagegen pigmentfrei ist. Die dem Bezirk A gegenüberliegenden Partien zeigen n u r an
ihrem dorsalen Rande schwache Pigmentirung. Es scheint ausserdem, als ob die Fortsätze der Pigmentepithelzellen,
die gegen Retina A ausgesendet werden, erheblich stärker und auch länger wären, als die
gegen Retina B gerichteten.
Ein bestimmtes Zahlen verhältniss zwischen diesen Fortsätzen und den Sehzellen ist auf keiner
Entwicklungsstufe von Petromyzon nachweisbar.
Die Sehzellen (6) der R e t in a A (Fig. 23) finden sich auf einem Rayon, der etwa 0,11 mm Durchmesser
besitzt. Sie sind schon ziemlich entwickelt und zweifellos als Zäpfchen zu erkennen, wie sich
denn überhaupt, bei der Larve, wie bei dem geschlechtsreifen Thiere, niemals Stäbchen finden. Die
Zäpfchen bestehen aus einem kegelförmigen 0,0076 mm langen, an der Basis 0,002 mm breiten Endglied,
an das sich der tonnenförmige Zapfenkörper mit 0,0052 mm Länge und 0,0013 mm Dicke anschliesst.
Endglied und Körper sind von ziemlich dunklem Protoplasma erfüllt, das nur in einem schmalen Streifen,
der Wand des Endgliedes entlang, etwas heller erscheint. Endglied und Körper werden durch einen
die ganze Breite durchsetzenden Complex hellen Protoplasmas getrennt, der sich gegen die dunkleren
Partien scharf abhebt und etwa 0,001 mm Höhe besitzt. Das distale Ende des Zapfenkörpers fällt zusammen
mit der proximalen Grenze der Zwischensubstanz der folgenden Netzhautschicht (der äusseren
Körnerschicht der Autoren). Es kommt hier niemals zur Bildung einer wirklichen Grenzmembran, man
kann also eigentlich auch nicht von einer Membrana limitans externa, sondern nur von einem Margo
limitans extemus sprechen. Ob B a b u c h in Recht h a t mit seiner Angabe, auf früheren Entwicklungsstufen
4*