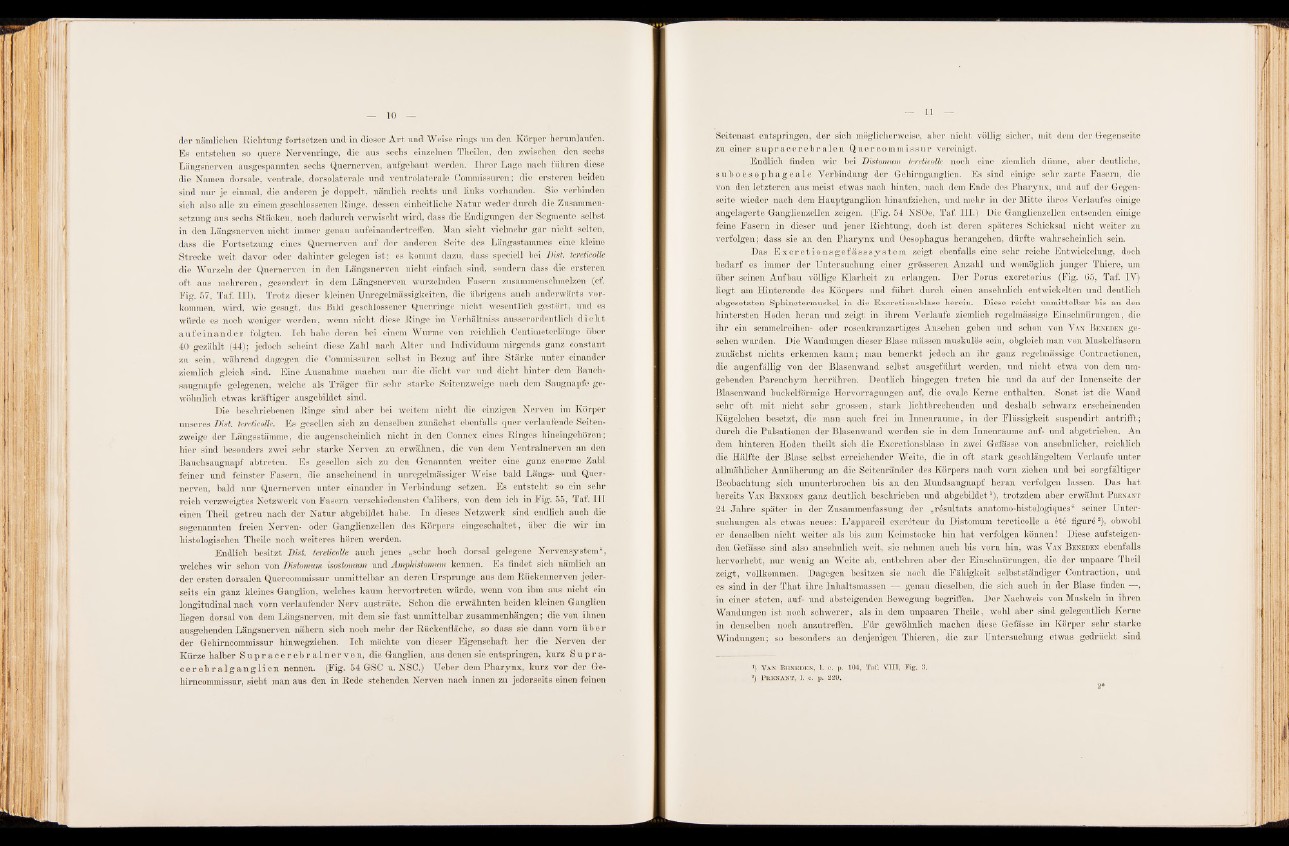
— io H
der nämliclien Richtung fortsetzen und in dieser A r t und Weise rings um den Körper herumlaufen.
Es entstellen so quere Nervenringe, die aus sechs einzelnen Theilen, den zwischen den sechs
Längsnerven ausgespannten sechs Quernerven, aufgebaut werden. Ih r e r Lage nach führen diese
die Namen dorsale, ventrale, dorsolaterale und ven tro la te ra le Commissnren; die ersteren beiden
sind n u r je einmal, die anderen je doppelt, nämlich re chts und links vorhanden. Sie verbinden
sich also alle zu einem geschlossenen Ringe, dessen einheitliche N a tu r weder durch die Zusammensetzung
aus sechs Stücken, noch dadurch verwischt wird, dass die Endigungen der Segmente selbst
in den Längsnerven nich t immer genau aufeinandertreffen. Man sieht vielmehr g a r nich t selten,
dass die F o rtse tzu n g eines Quernerven au f der anderen Seite des Längsstammes eine kleine
Strecke weit davor oder d a h in te r gelegen is t; es kommt dazu, dass speciell bei Dist. tereticolle
die Wurzeln der Quernerven in den Längsnerven n ich t einfach sind, sondern dass die ersteren
oft aus mehreren, gesondert in dem Längsnerven wurzelnden F a se rn zusammenschmelzen (cf.
Fig. 57, Taf. III). T ro tz dieser kleinen Unregelmässigkeiten, die übrigens auch a nderw ärts Vorkommen,
wird, wie gesagt, das Bild geschlossener Querringe nicht wesentlich gestört, und es
würde es noch weniger werden, wenn nicht diese Ringe im Verhältniss ausserordentlich d i c h t
a u f e i n a n d e r folgten. Ich habe deren bei einem Wurme von reichlich Centimeterlängc über
40 gezählt (44); jedoch scheint diese Zahl nach A lte r und Individuum nirgends ganz constant
zu s e in , während dagegen . die Commissuren selbst in Bezug au f ih re S tä rk e u n te r einander
ziemlich gleich sind. Eine Ausnahme machen n u r die dicht vor und dicht h in te r dem Bauchsaugnapfe
gelegenen, welche als T räg e r fü r sehr s tark e Seitenzweige nach dem Sangnapfe gewöhnlich
etwas k rä ftig e r ausgebildet sind.
Die beschriebenen Ringe sind aber bei weitem nich t die einzigen Nerven im Körper
unseres Dist. tereticolle. Es gesellen sich zu denselben zunächst ebenfalls quer verlaufende Seitenzweige
der Längsstämme, die augenscheinlich nicht in den Connex eines Ringes hineingehören;
h ie r sind besonders zwei sehr s ta rk e Nerven zu erwähnen, die von dem Ventralnerven an den
Bauchsaugnapf abtreten. Es gesellen sich zu den Genannten weiter eine ganz enorme Zahl
feiner und feinster Fa sern, die anscheinend in unregelmässiger Weise bald Längs- und Quernerven,
bald n u r Quernerven u n te r einander in Verbindung setzen. Es en tsteh t so ein sehr
reich verzweigtes Netzwerk von F a s e rn verschiedensten Calibers, von dem ich in Fig. 55, Taf. I I I
einen Theil ge treu nach der N a tu r abgebildet habe. In dieses Netzwerk sind endlich auch die
sogenannten freien Nerven- oder Ganglienzellen des Körpers eingeschaltet, über die w ir im
histologischen Theile noch weiteres hören werden.
Endlich b esitzt Dist. tereticolle auch jenes „sehr hoch dorsal gelegene Nervensystem“,
welches w ir schon von Distomum isostomum und Amphistomum kennen. Es findet sich nämlich an
der ersten dorsalen Quercommissur u nmittelbar an deren Ursprünge aus dem Rückennerven jederseits
ein ganz kleines Ganglion, welches kaum h e rv o rtre ten würde, wenn von ihm aus n ich t ein
longitudinal nach vorn verlaufender Nerv au sträte. Schon die erwähnten beiden kleinen Ganglien
liegen dorsal von dem Längsnerven, mit dem sie fa s t u nmittelbar Zusammenhängen; die von ihnen
ausgehenden Längsnerven n ähern sich noch mehr der Rückenfläche, so dass sie dann vorn ü b e r
der Gehirncommissur hinwegziehen. Ic h möchte von dieser Eigenschaft h e r die Nerven der
Kürze halber S u p r a c e r e b r a l n e r v e n , die Ganglien, aus denen sie entspringen, k u rz S u p r a c
e r e b r a l g a n g l i e n nennen. (Fig. 54 GSC u. NSC.) Ueber dem P h a ry n x , k u rz v o r der Gehirncommissur,
s ieht man ans den in Rede stehenden Nerven nach innen zu jederseits einen feinen
- 11
Seitenast entspringen, d e r sich möglicherweise, aber n ich t völlig sicher, mit dem der Gegenseite
zu einer s u p r a c e r e b r a l e n Q u e r c o m m i s s u r vereinigt.
Endlich finden w ir bei Distomum tereticolle noch eine ziemlich dünne, aber deutliche,
s u b o e s o p h a g e a l e Verbindung der Gehirnganglien. Es sind einige sehr z arte Fasern, die
von den le tz teren aus meist etwas nach hinten, nach dem Ende des P h a ry n x , und auf. d er Gegenseite
wieder nach dem Hauptganglion hinaufziehen, und mehr in der Mitte ihres Verlaufes einige
angelagerte Ganglienzellen zeigen. (Fig. 54 NSOe, Taf. II I.) Die Ganglienzellen entsenden einige
feine F a sern in dieser und jener Richtung, doch is t deren späteres Schicksal n ich t weiter zu
verfolgen; dass sie an den P h a ry n x und Oesophagus herangehen, dürfte wahrscheinlich sein.
Das E x c r e t i o n s g e f ä s s S y s t e m zeigt ebenfalls eine sehr reiche Entwickelung, doch
b ed arf es immer der Untersuchung einer grösseren Anzahl und womöglich ju n g e r Thiere, um
über seinen Aufbau völlige K la rh e it zu erlangen. Der Porus excretorius (Fig. 65, Taf. IV)
lieg t am Hinterende des Körpers und fü h r t durch einen ansehnlich entwickelten und deutlich
abgesetzten Sphinctermuskel in die Excretionsblase herein. Diese re ich t unmittelbar bis an den
h in te rsten Hoden heran und zeigt in ihrem Verlaufe ziemlich regelmässige Einschnürungen, die
ih r ein semmelreihen- oder rosenkranzartiges Ansehen geben und schon von V a n B en ed en gesehen
wurden. Die Wandungen dieser Blase müssen muskulös sein, obgleich man von Muskelfasern
zunächst nichts erkennen k an n ; man bemerkt jedoch an ih r ganz regelmässige Contractionen,
die augenfällig von der Blasenwand selbst ausgeführt werden, und n ich t etwa von dem umgebenden
Parenchym herriihren. Deutlich hingegen tre te n hie und da au f der Innenseite der
Blasenwand buckelförmige Hervorragungen auf, die ovale Kerne enthalten. Sonst is t die Wand
sehr oft mit nich t sehr gro ssen , s ta rk lichtbrechenden und deshalb schwarz erscheinenden
Kügelchen besetzt, die man a,uch frei im Innenraume, in der Flüssigkeit suspendirt a n trifft;
durch die Pulsationen der Blasenwand werden sie in dem Innenraume auf- und abgetrieben. An
dem h in te ren Hoden th e ilt sich die Excretionsblase in zwei Gefässe von ansehnlicher, reichlich
die H ä lfte der Blase selbst erreichender Weite, die in oft s ta rk geschlängeltem Verlaufe u n te r
allmählicher Annäherung an die Seitenränder des Körpers nach vorn ziehen und bei sorgfältiger
Beobachtung sich ununterbrochen bis an den Mundsaugnapf heran verfolgen lassen. Das h a t
bereits V a n B en ed en ganz deutlich beschrieben und abgebildet *), trotzdem aber erwähnt P r e n a n t
24 J a h r e sp äte r in der Zusammenfassung der „ ré sultats anatomo-histologiques“ seiner U n te rsuchungen
als etwas neues: L ’appareil excréteur du Distomum tereticolle a été fig u ré2), obwohl
er denselben nicht w e ite r als bis zum Keimstocke h in h a t verfolgen können! Diese aufsteigenden
Gefässe sind also ansehnlich weit, sie nehmen auch bis vorn hin, was V a n B eneden ebenfalls
hervorhebt, n u r wenig an Weite ab, entbehren aber der Einschnürungen, die der unpaare Theil
zeigt, vollkommen. Dagegen besitzen sie noch die F äh ig k e it selbstständiger Contraction, und
es sind in der T h a t ih re Inhaltsmassen mr genau dieselben, die sich auch in der Blase finden — ,
in einer steten, auf- und absteigenden Bewegung begriffen. Der Nachweis von Muskeln in ihren
Wandungen is t noch schwerer, als in dem unpaaren Theile, wohl aber sind gelegentlich Kerne
in denselben noch anzutreffen. F ü r gewöhnlich machen diese Gefässe im Körper sehr starke
Windungen; so besonders an denjenigen Thieren, die zu r Untersuchung etwas gedrückt sind
’) Van Beneden, 1. c, p. 104, Taf. VIII, Fig. 3.
a) P r e n a n t , 1. c. p. 229.